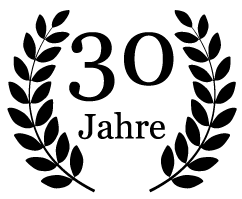Wo sind die Helden des Übergangs? (Teil 2)
Eine ökologische Transformation ist möglich - aber ausschließlich mit Geduld, Zeit und Weitsicht. Kärrnerarbeit ist gefragt, keine formelhaften Parolen. Ein Weg in einen realisierbaren wirtschaftlichen Umbau?
 Deutschland braucht viele Milliarden Euro und Jahrzehnte, um die Bahn wieder zu einem angenehmen und zuverlässigen Verkehrsmittel zu machen.
Deutschland braucht viele Milliarden Euro und Jahrzehnte, um die Bahn wieder zu einem angenehmen und zuverlässigen Verkehrsmittel zu machen.Teil 1 – Wo sind die Helden des Übergangs?
Ein ökologischer Umbau betrifft viele Menschen
Auch auf der Ebene von Branchen oder einzelner Unternehmen stellen sich viele Fragen: Wie lange dauert eine Transformation? Wie lange kann man mit dem Alten das Geld verdienen, um die Entwicklung des Neuen zu finanzieren? Werden es überhaupt dieselben Unternehmen sein oder wird ein großer Teil von ihnen einfach verschwinden? Wird ein Zahnradhersteller wirklich so einfach den Wandel schaffen, wenn Zahnräder nicht mehr gebraucht werden? Wie verändern sich Kundenbeziehungen und Lieferketten? Passen die bisherigen Hallen auch zu den neuen Produktionsverfahren? Werden die bisherigen Werke langsam ausgetrocknet und nicht mehr renoviert wie ein altes Zechengelände, während alles Geld in neue Fabriken investiert wird, die woanders auf der grünen Wiese entstehen? Woher kommen die elektrischen Komponenten, die künftig den Kern des Autos ausmachen? Kommen sie einfach von Bosch so wie bisher die Motoren für Anlasser, Scheibenwischer und Sitzverstellung? Oder versucht man, durch den Aufbau eigener Kompetenz die klassischen Elektrofirmen beim Bau von Elektromotoren zu überholen? Sind andere vielleicht schon längst da? Jedenfalls brauchen sich Unternehmen, die keine Hallen, Maschinen, Zulieferer und Belegschaften geerbt haben, auch nicht den Mühen der Transformation unterziehen. Die rasante Entwicklung des Schienennetzes im 19. Jahrhundert deutet darauf hin, dass es leichter ist, etwas ganz neu aufzubauen als später bei laufendem Betrieb zu verändern.1
In Sachsen und anderen Braunkohlegebieten versucht man, die wegfallenden Industrien und Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen auszugleichen. Auch ein solcher Vorgang ist kein Selbstläufer. Zum einen ist es nicht selbstverständlich, dass Investoren bereitstehen, die im Handumdrehen das Alte durch etwas Neues und Zukunftsträchtiges ersetzen. Nach der Wende haben wir gesehen, dass so etwas keine Sache von Monaten, sondern von Jahren und Jahrzehnten ist – und manchmal funktioniert es gar nicht. Ich selbst habe in einem Unternehmen mit Montanvergangenheit (MAN als Nachfolger der Gutehoffnungshütte) erlebt, wie langwierig die Entwicklung aufgelassener Montan-Immobilien ist. Vielfach gibt es Probleme mit Altlasten bis zurück in die frühindustrielle Zeit. Es gibt sogenannte Ewigkeitslasten und Ewigkeitsaufgaben aus dem Bergbau. Und der Bedarf an Logistik-Zentren und Shopping-Malls ist nicht unendlich – genauso wenig wie der Bedarf für Surfschulen an renaturierten Baggerseen. Im Übrigen: Auch für die Renaturierung von Braunkohle-Gruben rechnet man mit Zeiträumen von etwa 40 Jahren.
Auch wenn wir hundertprozentig von der Notwendigkeit eines ökologischen Umbaus der Wirtschaft überzeugt sind, müssen wir überlegen, wie wir es mit den Menschen bewältigen, die da sind. Ein unverbindliches „Wir müssen die Menschen mitnehmen“ reicht nicht, sondern es geht um die ganz konkrete und anfassbare Gestaltung eines Übergangs. Was werden die Menschen machen, die bisher in Tätigkeiten oder Branchen gearbeitet haben, die es in dieser Form nicht mehr geben wird? Wie viele Beschäftigte sind eigentlich davon betroffen? Werden sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder werden sie einfach etwas anderes machen? Ist die technische Umsetzung schon so klar, dass man wüsste, welche Kompetenzen man braucht? Die einfachste Form wäre, man wartet die natürliche biografische Entwicklung ab. Dies dauerte eine ganze Generation, bis der letzte Alte durch den letzten Neuen ersetzt ist – also etwa 30 Jahre. Ganz so abwegig ist diese Zahl gar nicht, denn viele historische Transformationen haben sich genau so vollzogen, auch wenn man sich einbildete, man könne es mit Druck beschleunigen.
Schnell ist man mit dem Begriff des Umschulens bei der Hand. Schauen wir uns dies anhand der Motorenproduktion genauer an. Gießereitechnik hat tatsächlich wenig mit der Fertigung von Batterien oder Elektromotoren zu tun. Einen neuen Beruf von Grund auf zu erlernen, dauert leicht drei oder vier Jahre in Vollzeit. Ein Unternehmen kann jedoch nicht die Welt anhalten und alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit auf eine solche Umschulung schicken. Nehmen wir an, man könne es bei laufendem Betrieb verkraften, jeweils zehn Prozent der Belegschaft in eine Neuqualifizierung abzustellen. Dann dauerte die Umschulung der Belegschaft rund 30 Jahre. Und selbst wenn sich ein Teil davon durch natürliche Abgänge und Zugänge von selbst erledigte, hätte man es trotzdem mit einem längeren Zeitraum von zehn oder 15 Jahren zu tun. Dies hieße aber gleichzeitig, dass sich der Personalaufwand, der bei Industrieunternehmen etwa 30-40 Prozent des Umsatzes beträgt, relativ um zehn Prozent erhöhte (absolut um drei oder vier Prozentpunkte) – Geld, das an anderer Stelle fehlte. Staatliche Zuschüsse für solche Umschulungen wären schwer realisierbar, wenn ein zu großer Teil der Erwerbstätigen davon betroffen wäre – über sechs Millionen Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig. Und selbst wenn erneut ein „Wumms“ oder „Doppelwumms“ möglich wäre, würde das staatliche Geld an anderer Stelle fehlen, etwa für den Aus- und Umbau der Infrastruktur, geschweige denn für Schulen, Kindergärten oder neuerdings für die Verteidigung. Prinzipiell bin ich gar nicht pessimistisch: Eigentlich ist es für Unternehmen ganz normal, einen Teil der Erträge in etwas zu investieren, das erst später Früchte trägt und auch nicht immer gelingt – ja, genau das ist Unternehmertum. Aber dieses Spiel kann man nicht mit beliebigen Einsätzen und willkürlich vorgegebener Geschwindigkeit machen.
Respekt für alle, die durch ihre Arbeit unsere Handlungsfähigkeit sichern
Zahlreiche Unternehmen haben die Notwendigkeit erkannt, rechtzeitig Neugeschäft zu generieren. Sie haben dafür eigene Einheiten gegründet, sie in loftartige Gebäude umquartiert und auch neue Leute an Bord geholt – zum Beispiel aus dem Silicon Valley. Das ist einerseits richtig und notwendig, andererseits kann es leicht passieren, dass diese Speerspitze sich für unfehlbar hält, die inneren Strukturen einer Branche unterschätzt und keine Geduld hat, sich verantwortungsvoll und nachhaltig der Kärrnerarbeit des Wandels zu widmen. Die traditionellen Einheiten werden oft negativ charakterisiert (als „Death Valley“ im Gegensatz zum „Silicon Valley“), tatsächlich jedoch verdienen sie das Geld, das die Neuen ausgeben. Kein Wunder, wenn die Alten misstrauisch beobachten, was die Neuen machen und vielleicht auf jeden Fehler warten. Wird es in den Unternehmen eine Spaltung und Eifersüchteleien geben zwischen „Altgeschäft“ und „Neugeschäft“ oder zwischen „gut“ und „böse“? Und auch wenn man sich für die Zukunft von bestimmten Technologien verabschiedet, wird man – wie bei der Kernkraft – noch Jahrzehnte fähigste und tüchtigste Leute brauchen, die sich mit diesen Technologien auskennen, sie warten, updaten und schließlich entsorgen können. Wie kann man gute Leute für so etwas gewinnen, wenn man ihnen gleichzeitig sagt, dass sie ein moralisch fragwürdiges Auslaufmodell sind?
Die gegenwärtige Betonung des sogenannten „Purpose“ von Branchen, Unternehmen und Tätigkeiten ist gerade in der Transformation mehr als kontraproduktiv. Hat eine Arbeit in einem Unternehmen für Umwelt- oder Medizintechnik mehr Purpose als ein Steinbruch? Ein Krankenhaus mehr als eine Autowerkstatt? Eine Gleichstellungsbeauftragte mehr als ein Lagerarbeiter? Nehmen wir eine Arbeit, die nach den gängigen Beschreibungen besonders mit Purpose ausgestattet sein müsste, etwa ein Ingenieur im Bereich erneuerbarer Energien.2 Lebt dieser Mensch (und sein Unternehmen) von seinem Purpose? Braucht man nicht in jeder Umwelttechnik auch Schrauben? Wird dieser Ingenieur in seiner Pause nicht auch ein Wurst- oder Käsebrot essen? Hat ein Windrad keine Zahnräder? Werden die Windräder nicht vielleicht mit Lkws zu ihrem Einsatzort gebracht und müssen diese Fahrzeuge nicht bisweilen repariert werden – von einem Kfz-Mechaniker, der selbst wieder Schrauben benötigt und in der Pause Wurstbrote isst?
Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, wie den „totalen Krieg“. Es gibt nicht die ausschließliche Ausrichtung aller Ressourcen auf ein einziges Ziel. Dies hat weder nach Göbbels Sportpalastrede im Zweiten Weltkrieg stattgefunden noch in der Coronakrise.3 Es hat aber auch in den größten Krisen der Menschheit nicht stattgefunden, etwa den großen Pestepidemien, die jeweils ein Drittel der Weltbevölkerung hinwegrafften. In der Justinianischen Pest des 6. Jahrhunderts wurden Meisterwerke wie die Hagia Sophia gebaut. In der Großen Pest des 14. Jahrhunderts begann die Renaissance. Menschen können nicht alles auf den Klimawandel ausrichten. Sie müssen und wollen auch andere Dinge tun. Zum Beispiel essen. Und wenn sie essen wollen, brauchen sie Geräte, um Essen zu produzieren. Und Leute, die diese Geräte herstellen. Und andere Leute, die die Teile herstellen, aus denen die Geräte gebaut werden. Und es braucht Leute, die diese Menschen mit Essen versorgen, ihnen die Haare schneiden oder ihre Toiletten reinigen. Im Nu rollt sich das Leistungsnetzwerk einer arbeitsteiligen Wirtschaft ab und alle Versuche, durch Begriffe wie „systemrelevante Berufe“ oder „Purpose-Unternehmen“ einzelnen Tätigkeiten oder Branchen eine höhere Weihe zu verleihen, erweisen sich als unhaltbar. 4
Im Übergang um die Ecke denken und Prioritäten setzen
Blicken wir auf einzelne Technologien und ihre Rolle im Übergang. Nie verstanden habe ich die Verteufelung des Dieselantriebs in Zeiten, in welchen wir nach jeder Reduzierung des fossilen Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen suchen. Am Beispiel des Porsche Cayenne kann man das deutlich machen, auch wenn es gewiss kein Massenauto ist: Bei diesem Modell hatte der Dieselmotor in Deutschland einen Verkaufsanteil von 80 Prozent. Sein realistischer Testverbrauch lag bei 9 Liter auf 100 km gegenüber 12,2 Litern beim vergleichbaren Benziner, d.h. der Benziner verbraucht 35 Prozent mehr. 2017 hat sich Porsche grundsätzlich vom Dieselmotor verabschiedet. Für Deutschland bedeutete dies eine Steigerung der CO2-Emissionen aus diesem Modell um 28 Prozent (35 Prozent Steigerung für 80 Prozent der Verkäufe). Nun mag dies ein besonders plakatives Beispiel sein, aber warum macht man dem Diesel das Leben seit Jahren schwer, statt ihn als bevorzugte Übergangstechnologie zu fördern?
Schnell kommen dann Argumente wie Stickoxyde oder Feinstaub ins Spiel. Ich will demgegenüber nicht nur darauf abheben, dass die meisten dieser Vorwürfe durch aufwendigste Abgastechnologie längst erledigt sind. Mir geht es vielmehr um die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen: Niemand könnte im Leben handeln, wenn alle Gesichtspunkte, Probleme und Hindernisse dasselbe Gewicht hätten. Im realen Leben gibt es kein hundert Prozent Gut gegen hundert Prozent Böse, sondern man muss immer Abwägungen treffen, Prioritäten setzen, mit Zielkonflikten umgehen und für Fortschritte an einer Stelle einen Preis an anderer Stelle zahlen. Und wenn es stimmt, dass die Senkung der Treibhaus-Emissionen die alles entscheidende Aufgabe der Menschheit ist, dann müssen Themen wie Stickoxyde oder Feinstaub eben zurückstehen – selbst wenn sie tatsächlich noch reale Probleme wären.
Und wie groß wäre der Preis tatsächlich, den wir zahlen müssten? Wir befinden uns nicht in der Frühzeit des Verbrennungsmotors. Beim VW Käfer meiner Studentenzeit waren Verbräuche bis 15 Liter ganz normal und es qualmte ungefiltert aus dem Auspuff. Das ist jedoch Vergangenheit. Wir sind längst im Bereich des abnehmenden Grenznutzens: Wenn man etwas verbessern will, dann kann man am Anfang mit relativ geringem Aufwand große Erfolge erzielen. Mit der Zeit braucht man immer größeren Einsatz für immer kleineren Output. Und irgendwann geht der Einsatz gegen Unendlich und der Zusatznutzen gegen Null. In dieser Grenznutzenkurve, die es in vielen Zusammenhängen gibt (zum Beispiel bei der Geschwindigkeit von Flugzeugen), muss man rechtzeitig aufhören. Es ist nicht ethisch, ständig Grenzwerte zu verschärfen und riesige Investitionsmittel in minimale Verbesserungen zu lenken – Investitionsmittel, die an anderer Stelle fehlen. Unsere Umweltbewegung hat nie gelernt, Themen zu beenden – und genau dies als Erfolg zu feiern. Ganz konkret: Ich verstehe nicht, dass man auf EU-Ebene das Verbrenner-Aus für 2035 beschließt und gleichzeitig die Abgasnorm EURO 7 vorantreibt, die – selbst wenn man den Unmöglichkeitsklagen der Automobilindustrie misstraut – nur mit größten Aufwendungen zu erreichen ist. Mit Aufwendungen für minimale Verbesserungen in einer Technologie, die gleichzeitig als aussterbend deklariert wird. Warum sagt man nicht umgekehrt: „Liebe Autoindustrie, bitte lasst die Verbrennungsmotoren auf dem guten Stand, den wir heute haben. Bitte steckt keinen einzigen Cent in weitere minimale Verbesserungen. Bitte steckt alles Geld in alternative Antriebe, neue Batterietechnik oder nachwachsende Rohstoffe.“
Ähnliche Fragen stelle ich mir hinsichtlich der Bahn. Ich selbst bin seit meiner Kindheit absoluter Fan des Bahnreisens. Allerdings macht die Bahn diese Zuneigung verdammt schwer – Erlebnisse von Verspätungen, Ausfällen, geänderten Wagenreihungen und defekten Toiletten auszutauschen, wurde inzwischen zum Volkssport der Deutschen. Und in Zahlen ausgedrückt: Wir brauchen viele Milliarden und Jahrzehnte, um die Bahn wieder zu einem angenehmen und zuverlässigen Verkehrsmittel zu machen – bei laufendem Betrieb. Wenn wir das wissen, warum schickt man pauschal die Reisenden auf die Bahn, macht die Angebote künstlich attraktiv und den Autofahrern zusätzlich das Leben schwer? Gerade wenn man an die Zukunft der Bahn glaubt, müsste man vielleicht den Autofahrern sagen: „Bitte wechselt in den nächsten 20 Jahren möglichst nicht zur Bahn, sondern fahrt Auto, wann immer es geht. Dann schaffen wir es nämlich, die maroden Strecken schneller zu reparieren und die Züge schneller in einen besseren Zustand zu bringen.“
Nehmen wir an, wir hätten einen perfekten Übergang vom Verbrenner zum Elektroauto. Für jeden wegfallenden Verbrenner würden die Unternehmen ein wertschöpfungsgleiches Elektroauto verkaufen. Gesamtabsatz und Gesamtumsatz blieben immer gleich. Der Haken: Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Übergang so perfekt funktionierte, wäre es nicht dasselbe. Denn auch wenn die Summe gleich wäre, wären dennoch die Stückzahlen der alten und neuen Technologie geringer – am Kreuzungspunkt halbiert. Geringere Stückzahlen bedeuten jedoch höhere Stückkosten. Grundaufwendungen etwa für Entwicklung müssen auf weniger Produkte umgelegt werden. Die Hersteller müssten es über höhere Preise beim Kunden holen oder bei Qualität oder Investitionen sparen, was aber in dieser Phase gerade nicht passieren soll. Und nicht zu vergessen, bis zum letzten Tag stehen beide Technologien im Wettbewerb zu anderen. Man braucht den Erfolg der alten Technologie, um mit ihren Erlösen den Einstieg in die neue Technologie zu finanzieren. Im übertragenen Sinne müsste man also sagen: „Bitte kauft möglichst viele S-Klassen mit 12-Zylinder-Verbrennungsmotor, damit das Unternehmen Geld hat, um den Übergang zur Elektromobilität zu finanzieren.“
Ich habe auch selbst dazugelernt. Eigentlich hatte ich immer eine tiefe Abneigung gegen Hybridantrieb, weil es mir als technisch halbwegs Gebildetem gegen den Strich ging, das Gewicht, den Platzbedarf und die Anfälligkeit von zwei Antriebssystemen in der Gegend herumzufahren. Und über viele Jahre konnten Hybridantriebe auch ihr Verbrauchs- und damit Emissionsversprechen nicht einhalten, schon gar nicht, wenn die elektrische Reichweite in der Praxis nur wenige Kilometer betrug. Inzwischen nähern sich die elektrischen Reichweiten von Plug-in-Hybrid-Autos der 100 km Marke. Damit können sie eine sinnvolle Übergangstechnologie sein. Bei den vielen Fahrten, die man im näheren Umfeld macht, kann man rein elektrisch fahren. Bei den wenigen längeren Fahrten bewegt man sich noch mit Verbrenner, bis die Speichertechnik und Ladeinfrastruktur für vollelektrische Autos weiterentwickelt ist. In gewisser Weise ist Elektromobilität generell eine gute Übergangstechnologie. Während ein Verbrenner nicht so einfach zwischen Gas, Kohle, Öl oder Wasserstoff wechseln kann, ist es dem Elektroauto egal, aus welchem kurz- oder langfristigen Energiemix der Strom stammt.
Man muss auch sehen, dass sich die Probleme verändert haben. In städtischen Ballungsgebieten entwickelter Länder existiert das Problem der Abgaskonzentration und des Smogs nicht mehr wie früher. Es gibt sogar seriöse Untersuchungen, dass ein moderner Dieselmotor die Luft von Feinstaubpartikeln mehr reinigt als er sie emittiert.5 Man braucht also einen Elektroantrieb nicht mehr, um Ballungsgebiete von Schadstoffen zu entlasten, sondern weil er – sofern der Strom regenerativ erzeugt wurde – die Emission des für uns nicht giftigen, aber den Treibhauseffekt erhöhenden CO2 verringert. Ein gutes Beratungsprojekt beginnt immer mit einer Situationsanalyse. Dabei geht es nicht nur darum, Problemzonen zu identifizieren, sondern auch herauszufinden, wo keine Probleme sind. Das ist genauso wichtig wie die Probleme selbst, denn niemand kann überall gleichzeitig handeln. Deshalb freue ich mich immer, wenn ein Umweltproblem (oder ein anderes gesellschaftliches Problem) gelöst ist: Lachse im Rhein, Trinkwasser im Bodensee und saubere Luft in den Städten.
Ich habe diese plakativen und vereinfachten Beispiele nicht gebracht, weil ich sie auf zwei Stellen hinter dem Komma für die alleinige Wahrheit halte. Mir ging es vielmehr darum, dass der Umbau einer Branche, einer Infrastruktur und einer Volkswirtschaft ein schwieriger Vorgang ist. In diesem Vorgang muss man ständig um die Ecke denken, man muss die Ressourcen im Auge behalten. Man muss Prioritäten setzen und Themen beenden können, wenn man einen guten Stand erreicht hat. Man darf nicht das untergraben, was noch als Quelle der finanziellen und personellen Handlungsfähigkeit hin zum Neuen dient. Man darf die Zeiträume eines Wandels nicht unterschätzen. Ein moralisierender Überbietungswettbewerb um Grenzwerte und den Schadstoff der Woche führt ebenso in die Handlungsunfähigkeit wie die gebetsmühlenartige Behauptung, dass nichts passiert sei.
Wir brauchen Helden des Übergangs
Hans Magnus Enzensberger setzte 1989 in einem Leitartikel den „Helden des Rückzugs“ ein Denkmal und dachte dabei vor allem an Michail Gorbatschow.6 Der spanische Schriftsteller Javier Cercas machte sich den Begriff zu eigen in seinem Buch „Anatomie eines Augenblicks“ über den Staatsstreich von 1981 und wandte ihn auf den damaligen Ministerpräsidenten Adolfo Suarez an.7 „Helden des Rückzugs“ sind oft tragische Figuren. Den Verfechtern des Alten, aus dem sie selbst stammen, gelten sie als Verräter und Zerstörer. Die Verfechter des Neuen empfinden sie als Bremser und Verhinderer. Aber tatsächlich sind sie Helden, weil ohne eine solche Brücke Veränderungen leicht in Mord und Totschlag enden – man nehme etwa die Folgen des Arabischen Frühlings. Ich finde, wir brauchen auch im ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft solche Helden des Rückzugs oder besser „Helden des Übergangs“. Und zwar nicht nur einen großen, sondern viele kleine in Politik, in den Unternehmen, bei den öffentlichen Dienstleistern. Wer ein Ziel wirklich erreichen will, der muss sich den Mühen und krummen Wegen der Transformation unterziehen. Wer das nicht will, dem ist offensichtlich das Ziel gar nicht so wichtig.
Es mag engstirnige Industrie-Lobbyisten und schwarze Schafe geben – der Diesel-Skandal war eine wirklich üble Geschichte, über den sich niemand mehr ärgerte als rechtschaffene Ingenieure und Unternehmer. Aber generell gilt: Unternehmen sind nicht die natürlichen Feinde des ökologischen Umbaus. Seit Jahrzehnten sind Ingenieure genauso besessen von Verbrauchsreduzierungen wie von Rundenzeiten auf dem Nürburgring. Aber selbst, wenn es nicht so wäre, ist es für die hier diskutierte Frage gar nicht relevant. Und es ist auch nicht relevant, ob es sich um eine kapitalistische, sozialistische oder wie auch immer ausgerichtete Wirtschaft handelte. Die Herausforderung der Transformation ist letztlich unpolitisch: Ich selbst bin Mitglied im Aufsichtsrat einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft, die Wohnstifte für Senioren betreibt. Viele unserer Einrichtungen stammen aus den 60er und 70er Jahren. Die Immobilien wurden immer gut instandgehalten, aber irgendwann erreicht ein Gebäude das Ende seines Lebenszyklus und auch die Lebensstile der älteren Menschen ändern sich. In den nächsten Jahren stellt sich für viele unserer Einrichtungen die grundsätzliche Frage: Grundsanierung, Abriss, Neubau, Verkauf? Gleichzeitig verbringen in den Gebäuden Hunderte alte Menschen ihren verdienten Lebensabend. Und wir wissen, dass wir nicht alles in einem Jahr schaffen werden. Dieses Dilemma ist niemandes Schuld, niemandes Versäumnis, niemandes böser Wille, sondern eine solche Transformation ist einfach technisch, organisatorisch oder finanziell eine schwierige Aufgabe. Und was für dieses kleine Beispiel gilt, gilt erst recht für die gewaltige Aufgabe des ökologischen Umbaus einer Volkswirtschaft – wohlgemerkt bei laufendem Betrieb.
Vor einigen Jahren hatte ich ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität von Zaragoza und einem schwedischen Energiekonzern initiiert und begleitet. Es ging um die Schaffung sogenannter „Erneuerbare-Energie-Regionen“ und ich tauchte tief in diese Szene ein. Mich überzeugte dabei nicht nur die Idee an sich, sondern mir gefiel auch der Pragmatismus und Realitätsbezug, der die Aktivisten auszeichnete. Sie kannten das Problem der stabilen Grundlast und plapperten nicht leichtfertig vom vermeintlichen Allheilmittel der „intelligenten Netze“. Sie traten für Technologieoffenheit ein und warnten davor, sich für eine Energieform zu begeistern, bevor man die regionale Nutzbarkeit regenerativer Energiequellen analysiert hat. Sie wussten genau, dass summarische Prozentanteile regenerativer Energien nichts nützen, wenn nicht jederzeit genügend Energie für die tatsächliche Verbrauchskurve zur Verfügung steht. Sie waren sich bewusst, dass dieser Abgleich von Erzeugung und Verbrauch nicht nur im perfekten Endstadium, sondern auch in jeder Phase des Übergangs aufgehen musste. Sie hatten kreative Ideen, um alle regionalen Speichermedien zu nutzen – etwa Kühlhäuser. Und schließlich kannten sie die Kurve des abnehmenden Grenznutzens und warnten davor, mit aller Gewalt ihr eigenes Ideal, nämlich die 100-Prozent-Marke erreichen zu wollen. In ihrer Mischung von Idealismus und Bodenständigkeit waren diese Aktivisten für mich wirkliche „Helden des Übergangs“.
Vieles in der aktuellen Klimadiskussion erinnert mich demgegenüber an Parolen wie „Profit, Profit, Profit“ oder die Anbetung des „Shareholder Value“ in den neunziger Jahren. Profitabilität und Shareholder Value mögen ein schönes Ergebnis sein, aber sie sind kein fruchtbares Ziel. Wer gar glaubt, Profitabilität oder Shareholder Value seien Stellhebel, der vernichtet Unternehmenswerte und überschreitet leicht die Grenze zum Kriminellen. Ähnliches gilt auch für das gutgemeinte Gegenstück: Arbeitsplätze sind ein schönes Ergebnis, aber man schafft keine Arbeitsplätze, indem man Arbeitsplätze schafft.
Dass man in einer Transformation Entscheidungen trifft und Wege einschlägt, die sich im Nachhinein als falsch erweisen, dass Dinge länger dauern als erwartet oder erhofft – das alles wird passieren und ist unvermeidlich. Ethisch nicht vertretbar ist jedoch der Glaube, alles sei ganz einfach, man müsse nur wollen und die richtige Haltung haben und man könne sich ständig mit anspruchsvollen Terminsetzungen überbieten. Wer glaubt, ein erfolgreiches Votum für „Klimaneutralität 2030 statt 2045“ mache die ökologische Transformation auch nur einen Tag schneller, der irrt. Wenn wir uns nicht seriös auf die schwierige Kärrnerarbeit der schrittweisen Verbesserungen und auf die noch schwierigere Gestaltung des Übergangs bei laufendem Betrieb einlassen, dann werden wir nichts von dem erreichen, was wir anstreben, aber alles zerstören, was uns den überhaupt die Handlungsfähigkeit im Wandel verleiht.
Der Autor
Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen.
Anmerkungen und Quellen
1 In den 30 Jahren zwischen 1865 und 1895 wuchs das Schienennetz in Deutschland um 30.000 km – also rund 1.000 km pro Jahr. Ausbau und Elektrifizierung der bestehenden 197 km langen Bahnstrecke von München nach Lindau dauerte fast drei Jahre – nach 40 Jahren Vorbereitungszeit.
2 Vgl. zum Beispiel: „Aus Sicht von Good Jobs sind Purpose-Unternehmen solche, die einen Mehrwert für die Gesellschaft oder die Umwelt bieten. Diese Unternehmen sind im Bereich Bildung, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klimaschutz etc. tätig oder setzen sich dafür ein, dass zum Beispiel menschliches Leid gelindert wird. Kurzum, sie streben danach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“ https://www.hallokarriere.com/purpose-unternehmen/
3 NZZ 31.3.2023 „In ihrem Alarmismus gingen Modellierer sogar so weit, eine Zero-Covid-Strategie zu fordern – die totalitäre Phantasie einer totalen Stilllegung der Gesellschaft. Auch der deutsche Corona-Papst Christian Drosten äußerte Sympathie für die monströse Idee: ‚Es wäre absolut erstrebenswert, jetzt auf die Null zumindest zu zielen.‘“
4 Siehe dazu auch Annekatrin Schrenker / Claire Samtleben / Markus Schrenker, Applaus ist nicht genug. Gesellschaftliche Anerkennung systemrelevanter Berufe, Aus Politik und Zeitgeschichte APUZ 13-15 (2021), Bundeszentrale für politische Bildung https://www.bpb.de/apuz/im-dienst-der-gesellschaft-2021/329316/gesellschaftliche-anerkennung-systemrelevanter-berufe
5 Dirk Gulde, Reinigt der Diesel wirklich die Luft?, 19.9.2019 https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/dieselabgase-partikelmessungen-im-realbetrieb/
6 Hans Magnus Enzensberger, Die Helden des Rückzugs, F.A.Z. 9.12.1989
7 Javier Cercas, Anatomie eines Augenblicks. Die Nacht, in der Spaniens Demokratie gerettet wurde, Frankfurt am Main 2011