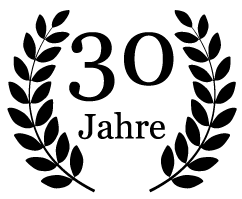Krankes Wachstum
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von PAUL SCHREYER, 7. Juli 2010 –
Jahr für Jahr steigt der Medikamentenumsatz. Der unabhängige Chef eines öffentlichen Arzneiprüfungsinstitutes muss im September seinen Hut nehmen – offenbar auf Druck der Pharma-Lobby. Zeit für einen gründlichen Blick in die Welt der Arzneikonzerne.
2009 war das Jahr der Auftragseinbrüche und Insolvenzen für die deutsche Wirtschaft. Es gab jedoch eine Branche, die der allgemeinen Krise erstaunlich gut trotzte und sogar mustergültige Wachstumszahlen vorlegen konnte. So waren es im letzten Jahr erstmals mehr als 30 Milliarden Euro, die die gesetzlichen Krankenversicherungen für Arzneimittel ausgeben mussten – eine erneute Steigerung um über fünf Prozent für die Pharma-Konzerne. (1) Je gesetzlich Versichertem summieren sich die Arzneikosten nun schon auf über 400 Euro pro Jahr. Kein Posten im Gesundheitswesen wächst schneller. Wie kommt es zu diesem kontinuierlichen Anstieg?
Die forschende Pharmaindustrie steht eigentlich schon seit vielen Jahren unter Druck. Hersteller von Generika, also preiswerten Nachahmerpräparaten, erkämpfen ständig höhere Marktanteile und bedrängen die Produzenten von patentgeschützten Medikamenten. Jahr für Jahr werden mehr Generika verschrieben. Der medizinisch notwendige Mehrbedarf an Arzneimitteln wird ausschließlich durch sie gedeckt. Die patentgeschützten Pillen hingegen werden immer weniger wichtig – und zugleich immer teurer. Diese Nichtgenerika machen nur noch 30 Prozent der ärztlichen Verordnungen aus, aber 60 Prozent des Umsatzes. (2) Anscheinend versuchen die Konzerne, im Patentmarkt sinkende Umsätze durch steigende Preise auszugleichen. Der Wettbewerb scheint außer Kraft gesetzt.
Dies ist möglich, da Deutschland ein internationaler Sonderfall ist. Sobald ein Medikament hier neu zugelassen ist, müssen die Krankenkassen die Kosten dafür auch erstatten – zu Preisen, die die Konzerne nach eigenem Ermessen festlegen. Die Patentlaufzeit beträgt 20 Jahre. Wenn man von acht Jahren von der Anmeldung bis zur Zulassung eines neuen Medikamentes ausgeht, bleiben den Pharma-Multis zwölf Jahre garantierte hochpreisige Erstattung durch die Krankenkassen. Planwirtschaft für Unternehmensprofite sozusagen.
Da Patente natürlich nur für Neuerungen vergeben werden, die Konzerne aber auf dem derzeitigen hohen Entwicklungsstand der Medizin und Pharmakologie nicht permanent bahnbrechende Entdeckungen machen, werden sogenannte „Analogpräparate“ immer wichtiger für die Umsätze der Multis. Diese enthalten neue Wirkstoffmoleküle mit analoger medizinischer Wirkung, wie bereits bekannte Arzneimittel. Es handelt sich also um chemische Neuerungen ohne therapeutische Vorteile – man könnte auch sagen: Scheininnovationen. Diese sind jedoch patentfähig. Wenig überraschend verdoppelte sich in den letzten zehn Jahren der Umsatz der Analogpräparate auf über fünf Milliarden Euro. (3)
Dazu kommt, dass Deutschland im europäischen Vergleich ungewöhnlich hohe Medikamentenpreise hat. Allein durch eine Angleichung bei den Generika auf das Preisniveau von Großbritannien würde die gesetzliche Krankenversicherung hierzulande mehr als 3 Milliarden Euro sparen. (3) Die extreme Differenz ist kein Zufall. Viele Hersteller haben ein starkes Interesse an hohen Preisen in Deutschland. Denn Nachbarländer wie Frankreich, die Schweiz oder Holland orientieren sich bei ihren Preisverhandlungen am deutschen Niveau, das den „Referenzpreis“ darstellt, wie sogar eine Pharmalobbyistin offen zugibt. (4)
Versuche der Politik, die überbordenden Arzneikosten zu begrenzen, gab es viele. Nur selten waren sie von Erfolg gekrönt. Bereits Anfang der 90er Jahre bemühte sich der damalige Gesundheitsminister Seehofer, eine „Positivliste“ einzuführen. Eine solche Liste, die viele Experten für notwendig halten, würde die Anzahl der erstattungsfähigen Medikamente auf ein sinnvolles Maß begrenzen – und damit natürlich auch die Umsätze der Hersteller. Im Rahmen der Gesundheitsreform 2004 scheiterte der Versuch erneut. Doch unter Ministerin Schmidt wurde immerhin erstmals eine unabhängige Arzneimittelbewertung installiert: das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG).
Unter seinem Leiter Peter Sawicki erstellt das Institut seither beweisgestützte Gutachten zur Frage, welche Medikamente und Behandlungsmethoden wirklich therapeutische Fortschritte bringen – und welche eben nicht. Auftraggeber sind das Gesundheitsministerium sowie der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, der über das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung entscheidet. Vergleichbare Institute sind in den vergangenen Jahren in vielen Ländern entstanden. Für die Pharmakonzerne mit ihrer Flut von überflüssigen Analogpräparaten stellt das eine ernsthafte Bedrohung dar. Besonders wenn der Institutsleiter, wie im Fall Sawicki, strikt auf seine Unabhängigkeit pocht.
Während der schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen im letzten Herbst war das ein Thema. Eine Gruppe von CDU-Gesundheitspolitikern spielte den Verhandlungsführern der Union ein Papier mit „Kernforderungen an eine schwarz-gelbe Gesundheitspolitik“ zu, in dem auch verlangt wurde, das IQWiG neu zu ordnen. Zitat: „Diese Neuausrichtung muss sich auch an der personellen Spitze des Hauses niederschlagen.“ (5) Im Klartext: Sawicki soll weg.
Als diese Information an die Öffentlichkeit kam, formierte sich Anfang des Jahres breiter Widerstand. Mehr als 600 Ärzte und Professoren unterschrieben eine Erklärung, in der sie die Verlängerung von Sawickis Vertrag forderten, der im Sommer 2010 ausläuft. In dem offenen Brief, der auch an Gesundheitsminister Rösler ging, heißt es, Sawicki sei unabhängig, verfüge über große Reputation und stehe gerade für die Interessen der Patienten. Die Fachleute mahnten: „Wir als Hausärzte brauchen solche unabhängigen Informationen.“ (6)
Doch die Gegner hatten offenbar mehr Einfluss. Mit dem Vorwurf, der Institutsleiter habe Dienstreisen nicht korrekt abgerechnet, wurde sein Rauswurf begründet. Angesichts der offensichtlichen Interessenlage erschien das vielen ziemlich durchsichtig. Auch die Tatsache, dass Minister Rösler sich in der Personalfrage öffentlich zurückhielt, war keine Überraschung. Denn in seiner vorherigen Funktion als Wirtschaftsminister von Niedersachsen hatte Rösler noch 2009 einen Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt, in dem neue Kriterien für die Kosten-Nutzen-Bewertung von Medikamenten gefordert wurden. Zitat: „Hierzu zählen unter anderem … die Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere der heimischen pharmazeutischen Industrie.“ Das Institut sollte also nach Röslers Wunsch bei der Wirksamkeitsprüfung von Arzneimitteln auch die Profitinteressen der Konzerne berücksichtigen. Nach Recherchen der ARD stammten wesentliche Teile des Papiers damals direkt von der Pharmalobby. (7)
Dass diese in Deutschland so effizient arbeitet, ist auch das Ergebnis kluger Personalpolitik. Die Chefin des „Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller“ (VFA) heißt seit 1997 Cornelia Yzer. Die durchsetzungsfähige Frau war lange Jahre CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin unter dem damaligen Forschungsminister Jürgen Rüttgers sowie vorher unter der Ministerin für Frauen und Jugend – damals Angela Merkel.
Kontakte, die mit Geld nicht aufzuwiegen sind. Yzers Verband beschäftigt im Auftrag der Pharma-Multis mehr als 50 Mitarbeiter in seiner Berliner Zentrale. Die Verhinderung der Positivliste ist auch ihr Verdienst. Ihre Arbeit beschreibt die Lobbyistin offen und sachlich: „Im Optimalfall setzt unsere Beratung im frühen Entscheidungsstadium an. Wenn die Beamten sich zunächst orientieren, sich Basiswissen aneignen müssen. In dieser Phase können wir konstruktiven Einfluss auf den Gesetzestext nehmen, auch juristische Hilfe bei Formulierungen anbieten.“ (8)
Auf Seiten der Politik trifft der Verband bei Schwarz-Gelb auf offene Ohren. Die gesundheitspolitischen Sprecher von CDU und FDP heißen Jens Spahn und Daniel Bahr, sind beide um die dreißig und Vertreter eines neuen, hocheffizienten und stromlinienförmigen Politikertyps. Spahn hat das CDU-Thesenpapier, dass forderte, Sawicki zu beseitigen, mit ausgearbeitet, Bahr ist nun parlamentarischer Staatssekretär unter Minister Rösler – und auch schon einmal als Gastautor für den Pharmaverband tätig. Ein Zufall, dass Spahn und Bahr, die sich eigentlich um das Gesundheitswesen im Sinne der Patienten kümmern sollen, beide eine Berufsausbildung als Bankkaufmann vorzuweisen haben?
In einem Interview mit der FAZ gab Cheflobbyistin Yzer auf die Frage nach Fehlern ihrer Branche jedenfalls eine interessante Antwort: „Ja, es gibt einen jahrzehntelangen Branchenfehler: Der Patient wurde nicht als Kunde angesehen.“ (9) Der Patient als Kunde, die Heilung als Geschäft – dies ist ein Paradigmenwechsel, der auf globaler Ebene längst vollzogen ist.
Kein Wunder, hat doch der globale Arzneimarkt ein Volumen von knapp 800 Milliarden Dollar erreicht, gut doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. (10) Deutschland ist weltweit der drittgrößte Verkaufsplatz. Der Marktführer bei uns heißt Hexal, ein Tochterunternehmen der Novartis Gruppe, die im Jahr 2008 einen Gewinn von 8 Milliarden Dollar einfuhr. Eine Umsatzrendite von 20 Prozent – das ist in der Pharmabranche keineswegs ungewöhnlich. 30 Prozent des Umsatzes wiederum, etwa 13 Milliarden Dollar, gab das Unternehmen im gleichen Jahr für Marketing und Verkauf aus – auch das kein unüblicher Wert. (11) Der Konzernchef Joe Jimenez gilt als ausgewiesener Marketingexperte und arbeitete vorher als Berater für den Finanzinvestor Blackstone. Willkommen im globalen Casino.
Dabei ist Novartis weltweit nur die Nummer Vier. Die wahren Zocker sitzen bei Pfizer, dem Weltmarktführer. Der Konzern hat einen Börsenwert von circa 150 Milliarden Dollar – mehr als Daimler, RWE und Deutsche Bank zusammen. Im Jahr 2003 war Pfizer das viertprofitabelste Unternehmen weltweit und spielte in einer Liga mit den Ölmultis Exxon und Shell. Der Chef heißt Jeffrey Kindler und war vorher Jurist bei McDonalds. Dass ein Anwalt die Spitzenposition im Konzern einnimmt, wirft zugleich ein Licht auf die wachsende Bedeutung von Rechtsstreitigkeiten in der Branche, die immer mehr mit auslaufenden Patenten und Zulassungsbehörden zu kämpfen hat.
Pfizer ist in der Art der Unternehmensführung fast schon ein Finanzkonzern. Dies spiegelt sich auch in der Besetzung des Vorstands, der zur Hälfte aus Bankern besteht. Mitglied William Gray ist zugleich Vorstand des Bankriesen J.P. Morgan, George Lorch ist bei HSBC, Stephen Sanger bei Wells Fargo und Suzanne Johnson kommt von Goldman Sachs. Die Liste ließe sich verlängern.
Doch wem gehört der Konzern eigentlich? Interessanterweise sind mehr als 60 Prozent der Pfizer-Aktien im Besitz von institutionellen Investoren und Investmentfonds. (12) Diese wollen Geld sehen, erwarten Jahr für Jahr Höchsterträge und kontrollieren die Managemententscheidungen der Firma. Hauptanteilseigner ist der Finanzhai BlackRock, dem ein 8 Milliarden Dollar schweres Stück vom Kuchen gehört.
BlackRock, ein in der deutschen Öffentlichkeit wenig bekannter Konzern, ist zugleich der weltgrößte Anlageverwalter. Die gemanagte Summe beläuft sich auf schwer fassbare 3.300 Milliarden Dollar. (13) Wie die Bankriesen Goldman Sachs und J.P. Morgan gehört auch BlackRock zu den wenigen Profiteuren der Finanzkrise und damit anscheinend zur obersten Kaste im globalen Kapitalismus. (14) Dass der Vizechef ein ehemaliger Goldman-Sachs-Banker ist und den US-Finanzminister bei seinen Reaktionen auf die Finanzkrise „beriet“, überrascht da kaum. (15) Erwähnenswert: BlackRock ist auch Großaktionär bei vielen deutschen Konzernen. An Flagschiffen wie Allianz, E.ON, RWE, Daimler und anderen hält das Unternehmen jeweils milliardenschwere Anteile. (16)
Die geballte Macht von Finanzinvestoren wie BlackRock also bedrängt Pfizer, die unter dem Druck der Renditeerwartung eine immer waghalsigere Geschäftspolitik fahren. Die Vorgabe, dass ein neu entwickeltes Arzneimittel möglichst sofort ein sogenannter „Blockbuster“ wird, also ein Produkt mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Dollar, verengt den Blickwinkel, schmälert die Bandbreite der angebotenen Medikamente – und erhöht das unternehmerische Risiko. Bei Pfizer hängt bereits ein Viertel des Umsatzes, das sind 12 Milliarden Dollar, an einem einzigen Präparat, dem Cholesterinsenker „Lipitor“. (17)
Dazu kommt, dass bei Pfizer immer weniger selbst geforscht wird, was natürlich aufwändig und risikobehaftet ist. Stattdessen werden erfolgversprechende Projekte im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium eingekauft und über die eingespielte globale Marketingstruktur des Konzerns abgesetzt. 2007 machte Pfizer bereits 75 Prozent seines Umsatzes mit eingekauften und nicht selbst entwickelten Produkten. (18) Auch in dieser Hinsicht ist das Unternehmen also weniger ein Arzneientwickler als ein Finanzkonzern.
Bei der Konkurrenz ist der Anteil der eingekauften Produkte geringer, doch die Dynamik geht vom Marktführer aus. Wie auch die Tendenz, nur auf jene Krankheitsfelder mit Neuentwicklungen zu reagieren, die profitabel erscheinen. Zwar hat Pfizer vor einigen Jahren ein Mittel gegen Malaria entwickelt, eine Krankheit, an der immer noch jedes Jahr knapp 1 Million Menschen sterben – vor allem in Afrika. Doch die zuständige Finanzanalystin (die derzeit für BlackRock arbeitet) winkte ab: „Es ist wichtig für die Menschheit, aber für Pfizer als ein Unternehmen ist es nicht von Bedeutung.“ (19) Dazu sind die kranken Afrikaner eben einfach zu finanzschwach.
Von Bedeutung ist stattdessen Viagra, dass dem Konzern 2 Milliarden Dollar Umsatz bringt und damit ein echter „Blockbuster“ ist. Weiteren Schwung ins Geschäft bringen neue Krankheiten wie Vogel- und Schweinegrippe. Interessanterweise wurden Impfstoffe generell erst 2007 in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. (20) Zeitlich passend zum medial gepushten Auftauchen der neuen Grippeviren wird deren Bekämpfung nun zum Milliardengeschäft und hilft den Konzernen, drohende Umsatzverluste in anderen Sparten auszugleichen. GlaxoSmithKline brachte die Schweinegrippe 3 Milliarden Dollar, Sanofi-Aventis 700 Millionen, Novartis immerhin noch 500 Millionen. (21)
Dass solche Zusammenhänge nicht gerade zur Akzeptanz der Branche beitragen, ist auch Lobbyisten klar. Auf Europas größter Fachtagung für professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit referierte Verbandschefin Cornelia Yzer vor einiger Zeit deshalb zum Thema „Wie kontroverse Branchen ihre Imageprobleme lösen“ und empfahl eine „Proaktive Pressearbeit“. (22)
Auf deren Erfolg hofft sicher auch Andreas Penk, Deutschland-Chef von Pfizer, seit 2008 mit einem Büro direkt am Potsdamer Platz. Auch Konkurrent Sanofi-Aventis residiert hier, in unmittelbarer Nähe zu den Entscheidungsträgern. Penk hat große Pläne. Der Umsatz mit Krebsmedikamenten soll in den nächsten Jahren verzehnfacht werden. Etwa die Hälfte davon könnte Europa und damit auch Deutschland beisteuern, sagt er. (23) Die Zahlen geben ihm recht. Der Verkauf von Krebsmitteln wächst zweistellig, allein in Deutschland bringt die Krankheit den Herstellern über zwei Milliarden Euro ein. (24) Das ist krankes Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund Heft 1/2 – 2010.
Der Autor: Paul Schreyer, geb. 1977, lebt und arbeitet als Werbegrafiker und freier Journalist in Ahrenshoop an der Ostsee.