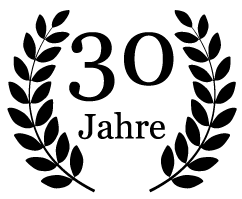Das neoliberale Entwicklungsmodell wird in der Finanzkrise geopfert, der Kapitalismus nicht
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von ELMAR ALTVATER, 11. November 2008:
Herbst 2008: nicht nur honorige Banken krachen zusammen, nicht nur riesige Vermögen verschwinden im Strudel der Entwertung und noch vor wenigen Wochen arrogante Manager kommen ziemlich kleinlaut daher. Als Müntefering im Wahlkampf in Nordrhein Westfalen 2005 von den „Heuschrecken“ sprach, war das originell; denn antikapitalistische Sprüche hatte man von der rechten SPD nicht erwartet. Bei Steinbrücks erschrockener Feststellung im Oktober 2008, dass an der Marx’schen Krisentheorie doch wohl einiges dran sei, hält sich die Aufregung in Grenzen, obwohl doch die öffentliche Hand in den Industrieländern diesseits und jenseits des Atlantik bereits an die 3000 Mrd. US Dollar in das marode globale Finanzsystem gepumpt hat, das erst in den letzten zwei Jahrzehnten zu den phallischen, alles überragenden und glitzernd blendenden Konzernzentralen in Manhattan, Mainhattan, London City und Dubai City hochgeschossen ist. Die plutokratischen Hochhäuser waren der Inbegriff und visuelles Symbol der privaten Macht gegen den Staat, des Marktes gegen öffentliche Interventionen, des Neoliberalismus gegen jede Form der gesellschaftlichen Regulation, des riesig-protzigen Reichtums gegen das bescheidene Mittelmaß.
Es ist daher kein Witz, wenn der venezolanische Präsident Hugo Chavez den US-Präsidenten George Bush, die unappetitliche Personifikation des Neoliberalismus, als „companero George“ tituliert, weil er in der Finanzkrise gezwungen war, die Immobilienfinanzierer Fanny Mae und Freddy Mac zu verstaatlichen. Tatsächlich, an der Marx’schen Theorie ist einiges dran. Offensichtlich steht das neoliberale Entwicklungsmodell zur Disposition. Kein Wunder, dass der Krach der Finanzmärkte mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus vor fast 20 Jahren verglichen wird.
Der finanzgetriebene Kapitalismus befindet sich an einer Zeitenwende? Die Krise der globalen Finanzmärkte war voraussehbar, denn das enorme Wachstum finanzieller Forderungen hat die Leistungsfähigkeit der „realen“ Ökonomie, in der die verteilbaren Werte produziert werden, weit hinter sich gelassen. Wie können Renditen von 20 und mehr Prozent auf Finanzanlagen auf Dauer gezahlt werden, wenn die realen Wachstumsraten bei weniger als 2 Prozent in den Industrieländern liegen? Die Substanz muss angezapft werden, und irgendwann ist diese aufgezehrt. Die Arbeitseinkommen lassen sich zwar absenken, aber spätestens bei Null ist die Grenze erreicht. Tatsächlich sind in den neoliberalen Jahrzehnten die Anteile der Lohn- und Gehaltseinkommen am Volkseinkommen überall in der Welt zusammengepresst worden. Nach Angaben des IWF (im World Economic Outlook vom April 2007 in einem speziellen Kapitel über die Globalisierung der Arbeit) in Kontinental-Europa von ca. 74% auf 63%, in den angelsächsischen Ländern von ca. 67% auf 62%, in den USA von ca. 64% auf 60% und in Japan von ca. 70% auf 58%. So konnte der Zufluss zum Finanzsektor über längere Zeit durch Umverteilung gesichert werden.
Doch eine stabile Dauerlösung war das nicht, und zwar nicht wegen des dann und wann, hier und dort aufflackernden Widerstands gegen die „Akkumulation durch Enteignung“, gegen die sich immer extremer zeigende Gesellschaftsspaltung in unanständig reiche Geldvermögensbesitzer einerseits und verzweifelt oder resigniert Arme andererseits. Auch ökonomisch war das Akkumulationsmodell der Ungleichheitsproduktion auf Sand gebaut. Zwei Ursachenkomplexe wirkten zusammen und zeigten dies in aller Deutlichkeit.
Zum einen flachten wirtschaftliche Wachstumsraten in den vergangen Jahrzehnten merklich ab, auch wenn vom „wissenschaftlichen Sachverstand“ und in jeder Regierungserklärung mehr und höheres, grünes und neues, dynamisches oder nachhaltiges Wachstum gefordert oder versprochen wurde. Doch selbst wenn die Versprechungen hätten verwirklicht werden können, hätten wir sofort ein anderes dickes Problem: Wachstum heute wird mit verstärktem Einsatz von fossilen Treibstoffen angekurbelt. Das Öl aber wird knapp und in der Tendenz teuer (auch wenn kurzfristig wegen der fallenden Nachfrage aufgrund der Finanzkrise die Ölpreise abrutschen), und eine Zunahme der Treibhausgasemissionen dürfen wir uns erst recht nicht leisten, wenn wir den Klimakollaps noch vermeiden wollen. Wenn man mit Wachstum also den Teufel der Finanzkrise auszutreiben versucht, wirft man sich nur dem Beelzebub von Energie- und Klimakrise in die Arme. Das tun derzeit die europäischen Wirtschaftsminister und setzen die Zukunft kommender Generationen aufs Spiel, ohne ihr Ziel der Steigerung der Wachstumsrate wirklich erreichen zu können. Sie müssten dies auch gar nicht, da das erreichte Wohlstandsniveau bei gleichmäßigerer Verteilung allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Leben ermöglichen könnte. Doch davon lassen sich Renditen nicht beeindrucken. Sie müssen monetär ausbezahlt werden, und da sie sich nur quantitativ bemessen, zählen nur die quantitativen Unterschiede: So kommen die absurden Wettläufe zustande. Wer 20% Rendite schafft, zählte schon zu den Loosern, weil andere 40% und mehr erreichten. Auf den Wettlauf um die Prozente lassen sich die Henkels und Ackermänner mit asozialer Rücksichtslosigkeit und ungebremster Gier ein, dabei sind sie armselige, getriebene Charaktermasken oder auch Finanzwürstchen, die eine wichtige Funktion wahrgenommen haben. Sie haben mit dafür gesorgt, dass, obwohl das Wachstum nicht reicht, die Renditen auf Finanztitel nach oben konkurriert worden sind.
Im Kapitalismus, ob neoliberal oder nicht, vollzieht das Kapital ständig einen Kreislauf aus der Form des Geldkapitals in die des produktiven und des Warenkapitals, um vermehrt um einen Zuwachs, um einen Mehrwert wieder zu vermehrtem Geldkapital zu werden. Wegen dieses Kreislaufcharakters ist es unmöglich, von der „realen“ und der „finanziellen“ Ökonomie abzusehen. Es ist aber ebenfalls unmöglich, ihren höchst widersprüchlichen Zusammenhang zu übersehen.
Jeder Fonds und jeder Finanzplatz versprachen im globalen Schönheitswettbewerb der Standorte höhere Zinsen und Renditen als die Konkurrenz. Denn man muss den Reichen in aller Welt einiges dafür bieten, dass sie ihre Geldvermögen anlegen, mit denen dann Fonds und Banken Geschäfte machen können. Es blühte das spekulative Geschäft mit verbrieften Forderungen. Die sogenannte „Finanzindustrie“ (als ob in Banken und Fonds irgendetwas produziert würde) entwickelte immer neue und höchst vertrackte Innovationen, alle darauf ausgelegt, die Rendite auf Finanzanlagen zu steigern. Die Banken hörten auf, biedere Mittler zwischen Sparern, die Geld hatten, und Investoren, die welches brauchten, zu sein und an Differenzen zwischen Soll- und Habenzinsen sowie Gebühren zu verdienen. Mit solch biederen Geschäften kann man keine 20- und mehrprozentigen Renditen einfahren. Da braucht man ein anderes Geschäftsmodell.
Wie kann man die Eigenkapitalrendite anheben? Indem man Fremdkapital zu niedrigen Zinsen aufnimmt und den Ertrag von Eigen- plus Fremdkapital nur auf das Eigenkapital bezieht. Das ist die Hebelwirkung, der „leverage-Effekt“, der die von einem Fonds oder einer Investmentbank bewegten Kapitalsummen um ein Vielfaches, manchmal um das Hundertfache des eigenen Kapitals aufblähte. Voraussetzungen sind niedrige Refinanzierungszinsen. In den USA hat die Fed nach dem Platzen der New Economy Blase den Finanzinvestoren niedrige Zinsen geboten: 1% und weniger. Mit so billigem Geld ließen sich global ausgreifende Geschäfte finanzieren, je mehr umso profitabler, zumal wenig Eigenkapital eingesetzt werden musste. Risikoreiche Papiere wurden unter das Publikum gebracht mit der Versicherung, dass die Risiken gestreut und für die einzelnen somit beschränkt würden. Das war reiner Zynismus, denn am Schluss wusste niemand mehr, welche Risiken in welchen Papieren eigentlich versteckt waren. Nicht Risiken wurden gestreut, sondern das Wissen darum verdrängt und verschleiert. Rating agencies haben dabei aktiv mitgewirkt und ihre öffentliche Aufgabe des Profits wegen schlicht verraten. Diese Papiere wurden dann, als der Risikofall massenhaft eintrat und die Finanz- und Bankenkrise ihre eigene destruktive Dynamik entfaltete, als „giftig“ bezeichnet. Wer giftige Lebensmittel unter die Leute bringt, wird bestraft. Wer auf deregulierten Finanzmärkten „toxic papers“ konstruiert und verkauft, gilt als ein besonders cleverer Held der Branche, bekommt Prämien und wird bewundert.
Die Erträge auf Finanzprodukte sinken in der Krise und ihr Wert löst sich manchmal in Nichts auf. Wegen der Hebelwirkung und der vielen windigen Innovationen übersteigt nun die Wertsenkung das Eigenkapital. Banken, Fonds, Versicherungen in einer solchen Lage müssten ein Schild „wegen Pleite geschlossen“ an die Tür hängen. Statt dessen rufen selbst die marktwirtschaftlichen Hardliner unter den Bank-Plutokraten verzweifelt nach dem Staat. Sie benötigen dringend frisches Geld, das sich Banken untereinander nicht mehr leihen, da sie wissen, dass alle Institute der Branche noch irgendwelche Leichen, d.h. wertlose und noch nicht abgeschriebene Papiere im Keller haben. Wer will sich schon von den Kollegen der „banking community“ mit „toxischen Papieren“ vergiften lassen?
In dieser Lage kommt die öffentliche Hand mit viel Pinke, Pinke ins Spiel der Bankrotteure und schützt deren Kapital. In den USA mit 700 Mrd. US-Dollar. Da lässt sich Europa nicht lumpen. Nach dem Absturz der Börsenkurse am schwarzen Freitag, 10. Oktober 2008, war koordiniertes Vorgehen gefragt, und zwar ganz schnell. So knauserig wie sie bei Hartz IV-Empfängern auf den Eurocent achten, so weltmännisch ließen die europäischen Regierungen es auf ein paar hundert Milliarden nicht ankommen.
Die Euro-Infusion ins Bankensystem wird als alternativlos bezeichnet. Vielleicht ist das richtig. Aber richtig ist auch, dass erst die Liberalisierung der Finanzmärkte und die Zulassung hochspekulativer Fonds und ihrer Praktiken durch die letzten Bundesregierungen dieses Desaster möglich gemacht haben. Auch die Trennung der Vermögen, mit denen Gewinne eingefahren werden, von den damit verbundenen Risiken, die nun der öffentlichen Hand aufgebürdet werden, weil aus den Gewinnen keine Rücklagen gebildet werden mussten, hat ihren Beitrag zu dem Finanzdesaster geleistet.
Wenn schon Stützung der Banken aus den Einkommen der Bürger, dann sollte das Bankensystem auch nationalisiert werden, um „moral hazard“, d.h. die Nutzung der Finanzspritze zur Fortsetzung der alten Geschäfte, zu verhindern und gleichzeitig das Bankensystem wieder auf seine Funktion für die reale Ökonomie zurückzuführen. Wer braucht spekulierende Banken und Fonds, die an den Weltbörsen wetten, so lange der Jackpot noch etwas hergibt und den Staat rufen, wenn existenzielle Verluste drohen? Gerade weil die Finanzkrise wegen des Kreislaufcharakters der Kapitalbewegungen gravierende Auswirkungen auf die reale Ökonomie hat, muss diese durch entsprechende Regulation geschützt werden und nicht die Welt der Spekulanten. Das wäre die wichtigste Lehre aus der Finanzkrise.
Einzelne Maßnahmen einer Reform des Finanzsystems sind schon oft benannt worden, und der nachfolgende Katalog ist nicht vollständig (zum Teil findet man ihn im Bericht der 1999 eingesetzten Kommission des Deutschen Bundestages „Globalisierung der Weltwirtschaft“, der aber sehr schnell ins „Gedächtnisloch“ gefegt wurde): die Verteuerung der spekulativen Transfers durch eine Devisentransaktions- und Börsenumsatzsteuer, das Verbot von Wetten auf den Finanzmärkten zu Lasten Dritter, z.B. das inzwischen ausgesprochene Verbot von Leerverkäufen, mit denen überhaupt kein Wert geschaffen sondern Nullsummen-, manchmal Negativsummenspiele gespielt werden. Notwendig ist auch eine wirksame Diskriminierung von Offshore Finanzzentren, um deren Attraktivität für Steuervermeidung und illegale Geschäfte zu verringern. Die verbreitete Rekapitalisierung der Banken muss eine Verstaatlichung nach sich ziehen. Denn wenn der Staat viel Geld in Banken und andere Institutionen pumpt, muss damit auch Einfluss auf die Geschäftspolitik genommen werden können. Auf den Devisenmärkten müssten Zielzonen für Wechselkurse festgelegt werden, um Arbitragegeschäfte von Währungsspekulanten zu unterbinden. Die Aufsicht über Finanzmärkte müsste wirksamer werden und das Rating gehört auf jeden Fall in die öffentliche Hand und muss daher den privaten rating agencies entzogen werden.
Es geht nun darum, das Finanzsystem auf das Maß der realen Ökonomie zu bringen, also es nicht nur zu rekapitalisieren, sondern in der Größenordnung und in der Art der Geschäfte zu redimensionieren. Das ist etwas anderes als eine „Rückkehr zum Keynesianismus“, wie manche Kritiker beispielsweise Attac unterstellen, zumeist ohne sich mit den differenzierten Positionen wirklich auseinander zu setzen. Die Finanzkrise sollte deutlich gemacht haben, dass der Finanzsektor keine Werte schafft, sondern von der Wertproduktion der „realen Ökonomie“ abhängig bleibt. Also müssen die Regeln für den Finanzsektor so gesetzt werden, dass die reale Ökonomie gefördert und nicht ausgeplündert wird, noch dazu mit staatlicher Hilfestellung. Der Finanzsektor muss die Risiken tragen, die durch seine Geschäfte erzeugt werden. Wäre dem so, wäre mit so manchen hoch riskanten und daher hoch rentierlichen Geschäften kein Geld zu verdienen. Dies ist den Finanzmanagern ja nur möglich gewesen, weil sie die Risiken ihrer einträglichen Geschäfte abwälzen durften. Die Verselbständigung des Finanzsektors hat es möglich gemacht, zeitweise Geschäfte zu tätigen, so als ob die damit erzielten Renditen aus dem Hut gezaubert werden könnten und nicht erarbeitet werden müssten.
Wir sollten aber, dies ist deutlich geworden, nicht meinen, die Krise des Kapitalismus beschränke sich auf den globalen Finanzsektor, und wenn der wieder mit staatlicher Hilfe Renditen bringt, sei die Welt wieder in Ordnung. Das wird sie erst sein, wenn auch Lösungen für die Energie-, die Klima- und Nahrungskrise gefunden sind. Mit dem neoliberalen Entwicklungsmodell wird dies nicht gelingen, mit irgendeinem Neo-Keynesianismus aber auch nicht. Die Frage der nächsten Zukunft wird daher lauten, ob mit dem Neoliberalismus auch der Kapitalismus geschwächt wird und an Grenzen stößt, oder ob die kapitalistischen Klassen ihre hegemoniale Position mit der Art und Weise der Krisenüberwindung zu stärken in der Lage sind. Die Antwort auf diese Frage hängt sehr von der Krisenanalyse und von der Entwicklung von Konzepten der Krisenüberwindung ab.
Der Autor:
Elmar Altvater ist Prof. emer. für Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der FU-Berlin. Prof. Altvater war Mitglied der Enquête-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten (1999-2002) des Deutschen Bundestages. Heute ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von attac. 2007 – wenige Tage vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm – trat Altvater der Linken bei. Er will „über den Kapitalismus hinaus“ denken und Alternativen zu ihm entwickeln.