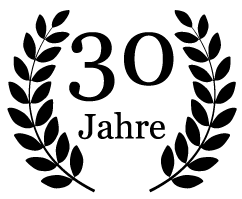Ausverkauf von Bahn, Post und Telekom
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Die kapitalmarktorientierte Neuvermessung der Staatsunternehmen zu Lasten von Kunden und Beschäftigten –
Von TIM ENGARTNER, 25. April 2009 –
Ob Bahn, Post oder Telekom – bei allen drei Konzernen jagt ein Skandal den anderen. Bei der Deutschen Bahn AG, dem letzten großen deutschen Staatskonzern, richtete sich das Medieninteresse zuletzt auf gebrochene ICE-Achsen, ausgespähte Mitarbeiter/innen und den heftig diskutierten „Bedienzuschlag“, während Positivmeldungen über steigende Verkehrsmarktanteile des Verkehrsträgers Schiene noch immer auf sich warten lassen. Auch das magentafarbene „T“ der Deutschen Telekom AG strahlt nach aufgedecktem Datenmissbrauch und fortgeschriebenem Stellenabbau nicht mehr allzu hell. Und beim zweiten Bonner Großkonzern, der Deutschen Post AG, wirft neben der Steuerhinterziehung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Klaus Zumwinkel insbesondere dessen rigorose Expansionspolitik lange Schatten.
Wird die chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte, die Internationalisierung der Handels- und Finanzmärkte, der tatsächlich vorhandene Reformdruck in der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und das Fehlen alternativer Reformvorschläge weiter dazu genutzt werden, den öffentlichen Sektor nach privatwirtschaftlicher Logik zu (re)strukturieren? Oder fallen den Privatisierungsverfechtern ihre Gesellenstücke auf die Füße zurück? Welche Folgen hat die „Selbstentmachtung des Staates“ für Kunden und Beschäftigte als unmittelbar Betroffene?
Von 1982 bis heute sank die Zahl der unmittelbaren und mittelbaren staatlichen Beteiligungen auf Bundesebene von 985 auf unter 100. Mehr als die Hälfte dieser Privatisierungen wurden nach 1999 durchgeführt, was erkennen lässt, dass die Reduzierung staatlicher Steuerungsansprüche als zentrales Leitmotiv neoliberaler Politikkonzeptionen von der vorgeblich auf den „aktivierenden Staat“ setzenden rot-grünen Regierungskoalition mit besonderem Nachdruck umgesetzt wurde. Seit Beginn der 80er-Jahre wurden so bedeutsame bundeseigene Unternehmen wie die VEBA-Gruppe (die nun unter E.ON firmiert), die als Dachgesellschaft für Industriebeteiligungen des Deutschen Reiches gegründete VIAG, die Immobiliengesellschaft IVG, die Deutsche Lufthansa, die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS), die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL), die im Maschinen- und Anlagenbau tätige Deutsche Industrieanlagen AG (DIAG) sowie die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahn (nunmehr Tank und Rast GmbH) materiell privatisiert.
Von besonderem Interesse aber sind die Folgen der Privatisierungen, die sich bei der Deutschen Bundespost – aus der Deutsche Post AG und Deutsche Telekom AG hervorgegangen sind – und bei der Deutschen Bundesbahn ergeben haben, denn sowohl das Verkehrs- als auch das Post- und Fernmeldewesen standen bis zu Beginn der 90er-Jahre vollständig in staatlichem Eigentum. Edgar Grande und Burkard Eberlein nehmen in ihrer Untersuchung „Der Aufstieg des Regulierungsstaates im Infrastrukturbereich“ (1) gar an, dass „der Leistungsstaat im Infrastrukturbereich seinen letzten und größten Triumph“ erlebte. Letztlich erfuhr die Bundesrepublik im Telekommunikationssektor den „letzten Kraftakt des Staatsmonopols“, als die damalige Bundespost unmittelbar nach der Vereinigung ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von 55 Mrd. DM auflegte, um auf dem ehemaligen Gebiet der DDR eines der weltweit leistungsfähigsten Telekommunikationsnetze zu errichten. (2)
„Die Farbe Gelb geht um die Welt“
Schon die Konzernzentrale hat nichts mehr mit der einstigen Bundespost gemein. Bis auf knapp 163 Meter Höhe schraubt sich der von Helmut Jahn entworfene Glasbau in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bundesministeriums für Post und Telekommunikation in die Höhe. Der höchste Büroturm der Bundesrepublik außerhalb von Frankfurt am Main setzt aber nicht nur architektonisch neue Maßstäbe, sondern symbolisiert zugleich den fundamentalen Wandel eines der DAX-Schwergewichte: der Deutschen Post AG. Klaus Zumwinkel, der bis zu seinem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Amt im Februar 2008 mehr als 18 Jahre lang die Geschicke der Deutschen Post AG geleitet hatte, hat es zweifellos geschafft, aus einer in nationalen Grenzen operierenden Behörde einen Global Player zu schmieden: die „Deutsche Post World Net“, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland erzielt.
Bereits im Sommer 1998 hatte Zumwinkel verkündet: „Die Sanierung der Deutschen Post ist geschafft.“ Und nur ein Jahr später konnte er auf eine eindrucksvolle Bilanz verweisen: Der Umsatz war mit 22,4 Mrd. Euro doppelt so hoch wie 1990, der Gewinn nach Steuern belief sich auf 1,1 Mrd. Euro und die Eigenkapitalrendite (vor Steuern) lag bei stattlichen 36 Prozent. Es war Thomas Gottschalk und seinem Bruder Christoph vorbehalten, die „Aktie Gelb“ unmittelbar vor dem Börsenstart ins rechte Licht zu rücken. Am ersten Handelstag, dem 20. November 2000, werden 29 Prozent des Unternehmens in Gestalt von 320 Mio. Aktien im Wert von 6,6 Mrd. Euro an die Börse gebracht. (3) Mittlerweile hält „Vater Staat“ nur noch ein Drittel der Aktien über die KfW.
Den Startschuss in Richtung internationale Logistikdienstleistungen gab der Zukauf der Schweizer Spedition Danzas im Jahre 1999. Um auf dem äußerst kompetitiven US-amerikanischen Markt Fuß fassen zu können, kaufte die Deutsche Post AG nur drei Jahre später das dort ansässige, nach seinen Gründern Adrian Dalsey („D“), Larry Hillblom („H“) und Robert Lynn („L“) benannte Speditionsunternehmen DHL, unter dessen Dach heute sämtliche Logistikdienstleistungen des Unternehmens gebündelt sind. Es folgten die Übernahme des US-amerikanischen Logistikunternehmens Airborne Express und des britischen Anbieters Exel sowie zahlreiche Zukäufe im benachbarten Ausland. Wie im Fall der Deutschen Bahn AG brachte die Orientierung in Richtung internationaler Geschäftstätigkeiten eine Vernachlässigung des Heimatmarktes mit sich: Demontierte Briefkästen, geschlossene Postämter und gestiegene Verlustquoten bei Brief- und Paketsendungen legen Zeugnis ab von dieser globalen Expansionsstrategie.
Schwindendes Interesse am Privatkundengeschäft
Mehr als 80 Prozent des Umsatzes im Briefgeschäft entfallen inzwischen auf Großkunden, weshalb der einstige Monopolist immer weniger Interesse am Privatkundengeschäft zeigt. Gab es 1990 noch 22.000 Filialen und Postämter, sind es mittlerweile – gemeinsam mit den Partneragenturen – nur noch 13.500 Filialen im gesamten Bundesgebiet. Die Zahl liegt nur knapp oberhalb der Mindestgrenze, die von der Regulierungsbehörde der Post mit 12.000 Filialen vorgegeben ist. Die etwa 750 Filialen, die mit den „klassischen Postämtern“ vergleichbar sind und sich somit auch noch im unmittelbaren Besitz der Deutschen Post AG befinden, sollen nun ebenfalls bis 2011 in die Hände von Partnerfilialen im Einzelhandel übergehen bzw. abgestoßen werden.
Ohnehin zeichnet sich für Privatkunden ein Trend in Richtung „Do-it-yourself“ ab. Bis zum Jahresende sollen bundesweit ca. 2500 voll automatisierte Packstationen eingerichtet sein. In Bonn und Berlin betreibt die DP AG bereits sog. 7/24-Postinseln, die den Kunden sieben Tage die Woche rund um die Uhr fast alle Postdienstleitungen anbieten – gleichwohl ohne jede Beratung durch einen Postangestellten. Offenbar geht die Post davon aus, dass ihre gesamte Kundschaft mit der modernen Technik vertraut, in guter körperlicher Verfassung und geradezu grenzenlos mobil ist. Seinem ursprünglichen Auftrag, eine flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen vorzuhalten, kommt das Unternehmen nur noch bedingt nach. So steht der Privatkunde heute tendenziell schlechter da als noch vor der Privatisierung, muss er doch immer mehr Leistungen selbst erbringen – und für diese Eigenleistungen auch noch mehr zahlen als für die einst vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen.
Arbeitsplatzabbau
Durch die Privatisierung von öffentlichen Unternehmen sind seit Anfang der 1990er Jahre in der Bundesrepublik mindestens 600.000 Arbeitsplätze verloren gegangen – insgesamt wurden damit wohl mehr Jobs gestrichen als geschaffen. Alleine die Deutsche Post hat im Zeitraum von 1989 bis 1998 rund 139.000 Stellen gestrichen und laut Berechnungen der Bundesnetzagentur seit 1999 nochmals 34.000 weitere Arbeitsplätze abgebaut. (4) Bei der privaten Konkurrenz sind im gleichen Zeitraum nur etwa 46.000 neue Stellen entstanden, die in der Regel schlechter bezahlt und daher mit den gestrichenen Poststellen nicht zu vergleichen sind: „Mehr Wettbewerb hat nicht zu mehr Beschäftigung geführt, sondern zu Beschäftigungsabbau“, sagt der am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung beschäftigte Liberalisierungsexperte Thorsten Brandt.
Zahlreiche Vollzeitverträge im Bereich Trennung, Vorbereitung, Zustellung sind in den vergangenen Jahren durch Teilzeitverträge ersetzt worden, nicht selten lösten 400-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ab. Während sich der Post-Vorstand über rasant steigende Bezüge freuen durfte und allein sein Sprecher Zumwinkel zuletzt rund acht Mio. Euro pro Jahr kassierte, wurden immer mehr Leiharbeits- und Saisonkräfte eingestellt oder Teilbereiche ausgelagert, um Personalkosten zu sparen. Beim Filialbetrieb AG 200 werden geringfügig Beschäftigte als unterstützende Mitarbeiter am Schalter eingestellt.
Diese Entwicklung trübt den Blick auf den Mindestlohn, auf den sich die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di mit dem Arbeitgeberverband AGV Postdienste im Sommer 2007 einigen konnte: 9,80 Euro werden nun pro Stunde für Briefzusteller im Westen und 9,- Euro für deren Kollegen im Osten gezahlt. Auch alle anderen im Postsektor Beschäftigten erhalten nun einen Mindestlohn – von 8,40 Euro bzw. 8,- Euro pro Stunde. Zu lange hatten die mit Liberalisierung des Briefmarktes entstandenen privaten Postunternehmen wie die PIN AG Group und TNT ihre tarifliche Unabhängigkeit zu einem regelrechten Lohndumping genutzt: um bis zu 60 Prozent lag das Lohnniveau dort unter dem der Deutschen Post.
Von der Fernmeldebehörde zum Global Player
Auch die Entwicklung des zweiten aus der Bundepost hervorgegangenen Unternehmens gibt keinen Anlass zur Freude. „Jobs streichen, Jobs kappen. Die Telekom findet kein Ende.“ So titelte die Stuttgarter Zeitung am 1. Oktober 2005 – und so hätte sie seither ein halbes Dutzend weitere Male titeln können. Lothar Schröder, Bereichsleiter Technologie- und Innovationspolitik bei Ver.di, fasst die Zahlen zusammen: Von 1994 bis 2007 baute die Deutsche Telekom im Inland rund 77.000 Arbeitsplätze ab, was der Hälfte aller Stellen entspricht. Dass sich der neoliberale Mythos von im Wettbewerb neu entstehenden Arbeitsplätzen nicht mit den Realitäten in Einklang bringen lässt, belegt die Tatsache, dass die Wettbewerber bis 2007 lediglich 14.000 neue Stellen schufen – die Arbeitsplatzbilanz somit auch hier im sektoralen Saldo negativ ist. (5)
Dabei wurde der Schritt in Richtung Marktfreiheit zunächst auch von der überwältigenden Mehrheit der Beschäftigten euphorisch begrüßt. Sie zählten gemeinsam mit Hunderttausend „Neu-Börsianern“ zu denjenigen, die die immense Nachfrage nach der T-Aktie bei allen drei Börsengängen auslösten und das Papier in die Höhe schnellen ließen: Ausgehend vom Eröffnungskurs, der am 18. November 1996 bei 14,57 Euro lag, kletterte die Aktie bis zu ihrem historischen Höchststand von 103,50 Euro am 6. März 2000. Danach stürzte das Papier ins Bodenlose und notierte am 30. September 2002 auf einem „Allzeittief“ von 8,42 Euro, um in den Folgejahren wieder ein wenig Luft nach oben zu nutzen, während die Luft für die Beschäftigten immer dünner wurde.
Schon 2003 beschlich immer mehr Telekom-Mitarbeiter ein ungutes Gefühl, als der Konzernvorstand eine Personal-Service-Agentur namens „Vivento“ aus der Taufe hob, hinter der sich ein einzigartiges Konzept verbirgt: Telekom-Mitarbeiter bauen sich selbst ab – bei vollem Gehalt und mit der Aussicht auf einen Dauer-Arbeitsplatz. Die „klassischen“ Instrumente wie Abfindungen, Vorruhestandsregelungen und die Nichtbesetzung offener Stellen hatten nicht mehr ausgereicht, um die angestrebte Eigenkapitalrendite zu erreichen. Inzwischen gibt es einige Töchter, darunter die Vivento Customer Services GmbH & Co. KG, hinter der sich das ehemalige Call-Center von T-Com verbirgt. Auch die Montagegesellschaft, die bspw. Mobilfunkantennen installiert, wurde auf diese Art „outgesourct“. Mit dem Ziel, die Personalkosten zu reduzieren, gliederte der Bonner Telekommunikationskonzern im Jahr 2007 weitere 55.000 Beschäftigte in Servicegesellschaften aus. Gingen diese ihrer Tätigkeit in den Bereichen „Kundendienst“ und „Call-Center“ zuvor 34,5 Stunden pro Woche nach, müssen sie mittlerweile jede Woche rund vier Stunden länger arbeiten, um am Monatsende den gleichen Betrag auf ihrem Gehaltskonto verbuchen zu können.
Dass sich die Arbeitsbedingungen seit der Privatisierung verschlechtert haben, konnte auch die Gewerkschaft ver.di nicht verhindern. So musste sie einer 6,5-prozentigen Lohnsenkung, Pausenkürzungen und einer vierstündigen Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich zustimmen – zu groß war der Druck der Investoren, unter denen sich bei Deutschlands größtem Telekommunikationskonzern der vielfach als „Heuschrecke“ titulierte Großaktionär Blackstone befindet. Auch künftig wird es für die Belegschaft wohl eher darum gehen, den Grad der Verschlechterung und nicht den Grad der Verbesserung zu erkämpfen.
„Kränkelnder Dinosaurier im Schuldenmeer“
Welche sozial-, umwelt-, und finanzpolitischen Risiken mit der Kapitalmarktorientierung eines Unternehmens einhergehen können, illustriert auch das Beispiel der Deutschen Bahn AG. Als „kränkelnder Dinosaurier im Schuldenmeer“ und „Sprengsatz des Bundeshaushalts“ wurde die einstige „Behördenbahn“ Bundesbahn in den letzten Jahren ihres Bestehens diskreditiert. Seinen konkreten Ausdruck fand der neoliberale „Sinneswandel“ darin, dass die Neuformulierung des Art. 87 GG sowie die mehr als 130 für die Umsetzung der Bahnreform erforderlichen Gesetzesänderungen im Dezember 1993 eine breite parlamentarische Mehrheit fanden: Mit 558 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen und nur vier Enthaltungen gab der Bundestag den Weg für die „Jahrhundertentscheidung der Verkehrspolitik“ frei. Sieht man von der lediglich in Gruppenstärke vertretenen PDS/Linke Liste ab, zogen sich alle Fraktionen auf die von den FDP-Abgeordneten vorgetragene Position zurück: „Es ist eine staatliche Aufgabe, für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zu sorgen. Aber es ist keine originär staatliche Aufgabe, den Transport von Menschen oder Gütern selbst in die Hand zu nehmen. Der Staat ist nun einmal ein miserabler Fahrkartenverkäufer.“ (6)
Mit der Zeit stimmten die etablierten Parteien in das von Heinz Dürr, Johannes Ludewig und Hartmut Mehdorn dirigierte Crescendo des Bahnvorstandes ein, den ehemals größten Arbeitgeber der Bundesrepublik von „den Fesseln des öffentlichen Dienst- und Haushaltsrechts“ (7) zu befreien und das Unternehmen mittelfristig dorthin zu führen, wo die Marktmechanismen am wirkungs- und oftmals verhängnisvollsten greifen: auf das Börsenparkett. Selbst die rot-grüne Bundesregierung, die im September 1998 angetreten war, das Land „ökologisch und sozial zu erneuern“, folgte während ihrer siebenjährigen Amtszeit im Bereich der Bahnpolitik – ebenso wie in anderen Bereichen staatlicher Wirtschaftstätigkeit – konsequent dem neoliberalen Credo des „schlanken Staates“. Die Grundlage nahezu sämtlicher Diskussionen über die Ausgestaltung der Privatisierung bildete die Überzeugung, dass sich die DB AG an der von betriebswirtschaftlichem Kalkül dominierten Erwartungshaltung des Kapitalmarktes orientieren müsse, um verkehrlich und wirtschaftlich erfolgreich operieren zu können.
Umfassender Personalabbau
Binnen 18 Jahren baute die DB mehr als die Hälfte ihrer Stellen ab: Die Zahl der Beschäftigten sank von 482.000 (1990) auf 234.000 (2008). Dabei wurde insbesondere zu Anfang überwiegend vom Instrument der Frühpensionierung Gebrauch gemacht, sodass ein Großteil des Kostendrucks im Personalbereich zulasten der sozialen Sicherungssysteme externalisiert wurde. Der Beamtenstatus wurde für Neueinstellungen aufgehoben; unter Verweis auf die Notwendigkeit einer an Marktgesichtspunkten ausgerichteten Personalführung blieb nicht nur für Kuriositäten wie das Ballettensemble der Deutschen Reichsbahn kein Raum mehr.
Der Beschäftigungsabbau bei der Deutschen Bahn läutete insbesondere eine Abkehr vom Kundenservice ein. Mittelfristig ist nur noch für 83 Bahnhöfe der „Kategorien 1 und 2“ ein sog. „personenbedienter Service“ vorgesehen. Dabei werden (potenzielle) Kunden schon jetzt verprellt, weil ihrem Beratungsbedarf mit wenig benutzerfreundlichen Fahrkartenautomaten, komplexen Internet-Buchungsplattformen und kostspieligen Telefon-Hotlines nicht entsprochen wird. Auch der Vertrieb von Fahrscheinen über Lidl, McDonald’s und Tchibo kann den Schalterverkauf nicht ersetzen – zumal diese Vertriebswege bislang nur je einmal im Rahmen von Sonderaktionen genutzt wurden. Zugleich unterließ der DB-Konzern allein zwischen 2001 und 2005 Reparaturen im Umfang von 1,5 Mrd. Euro am Schienennetz, dem Herzstück jedes Bahnbetriebs. Nach einem Bericht des Bundesrechnungshofs, der am 20. Februar 2007 an die Öffentlichkeit gelangte, waren zahlreiche Verspätungen nach dem Orkan „Kyrill“ auf durch unzureichende Vegetationsrückschnitte verursachte Defekte bei Signal- und Sicherungsanlagen zurückzuführen.
Unverändert bemüht sich der ehemals größte Arbeitgeber der Bundesrepublik in stillschweigendem Einvernehmen mit dem Bund als alleinigem Noch-Eigentümer, die Eigenkapitalrendite über einen Abbau ihres Anlagevermögens zu steigern. Dies wird nicht nur an unzähligen Gleiskörpern sichtbar, die nach ihrer Freistellung von Bahnbetriebszwecken durch das Eisenbahnbundesamt brachliegen. Auch der von Hartmut Mehdorn forcierte Verkauf von Bahnhofsgebäuden lässt erkennen, wie nachhaltig die „Verbetriebswirtschaftlichung“ im „Unternehmen Zukunft“ (Eigenwerbung) Platz gegriffen hat. Nach einem Mitte Februar 2007 bekannt gewordenen Geschäftsplan sollen mittel- bis langfristig drei Viertel der noch verbliebenen 2.400 Stationen mit Empfangsgebäude geschlossen und/oder verkauft werden. Allein von den 308 bayerischen Bahnhofsgebäuden will die Deutsche Bahn 210 verkaufen; in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollen nur 39 Stationen inklusive Bahnhofshallen im Eigentum des Konzerns verbleiben. (8) An den übrigen Haltepunkten müssen Bahnsteige, Fahrkarten¬auto¬maten und Wartehäuschen ausreichen. Die flächendeckend sichtbar werdende Aufgabe von Bahnhofsgebäuden ist als Beleg für die „kapitalmarktbedingte“ Kurzsichtigkeit des DB-Managements zu werten, stehen den schnellen Verkaufserlösen doch bei einer Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs langfristige Mietzahlungen gegenüber.
Während die Deutsche Bahn AG Schienenstränge und Bahnhöfe in ländlichen Regionen sukzessive aufgibt, baut sie den Hochgeschwindigkeitsverkehr aus. Mittelfristig soll der Anteil der ICE-Züge an der Gesamtflotte nach Unternehmensangaben bei zwei Dritteln liegen, wobei die Ausweitung der Ersten Klasse ebenso beschlossen ist wie der Neu- und Ausbau weiterer Hochgeschwindigkeitsstrecken. An kostspieligen Prestigeprojekten wie der ICE-Neubaustrecke Nürnberg – Halle – Erfurt, die 2015 im Rahmen des Verkehrsprojekts „Deutsche Einheit“ fertiggestellt sein soll, wird unverändert festgehalten, was die salopp formulierte Einschätzung Winfried Wolfs, Sprecher des Expertenkreises „Bürgerbahn statt Börsenbahn“ stützt: „Die neuen Götter des Bahnmanagements sind die Geschäftsreisenden, die Laptopper, die Handymen, die First-Lounge-User und die City-Hopper.“ (9)
Dabei war die Orientierung auf das Hochpreissegment in der Vergangenheit nicht von Erfolg gekrönt, wie das Beispiel des ehemals zwischen Hamburg und Köln verkehrenden Schnellzugs „Metropolitan“ zeigt. Der mit dem Slogan „Willkommen auf der Erfolgsschiene“ beworbene Zug, dessen Innenausstattung mit edlen Ledersitzen, Handläufen aus gebürstetem Edelstahl und einer Cocktailbar überwiegend auf solvente Geschäftsreisende abzielte, konnte mangels Nachfrage nicht wirtschaftlich betrieben werden. Seine Einstellung mit dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember 2004 war die Konsequenz. Langfristig ist auch nach den von der Deutsche Bahn in Auftrag gegebenen Studien maximal ein stagnierendes, wahrscheinlich sogar eher ein rückläufiges Fahrgastaufkommen im Fernverkehr zu erwarten. (10) Insofern sprechen neben sozialstaatlichen auch betriebswirtschaftliche Erwägungen dafür, eine „Flächenbahn“ zu installieren, „die das schnelle Reisen für alle (demokratisiert), statt es für eine kleine Elite zu monopolisieren“, wie Heiner Monheim, Professor für Geographie an der Universität Trier zu verstehen gibt. Die dezentrale, polyzentrische Siedlungsstruktur der Bundesrepublik verlange nach einem flächendeckenden Bahnangebot mit einem „Maschennetz“ aus vielen Strecken und Knoten, um möglichst viele Fische am Verkehrsmarkt zu fangen. Indem sich das Schienenverkehrsangebot auf dicht besiedelte Gebiete mit einer hohen Verkehrsintensität konzentriert, wird den Verkehrsbedürfnissen der Allgemeinheit nicht mehr Rechnung getragen, obwohl dies in Art. 87e Abs. 4 GG verfassungsrechtlich verbrieft ist.
Ende der Privatisierungseuphorie
Die Beispiele der drei ehemals staatlichen und nun – formell bzw. materiell privatisierten – Unternehmen zeigen, dass viele Rechnungen, die lediglich den unternehmerischen Erfolg ins Auge fassen, zu kurz greifen, weil weitaus gewichtigere volkswirtschaftliche Flurschäden nicht erfasst, geschweige denn diskutiert werden. So steht bspw. die Deutsche Telekom AG mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Kapitalprivatisierung bezüglich der in der Konzernbilanz ausgewiesenen Größen keinesfalls schlechter dar als vor der Veräußerung an Privatinvestoren. Aber: Während wir als Kunden der Deutschen Telekom AG und konkurrierender Anbieter infolge der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes von insgesamt gesunkenen Tarifen profitieren, zahlen wir über Steuern und Sozialversicherungsabgaben für den Stellenabbau, die Pensionslasten und die Ausgründung der Beschäftigten in Personalserviceagenturen wie Vivento.
Es bleibt abzuwarten, ob sich das Märchen vom Segen der Privatisierung als zentralem Hebel neoliberaler Politik weiter wie ein endloses Spruchband durch Talkshows, Unternehmensverbandskonferenzen, Parteitage und Regierungserklärungen zieht. In jedem Fall sollten wir die „Pathologien politischer Steuerung“, nicht länger überzeichnen, wie der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Fritz Scharpf, immer wieder betonte, und stattdessen die Vorzüge der öffentlichen Daseinsvorsorge durch Kommunal-, Landes- und Bundesunternehmen herausstellen. Die preiswerte Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sollte die Politik insbesondere bei Bahn, Post und Telekom nicht aus den Augen verlieren – ebenso wenig wie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, d.h. den Ausgleich zwischen den Ballungsgebieten und den ländlichen, meist wirtschaftsschwächeren Regionen.
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund – Das Nachrichtenmagazin, Heft 2/2009
Quellen
[1] (München 1999, S. 7)
[2] (Tobias Robischon, Letzter Kraftakt des Staatsmonopols: Der Telekommunikationssektor, in: Roland Czada/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Transformationspfade in Ostdeutschland, Frankfurt am Main 1998, S. 61 ff.)
[3] (Ewald Wehner (Hrsg.), Von der Bundespost zu den Global Players Post AG und Telekom AG, München 2005, S. 15)
[4] (Claas Pieper, Der Riese schrumpft, in: Die Zeit, Nr. 26 v. 21.06.2007, S. 21)
[5] (vgl. Lothar Schröder, Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom, in: WSI-Mitteilungen, Heft 9/2007)
[6] (Roland Kohn, Ein Jahrhundertwerk, in: Die Liberale, Heft 1-2/1994, S. 44)
[7] (Heinz Dürr, Privatisierung als Lernprozess am Beispiel der deutschen Bahnreform, in: Horst Albach (Hrsg.), Organisationslernen – institutionelle und kulturelle Dimensionen, Berlin 1998, S. 101)
[8] (vgl. Winfried Wolf, Der Bahnhofs-Krimi. Stellungnahme des Bündnisses „Bahn für alle“ v. 19.2.2007).
[9] (Winfried Wolf, Die sieben Todsünden des Herrn M.: Eine Bilanz der Verkehrs- und Bahnpolitik mit sieben Hinweisen darauf, weshalb diese in einer verkehrspolitischen Sackgasse mündet, Berlin 2002, S. 37)
[10] (vgl. Glabus/Wiskow 2006, Mehdorns Malaise, in: Capital v. 13.2., S. 42).
Der Autor:
Dr. Tim Engartner, Jg. 1976, studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Bonn, Oxford und Köln. Seit dem Abschluss seiner Promotion lehrt er an der Universität zu Köln. Zuletzt ist seine Dissertation „Die Privatisierung der Deutschen Bahn“ im VS Verlag erschienen.