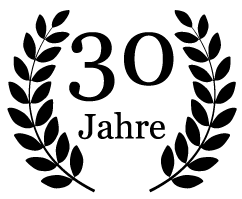Gute Arbeit
Plädoyer für eine industrielle Gesellschaft
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Ist „Arbeit 4.0“ ein Verhängnis? Sind menschenleere Fabriken und durchdigitalisierte Büros ein Horrorszenario oder ein irdisches Paradies? Um solche Fragen beantworten zu können, lohnt es sich, vorab etwas anderes zu klären: Was ist eigentlich „gute Arbeit“, und in welcher Gesellschaft kann sie am besten realisiert werden? Mit Klärung dieser Frage soll eine Grundlage geschaffen werden, um die aktuellen Entwicklungen auch historisch besser einordnen und bewerten zu können.
„Gute Arbeit“ lässt sich zwar nicht abstrakt definieren – aber es gibt Kriterien, die einen Rahmen bieten. So sollte Arbeit nützliche Dinge und Dienstleistungen bereitstellen, die einen „akzeptablen Lebensstandard“ für alle ermöglichen. Entwürdigende, nicht gewollte Tätigkeiten sollten möglichst reduziert werden. Die Produktion sollte zudem so organisiert werden, dass sich die Arbeiter mit dem „Output“ identifizieren können. Welche Organisation der Arbeit wäre also geeignet, um „gute Arbeit“ in diesem Sinne zu ermöglichen?
Dass eine kapitalistische Produktion, insbesondere unter der Herrschaft von globalen, staatsgestützten Monopolkonzernen, dem Konzept der „guten Arbeit“ entgegenläuft, ist leicht einzusehen: Die Unternehmer und Kapitaleigner bestimmen, welche Arbeiten angeboten werden, sie entscheiden über die eingesetzten Mittel, Arbeitsabläufe und Resultate. Die Produktion wird auch keineswegs in Gang gesetzt, um nützliche Dinge herzustellen; die produzierten Gebrauchswerte dienen lediglich als Träger von Profit. Negative Effekte wie Umweltzerstörung und Armut werden beständig „externalisiert“. Die Arbeiter sind zugleich ein Kostenfaktor und potenzielles Störelement, das es zu kontrollieren gilt. In kapitalistischen Betrieben zu „Werkzeugen der Produktion“ degradiert, sind die Beschäftigten kontinuierlich von Rationalisierung und „Deskilling“ („Entwertung von Fähigkeiten“) bedroht. Denn Unternehmen sind im Kampf um Marktanteile und Renditen bestrebt, die hohen Personalkosten zu minimieren und höchste Flexibilität im Sinne von Austauschbarkeit zu ermöglichen.
Es gibt natürlich auch in kapitalistischen Ökonomien gute Jobs und zufriedene Mitarbeiter. Aber „gute Arbeit“ nach den oben genannten Kriterien ist ein sehr knappes Gut in einer kapitalistisch organisierten Produktion – wenn es sie überhaupt geben kann. Denn die Konzentration der Produktionsmittel in den Händen einer kleinen Elite unterwandert strukturell die Demokratie und damit das Grundprinzip „guter Arbeit“, das in der Ausweitung von Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung der Menschen bestehen sollte.
Schon zu Beginn des industriellen Kapitalismus gab es daher Kritik an der spezifischen Organisation der Produktion: Von Karl Marx über die „Factory Girls“ in Massachusetts bis hin zu Rosa Luxemburg attackierten Arbeiter, Aktivisten und Gesellschaftskritiker die Aushebelung „guter Arbeit“ durch vom Kapital gesteuerte Gesellschaften. Anarchisten und libertäre Sozialisten forderten, die Produktionsmittel in die Hände derjenigen zu legen, die in den Betrieben arbeiten.
Praxis der Selbstverwaltung
Während im real existierenden Sozialismus die Produktionsmittel von einer Parteibürokratie kapitalisiert wurden und die betriebliche Mitbestimmung insbesondere in (West-)Deutschland die Kontrolle der Arbeiter über die Produktion eher paralysierte denn förderte, blieb die Idee der Arbeitsplatzdemokratie in der Zivilgesellschaft weiter lebendig. Fortentwickelt wurde sie beispielsweise im Konzept der „partizipatorischen Ökonomie“, wie es vom Ökonomen Robert Hahnel und vom Sozialkritiker Michael Albert in den USA erarbeitet wurde. Im Zentrum des Modells steht die Entwicklung von vier alternativen Institutionen: sich selbst verwaltende Arbeiter- und Konsumentenversammlungen, gleichmäßige Einkommensverteilung für sozial wertvolle Arbeit, ausbalancierte Arbeitsorganisation und partizipatorische Planung.
Die Selbstverwaltung der Arbeiter blieb aber keine reine Idee, sondern wurde schon früh in die Praxis überführt, wenn auch überwiegend in Einzelprojekten. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden insbesondere in Deutschland betriebliche Gegenmodelle im Zuge der sogenannten Genossenschaftsbewegung. Unterstützt von progressiven sozialdemokratischen Strömungen bildeten sich von Mitgliedern getragene Raiffeisenbanken, landwirtschaftliche Genossenschaften, gemeinsam verwaltete Wohnungsgesellschaften etc. In Jugoslawien unter Tito entwickelten sich Betriebsformen jenseits von Staatssozialismus und Kapitalismus, die wirtschaftlich durchaus erfolgreich waren. Während in Deutschland viele der alten Genossenschaften in der Nachkriegszeit kaum noch von anderen Betrieben zu unterscheiden waren, bekam die Idee der Arbeitsplatzdemokratie während der internationalen Proteste in den 1960er und 70er Jahren neuen Aufschwung. Im linksalternativen Milieu Europas und Nordamerikas wurde eine Reihe von Kooperativen, Food Coops und Kommunen gegründet.
Ab den 1980er Jahren waren dann Jobkrisen oft Auslöser für die Entstehung neuer „Worker-Owned-“ und/oder „Worker-Managed-Unternehmen“. In Argentinien bildete sich nach der Wirtschaftskrise 2001 die „Fábricas Recuperadas“-Bewegung: Die Arbeiter eigneten sich Fabriken wieder an, die nach ihrem Bankrott von den Besitzern und dem Management außer Betrieb gesetzt worden waren, und betrieben sie in verschiedenen Ausformungen als Kooperativen. In Venezuela fand im Jahr 2005 das erste „Lateinamerikanische Treffen wiederhergestellter Unternehmen“ mit Vertretern von 263 Betrieben aus verschiedenen Ländern statt.
Im Baskenland entstand bereits in den 1950er Jahren einer der größten industriellen Betriebe, der sich im Besitz von Arbeitern befindet. Der Konzern Mondragon macht jährlich rund zwölf Milliarden Euro Umsatz und unterhält 260 Unternehmen und Genossenschaften, die von 74 000 Mitarbeitern betrieben werden. Mondragon ist aber keineswegs ein ideales Modell, auch wenn es mehr Kontrolle, Lohngerechtigkeit, soziale und wirtschaftliche Stabilität garantiert – denn das Unternehmen verfügt weiterhin über ein Management. An Mondragon zeigt sich zudem noch ein weiteres Problem, das im Prinzip alle Kooperativen trifft: Sie müssen auf kapitalistischen Märkten bestehen, die soziale und ökologische Kosten externalisieren. Sie operieren also in einem feindlichen Umfeld, das die demokratische, auf „gute Arbeit“ ausgerichtete Betriebsstruktur beeinflusst und auf Dauer einschränkt.
Postindustrielle Krisenlösung?
Doch ist die Basis für „gute Arbeit“ allein dadurch gesichert, dass Arbeiter und Gemeinschaften sich selbst organisieren? Müssen wir nicht grundsätzlicher vorgehen und fragen, ob die moderne Industrieproduktion überhaupt vereinbar ist mit einer würdevollen, dem Menschen angemessenen Arbeit?
Die Forderung nach einer postindustriellen beziehungsweise einer Gesellschaft, die nur noch bedingt industriell angetrieben wird, ist angesichts von Klimawandel und Ressourcenknappheit gegenwärtig oft zu vernehmen. In der „Degrowth“-Debatte („Entwachstum“) wird ein „Leben jenseits der industriellen Zivilisation“ entworfen. Kleinbäuerliche und handwerklich ausgerichtete Projekte stehen heute im Zentrum vieler alternativer Gesellschaftsentwürfe.
Die einzelnen Kritikpunkte an der industriellen Gesellschaft sind durchaus unterschiedlich gelagert. Es gibt konservative, traditionalistische, religiöse, aber auch linke und progressive Strömungen; dabei teilen alle mehr oder weniger die Annahme, dass die industrielle Produktion in einer industriellen Gesellschaft keine erfüllende, für den Menschen angemessene Arbeit und eine mit sozialer Gemeinschaft und Respekt für die Natur vereinbare Lebensweise schaffen kann. Vielmehr zerstören Fließbänder, Bergwerke und Tagebaue, ein Netz von Hochgeschwindigkeitstrassen sowie künstliche Mall- und Shoppingwelten in einem fort Natur, handwerkliche und ländliche Tätigkeiten – und damit auch Schritt für Schritt die Basis für das, was „gute Arbeit“ und „gutes Leben“ bedeutet. Brauchen wir heute also eine große Transformation weg vom „Industriellen“?
Gegenargumente
Gewiss – die Fehlentwicklungen der kapitalistischen Industrialisierung sind unübersehbar. Sie verschärfen Krisen, die heute das Überleben der Spezies betreffen. Sich aus der sozialen und ökologischen Krise durch industrielle Schrumpfung „herauszusparen“ oder sie in einer postindustriellen Gesellschaft zu überwinden, führt nach Ansicht des Autors jedoch in die Irre. So ist der Klima- und der globalen Armutskrise nur durch technologische Antworten im Rahmen der industriellen Gesellschaft zu begegnen. Die globale Energiefrage löst sich keineswegs postindustriell in Luft auf, auch wenn die Nachfrage der Industriestaaten und wohlhabenden Schichten zum Teil drastisch reduziert werden muss. Zudem: Kapitalistische Ausbeutung und Zerstörung auf der einen und technischer Fortschritt und Industrialisierung auf der anderen Seite gingen zwar historisch Hand in Hand, aber es sind nicht zwei Seiten ein und derselben Medaille. Technologie ist mehr oder weniger neutral. Ihre Wirkung hängt davon ab, wie sie benutzt wird. Ihr Charakter ändert sich, je nachdem, in welche sozialen Institutionen sie eingebettet wird. Das gilt aber auch für andere Zivilisationsformen wie Agrargesellschaften, die einige der repressivsten Systeme hervorgebracht haben.
Die Befürworter einer postindustriellen Gesellschaft führen eine Reihe von Argumenten an, die einen Ausstieg aus der industriellen Gesellschaft beziehungsweise ihre Schrumpfung als notwendig oder alternativlos erscheinen lassen, um „gute Arbeit“ und „gutes Leben“ zu ermöglichen.
Drei davon sind:
➊ Die industrielle Produktion erzeugt entwürdigende Arbeitsverhältnisse und immer mehr „überflüssige Menschen“.
➋ Technischer Fortschritt und Industrialisierung sind nicht neutral; ihre zerstörerische Dynamik ist letztlich nicht kontrollierbar.
➌ Ein akzeptabler Lebensstandard für alle ist aufgrund der planetaren Grenzen auf industrieller Basis nicht (mehr) herstellbar.
Die Frage ist allerdings, ob diese Argumentation wirklich überzeugend und der darin propagierte Richtungswechsel zwingend ist. Machen entwürdigende Industriearbeit, zerstörerischer Fortschritt und die planetaren Grenzen eine Abkehr vom „Industriellen“ und eine radikale Neuausrichtung der Gesellschaft tatsächlich notwendig? Kommen wir nur so zu „guter Arbeit“?
Zu ➊: Es gibt in jeder Gesellschaft – nicht nur in einer industriell ausgerichteten – Arbeit, die wenig kreativ, dafür aber belastend und ungewollt ist. Eine fortgeschrittene technologische Gesellschaft hat jedoch die Möglichkeiten, viele dieser Tätigkeiten angenehmer zu gestalten oder sie zahlenmäßig zu reduzieren.
So kann heutzutage der größte Teil der Fließbandmontage von feinsensorischen Robotern erledigt werden – eine wünschenswerte Entlastung der Arbeiter von stupiden Tätigkeiten am Fließband. Die Menschen könnten sich nun anderen, kreativeren Arbeiten zuwenden. Die Industriekonzerne verfolgen sicherlich andere Ziele, aber auch hier gilt: Nicht die Roboter entlassen Arbeiter und machen sie „überflüssig“.
Bäuerliche Arbeit und Handwerk gelten demgegenüber oft als Vorbild authentischer und erfüllender Tätigkeiten. Dabei können auch bäuerlich-handwerkliche Arbeiten belasten, gesundheitsschädigend und stupide sein – die Baumwollpflückerinnen in Indien können ein Lied davon singen. Die Zwänge sind zum Teil enorm, jedenfalls in der vorindustriellen, nicht maschinisierten Form. Selbstversorgung in Agrargesellschaften bedeutet meist einen einsamen und rauen Überlebenskampf. Freie Zeit, Bildung, Kooperation und Austausch auch über lokale Grenzen hinweg sind die Ausnahme.
Zu ➋: So wenig industrielle Produktion zwangsläufig entwürdigende und stupide Arbeiten hervorbringen muss, so wenig sind die mit ihr einhergehenden zerstörerischen Effekte eine Folge der Technologie und Massenproduktion „an sich“. Nehmen wir den „Motor der Industrialisierung“, die fossile Energieerzeugung: an sich eine gute Sache. Damit ließen sich Maschinen betreiben, welche die Menschen entlasteten. Sie ermöglichte massenhafte Stromerzeugung und setzte Lokomotiven, Autos und Straßenbahnen in Bewegung. Viele sinnvolle Dinge sind daraus hervorgegangen. Aber die negativen Effekte waren von Beginn an unübersehbar: Die Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung oder bleihaltige Autoabgase hatten und haben schwere, oft tödliche Atemwegserkrankungen und gravierende Umweltschäden zur Folge.
Diese Verwüstungen folgen aber keinem „Naturgesetz“ der Industrialisierung. Die Luftverschmutzung hätte von Beginn an auf ein Minimum reduziert werden können: Es gab Luftreinigungstechnologien (eingesetzt schon früher in der Steinverarbeitung) und Filter bereits im 19. Jahrhundert.
Doch der Gesundheit der Menschen und dem Schutz der Umwelt wurde während der Industrialisierung bis in die 1970er Jahre hinein kein oder nur ein untergeordneter Stellenwert beigemessen. Das lag nicht etwa an den Energietechnologien, sondern an den Unternehmen, Investoren und der politischen Klasse. Sicherlich gibt es Technologien, die keinen sinnvollen Nutzen haben oder wie die Atomenergie mit enormen Risiken verbunden sind.
Im Allgemeinen kommt es aber auf die Verwendung einer Technologie an, auf die Organisation der Gesellschaft, die die Techniken und Mittel ausrichtet. Sich selbst verwaltende Gesellschaften werden daher die besten zur Verfügung stehenden Technologien für sich nutzen wollen.
Zu ➌: Sind postindustrielle beziehungsweise industriell geschrumpfte Gesellschaften noch in der Lage, einen akzeptablen Lebensstandard zu garantieren? „Akzeptabler Lebensstandard“ ist natürlich ein relativer Begriff und bedeutet für einen Westeuropäer etwas anderes als für einen Mosambikaner oder eine Familie in einem Krisengebiet. Der Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen ist zwar keine ideale Messgröße für den Lebensstandard, bietet aber eine grobe Orientierung. Er zeigt, dass ökonomische Entwicklung mit Lebenslänge und -qualität korreliert. Das Leben eines Westeuropäers ist demnach materiell gut abgesichert. Das gilt für Ernährung, Wohnen, medizinische Versorgung, funktionierende Städte und Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz, soziale Institutionen, Erziehung und Schulen, Arbeitsverhältnisse, Freizeit, Mobilität usw. Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten und Freiheiten für die Menschen und die Gesellschaft insgesamt. All das garantiert nicht per se „Glück“, ist aber einer möglichen „Lebenszufriedenheit“ sicher nicht abträglich.
Industrielle Lebensgrundlage
Der größte Teil der Weltbevölkerung ist weit entfernt von einem angemessenen Lebensstandard. Oft sind nicht einmal die elementaren Bedürfnisse befriedigt. In Ländern ohne eigenen industriellen Kern leben die Familien unter extrem prekären, zum Teil katastrophalen Bedingungen. Viele sind Hunger und Armut schutzlos ausgeliefert, die meisten haben keinen Zugang zu Stromversorgung, Gesundheitsversorgung, sozialen Leistungen, funktionierender Infrastruktur und Verwaltung.
Hinter dem Elend verbirgt sich ein grundsätzlicher Mangel an Industrialisierung in den „hungrigen Staaten“. Sicherlich muss die kleinbäuerliche Landwirtschaft gestützt werden, um etwa Ernährungssouveränität herzustellen. Aber das reicht nicht, um die multiplen Krisen in der „Dritten Welt“ zu lösen und sie in die Selbstständigkeit zu führen. Die Länder sind auf eine eigenständige industrielle Entwicklung angewiesen, die jedoch über Jahrhunderte – oft gewaltsam – blockiert wurde. Den Afrikanern, Asiaten und Lateinamerikanern wurde, wie der deutsche Ökonom Friedrich List im 19. Jahrhundert treffend formulierte, die „Leiter weggetreten“, auf der Europäer und US-Amerikaner hinaufstiegen.
Aber können wir uns einen „akzeptablen Lebensstandard“ für alle überhaupt noch leisten? Ist eine industrielle Gesellschaft nicht ökologisch zerstörerisch und unvereinbar mit Nachhaltigkeit? Zeigen nicht Klimawandel und Rohstoffknappheit, dass wir in den reichen Ländern über unsere Verhältnisse leben und nun eine Grenze erreicht ist, die uns zwingt, einen anderen Weg einzuschlagen? Richtig ist, dass Industrialisierung die Umwelt vielfach geschädigt hat. Ein radikaler industrieller Umbau ist daher nötig, der, wenn er nicht immer wieder blockiert worden wäre, heute kein derart drängendes Thema mehr wäre. Richtig ist auch, dass es eine Reihe von Möglichkeiten in den real existierenden Industriestaaten gibt, „Ballast“ abzuwerfen und zu „entrümpeln“, wie es Postwachstumskritiker Niko Paech fordert.
Aber industrielle Schrumpfung oder eine postindustrielle Gesellschaft sind nicht die Lösung. Selbst wenn die Industriestaaten ihre Energienachfrage in den nächsten zwanzig Jahren um 50 Prozent reduzieren und ihren Lebensstandard herunterfahren würden, wäre das Klimaproblem damit ja nicht aus der Welt. Der Regress würde aber in eine ökonomische und globale Katastrophe mit unabsehbaren Konsequenzen führen. Nur mittels Technologien – durch den schnellen Ausbau alternativer Energien und eine treibhausgasneutrale Infrastruktur – lässt sich die Klimakrise abbremsen. Denn langfristig herrscht kein Mangel an erneuerbaren Energien für die Schaffung eines allgemeinen akzeptablen Lebensstandards unter industriellen Bedingungen.
Es ist lediglich eine Frage des politischen Willens und der Umsetzung, nicht der technischen Machbarkeit. Sicherlich ist der Ressourcenvorrat unseres Planeten begrenzt. Aber das neomalthusianische Katastrophenbild, nach dem nicht alle Menschen auf dieser Erde einen „akzeptablen Lebensstandard“ erreichen können, weil wir nicht über zwei Planeten verfügen, ist kein Naturgesetz. Selbst das Vorhandensein begrenzter Ressourcen kann durch Schonung und damit ermöglichte hocheffiziente Wiederverwertung „verlängert“ werden.
Wenn wir also von „guter Arbeit“ sprechen, sollten wir uns fragen, wie wir die industriellen Gesellschaften von ihren Blockaden befreien können, um eine solche zu ermöglichen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir die besten Technologien für uns sinnvoll nutzen können. Das heißt aber nicht, alles ohne Sinn und Verstand in kapitalistischer Manier zu „industrialisieren“ und zu „digitalisieren“.
Niemand würde beispielsweise die real existierende „Agrarindustrie“ mit ihren hochkonzentrierten Saatgut-, Chemie- und Nahrungsmittelkonzernen gegen eine nachhaltige Landwirtschaft verteidigen wollen. Die Nachteile ersterer sind offensichtlich: Riesige Monokulturen, großflächiger Einsatz von Kunstdüngern und anderen Chemikalien, inakzeptable Massentierhaltung, der gefährliche Einsatz von Antibiotika usw. haben Umwelt und ländliches Leben stark geschädigt und bergen enorme Risiken wie Pandemien.
Aber erst eine industrielle Gesellschaft schafft die Möglichkeit, eine nachhaltige Landwirtschaft unter der Bedingung eines akzeptablen Lebensstandards zu begründen und von den Zwängen und Beschränkungen der Agrargesellschaften zu befreien.
Was folgt daraus nun für die gegenwärtige Situation von „Industrie 4.0“ und „Arbeit 4.0“? Ein kluger Weg wäre es, sich in selbstverwalteten Fabriken und auf für die Gesellschaft sinnvolle Weise der verfügbaren Technologien zu bedienen. Was aber ist mit den bestehenden Industrien? Es versteht sich wohl von selbst, dass ein Heer von Robotern in den Händen von Monopolkonzernen und einer globalen Businessklasse ohne angemessene öffentliche Kontrolle keine gute Sache ist.
Aber wie gesagt: Nicht Roboter, Autos, Informationstechnologien und automatisierte Massenproduktion sind das Problem. Die industrielle Gesellschaft ist keine Sackgasse, aus der wir uns befreien müssen. Vielmehr ist sie besser als andere Zivilisationsformen dazu geeignet, auf breiter Basis Freiheit und Kreativität, also das, was „gute Arbeit“ und „gutes Leben“ sein können, für alle zu befördern. Auch oder gerade in einer industriellen Welt 4.0.