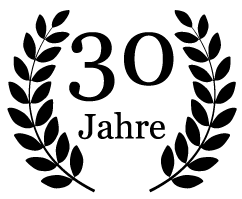Gift auf meiner Haut
Unsere Kleidung beherbergt Hunderte Chemikalien. Viele davon sind in anderen Produkten längst verboten
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Wer reine Baumwolle trägt, fühlt sich qualitätsbewusst und naturnah. Dabei ist Baumwolle zwar ein Naturstoff, hat aber mit Ökologie herzlich wenig zu tun. Im Gegenteil: Baumwolle ist die am stärksten mit Pestiziden behandelte Kulturpflanze überhaupt. Dass die Fasern auf ihrem Weg zum fertigen Kleidungsstück noch mit vielen weiteren gefährlichenChemikalien und Farbstoffen in Berührung kommen, ist den meisten Verbrauchern nichtbewusst.
Ein erbitterter Preiskampf beherrscht die Szene der Textilhändler in Deutschland. Der Absatz stagniert seit Jahren, wenn auch auf sehr hohem Niveau. Der Einzelhandelsumsatz mit Bekleidung sowie Haus- und Heimtextilien verharrte nach Angaben des BTE Handelsverbandes Textil im Jahr 2016 auf dem Wert des Vorjahres. Mittelständische Boutiquen und Modehäuser mussten Einbußen verzeichnen, wohingegen Modeketten wie H&M, Primark oder Zara zulegten. Über ein dickes Stück vom Kuchen durften sich auch der Versandhandel, Warenhäuser und Lebensmitteldiscounter freuen. Verdient wird am meisten mit billiger Massenware aus China, Bangladesch und Indien. Insgesamt lag das Marktvolumen von Bekleidung und Textilien im deutschen Einzelhandel bei 64 Milliarden Euro. Jeder Einwohner gab damit statistisch betrachtet rund 780 Euro für Textilien aus – eine Menge Geld für Klamotten, die zum größten Teil nur wenig getragen werden, dabei den Schrank vollstopfen und darüber hinaus auch noch aktiv unseren Körper vergiften.
Denn wenn uns der Schweiß aus den Poren rinnt, lösen sich auch diverse Pestizidreste, chemische Weichmacher und künstliche Farbstoffe aus den Fasern, die sich direkt auf unserer Haut festsetzen. Sie können ungehindert in die oberen Hautschichten und teilweise auch tiefer in den Körper eindringen und dort hormonell, erbgutschädigend und krebserregend wirken sowie Allergien auslösen. Kleidung besteht eben nicht bloß aus Baumwolle oder Polyester oder einer Mischung aus beidem – sie ist getränkt mit einem Cocktail aus Hunderten Chemikalien, die bis zu einem Fünftel des Gewichts des Kleidungsstückes ausmachen können. Und es gibt bislang immer noch keine ernsthafte Untersuchung, die die Addition und Wechselwirkung aller durch Lebensmittel, unsere Kleidung und die Atemluft in unserem Körper aufgenommenen Chemikalien, Stickoxide und Staubteilchen einmal genauer unter die Lupe nehmen würde. In Textilien sind immer noch viele Chemikalien erlaubt, die in anderen Produkten längst verboten sind: Aus dem Autobenzin wurde das Blei verbannt, in Knöpfen und Reißverschlüssen von Jacke und Hose darf es bis heute sein. Was wie das giftige Tributylzinn (TBT) bei Schiffsanstrichen tabu ist, sollen wir getrost auf der Haut tragen. In einem schwarz gefärbten BH identifizierten Forscher über 400 Chemikalien. Von den 1 600 kommerziellen Farben sind wohl nur 16 (!) wirklich unbedenklich – vermutet man. Aber Genaues weiß man eben nicht.
Die Liste des Bösen
Was für Chemiezeug man so in Klamotten finden kann, liest sich wie aus einem Giftbuch; Greenpeace macht es mit seiner „Detox-Kampagne“ seit 2011 öffentlich. Die Umweltorganisation untersucht regelmäßig hierzulande erhältliche Textilwaren des globalisierten Modemarktes und macht dabei immer wieder erschreckende Entdeckungen. Mit der Hilfe von Wissenschaftlern hat die Umweltorganisation eine „schwarze Liste“ der Textilgifte vorgelegt, die jährlich überprüft und aktualisiert wird. Zurzeit umfasst sie über 400 umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen, die nach Ansicht von Greenpeace gebannt werden müssten.
Dazu gehören allen voran die alten Bekannten Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Dimethylformamid (DMF), das als akut toxisch bei Hautkontakt gilt. Bekannt ist mittlerweile auch, dass der Großteil des weltweit produzierten Leders mit hochgiftigen Chromsalzen gegerbt und behandelt wird. Darüber hinaus gibt es aber auch Akylphenole und ihre Ethoxylate, die ähnlich wie Östrogene wirken; seit 2005 ist der Verkauf von Produkten, die solche Substanzen enthalten, in der EU verboten. Ein schillerndes Kapitel sind die sogenannten Azofarben, die in der Textilindustrie weit verbreitet sind. Sie stehen in Verdacht, krebserregend zu sein, und dürfen daher nicht mehr für Textilien verwendet werden, die direkt auf der Haut getragen werden. Ein Abkömmling davon, Anilin, fand sich in Spuren aber selbst in Biokinderjeans von Ökopionier Hess-Natur und Living Crafts, berichtete Öko-Test. Die Hersteller räumten ein, dass eine Nullprozentgrenze derzeit technisch nicht möglich sei.
Doch die Giftliste ist noch viel länger: Bromierte und chlorierte Flammschutzmittel in der Kleidung schädigen die Geschlechtsorgane. Chlorphenole, Chlorbenzole und Trichlorethan dienen als Biozide und Lösungsmittel zur Entfernung von Chemikalienrückständen. Ein hochgiftiger Vertreter dieser Familie ist Pentachlorphenol, das bereits seit 1991 in der EU verboten ist. Kurzkettige Chlorparaffine „veredeln“ Textilien und Leder und reichern sich im menschlichen Körper an. Besonders beliebt in der Outdoor-Branche ist die Stoffgruppe der perund polyfluorierten Chemikalien (PFC). Sie wirken wasser- und schmutzabweisend für die atmungsaktive Regenjacke, aber dringen bis in das Gewebe und Blut der Menschen vor – und sind dort besonders langlebig. Sie können die Leberfunktion schädigen und das Hormonsystem stören. Besonders gefährlich sind Perfluoroktansulfonat (PFOS) und die Perflouroktansäure (PFOA).
Der Marktführer für Outdoor-Textilien, Gore Fabrics, will künftig auf diese Chemikalien verzichten. Bis 2023 sollen alle Produkte frei davon sein, verspricht er. Den Umstieg auf andere Hilfsstoffe aus dieser Familie sieht Greenpeace allerdings kritisch. So seien Fluortelomeralkohole (FTOH) leicht flüchtig und könnten sich in der Umwelt wieder in PFOA umwandeln. Für die Bügelfaulen hat Greenpeace leider auch eine schlechte Nachricht: Der Stoff, der Hemden knitterfrei macht, ist meist Formaldehyd. Diese Chemikalie gilt als krebserregend, hautreizend und allergieauslösend. Eine weitere Stoffgruppe, die sogenannten Phthalate, sind Weichmacher, die vor allem in Druckfarben und Plastikaufdrucken bei T-Shirts verwendet werden. Nach Chemikalienrecht sind etliche davon seit 2015 verboten. Organozinnverbindungen werden in der Textilindustrie in Socken, Schuhen und Sportbekleidung eingesetzt, um die Geruchsbildung zu unterdrücken – eine müffelnde Socke wäre weitaus weniger schädlich.
Dass die Textilindustrie eine Entgiftung braucht, liegt auf der Hand. Aber macht sie das auch freiwillig? Ein Teil davon überraschenderweise wohl schon: Die Kampagne von Greenpeace scheint ordentlich Druck zu erzeugen. Jedenfalls haben sich mittlerweile 34 Marken, darunter Fast-Fashion-Ketten wie H&M und Zara, Sportartikel-Giganten wie Adidas und Nobelmarken wie Valentino, verpflichtet, bis zum Jahr 2020 giftfrei zu produzieren. Das entspricht gut 15 Prozent der Textilindustrie weltweit. Erstaunlich: Sogar die Discounter und Supermärkte mit ihrem schnell wechselnden Sortiment an Billigkleidung machen mit. Lidl, Rewe/Penny, Kaufland, Tchibo und Aldi wollen Transparenz in ihre Lieferketten bringen und bis 2020 saubere Textilien anbieten. Absolute Ignoranten hingegen sind Luxusfirmen und Edelmarken wie Hermès, Louis Vuitton, Versace oder Armani.
Alternative: Biobaumwolle
Von der Herkunft der Textilwaren wissen die meisten Verbraucher in der Regel nichts. Oft gibt nur ein kleines Etikett wie „Made in Bangladesh“ Auskunft über den Ursprung des Herrenoberhemdes; die Herstellungs- und Arbeitsbedingungen werden nicht preisgegeben. Man erfährt nicht, dass die Näherinnen in den Textilfabriken den ganzen Tag mit den Resten hochgiftiger Schädlingsbekämpfungsmittel in den Stoffen in Kontakt kommen. Denn auf den Feldern wird gespritzt, was das Zeug hält. Die riesigen Monokulturen sind enorm anfällig gegenüber Schädlingen, insbesondere dem Baumwollkapselwurm. Durch fehlende Schutzkleidung, verseuchtes Trinkwasser oder falsche Lagerung der teuren Chemikalien gehören Vergiftungen in Baumwollanbaugebieten zum Alltag. Gleichzeitig werden viele Insekten resistent gegen die Gifte, und das macht immer neue Generationen von Pestiziden notwendig.
Fasern aus Holz
Neben Biobaumwolle werben Hersteller auch bei aus Holz erzeugten Fasern mit Naturnähe und Nachhaltigkeit. Die unter den Produktnamen TENCEL (Lyocell) und MODAL von der österreichischen Firma Lenzing vertriebenen Viskosestoffe sind sehr angenehm zu tragen. Doch der Herstellungsprozess ist äußerst chemikalienlastig und energieaufwendig: Die im Holz enthaltene Cellulose wird herausgelöst, der gewonnene Faserzellstoff in Lösungsmitteln oder Natronlauge gelöst und anschließend gefiltert, getrocknet, durch Düsen gepresst und schließlich gebleicht. Für diesen Prozess sind chemische Hilfsstoffe, Mattierungsmittel und Stabilisatoren notwendig.
Dass schleunigst eine Kehrtwende beim Anbau von Baumwolle erfolgen muss, wissen heutzutage alle Beteiligten. Die ökologischen und sozialen Probleme schreien zum Himmel. Kein Unternehmen will freiwillig etwas mit Kinderarbeit und vergifteten Arbeiterinnen zu tun haben. Das schadet dem Image ungemein und entspricht nicht der gerne zur Schau getragenen sozialen Verantwortung. Auch der Verbraucher in Deutschland ist kritischer und umweltbewusster geworden. Aus diesen Gründen nimmt der Anbau von Biobaumwolle deutlich zu, mittlerweile wird sie in 24 Ländern angebaut. Die bedeutendsten Produzenten sind die Türkei, Indien, China, Syrien, Peru und die USA. Im Jahr 2011 wurden knapp 240 000 Tonnen geerntet – Anfang des Jahrtausends waren es gerade einmal 6 500 Tonnen.
Der Anteil von Biobaumwolle an der globalen Baumwollproduktion macht jedoch bislang nur 1 Prozent aus. Die Tendenz ist zwar steigend, aber man fragt sich, warum das so lange dauert – schließlich liegen die Vorteile von kontrolliert biologischer Baumwolle für Mensch und Natur auf der Hand. In Entwicklungsländern kann biologischer Anbau zudem helfen, Armut und Hunger wirksam zu bekämpfen: Man verzichtet auf den Einsatz teurer chemisch-synthetischer Mittel und setzt stattdessen auf nachhaltige Anbaumethoden und Fruchtfolgen, wodurch ökologische Kreisläufe berücksichtigt werden. Der Anbau von Nahrungspflanzen ermöglicht den Bauern, unabhängiger vom Produkt Baumwolle zu werden, und dient direkt der eigenen Versorgung.
Nebelkerzen im Label-Dschungel
Biologischer Baumwollanbau ist natürlich – kurzfristig betrachtet – aufwendiger und teurer als konventioneller Anbau. Der Handel will einen kostengünstigen, hohen und schnellen Warenumschlag, und der Verbraucher will möglichst preiswerte Ware. Außerdem steht der Bioanbau in direkter Konkurrenz zum Geschäft der Pestizidhersteller und Gentech-Multis: Sie würden Macht und Einfluss verlieren, wenn für die Bauern eine echte Alternative erwüchse. Schlechte Karten also für einen Umstieg auf eine breite und ernsthaft biologische und sozial verantwortliche Produktion. So sehr die Initiativen zum vermehrten Absatz von Biobaumwolle beispielsweise von C&A, Tchibo und dem Otto-Versand zu begrüßen sind, können und wollen sie dieses Dilemma doch nicht lösen.
Die Hersteller und Händler agieren wie Politiker, winden sich, verhandeln hinter verschlossenen Türen, gehen Kompromisse ein und gebären vieldeutige neue Qualitätsstandards. Die Folge: Nirgendwo finden sich so viele verschiedene Siegel, Labels und Qualitätskennzeichen wie in der Textilbranche, die bei den meisten Verbrauchern eher für Verwirrung als für Orientierung sorgen. Die gesetzlichen Vorschriften sind dabei viel zu lasch. Laut dem Textilkennzeichnungsgesetz müssen Textilwaren nur mit Angaben zu den verwendeten Rohstoffen und deren Gewichtsanteil gekennzeichnet werden – über die Art der Verarbeitung und die verwendeten Hilfsstoffe müssen keine Aussagen getroffen werden. Das geht heutzutage eigentlich gar nicht mehr: Verbraucher sollten auch über die ökologische und gesundheitliche Qualität der jeweiligen Textilware informiert werden. Aus diesem Anspruch heraus ist eine Fülle unterschiedlicher Qualitätsnormen entstanden, und zusätzlich spielen nun auch unabhängige Soziallabels mit. Diese möchten die Arbeitsbedingungen entlang der textilen Produktionskette transparenter machen und einheitliche Sozialstandards festlegen, wie beispielsweise beim Fairtrade-System.
Viele Firmen und Handelshäuser haben hingegen eigene Produktionsvorschriften entwickelt, die intern überprüft werden. Mithilfe von Eigenmarken signalisieren sie den Kunden Verantwortung und bessere Qualität. Dazu kommen noch Labels wie die Euro-Blume und der Blaue Engel, die von staatlichen Behörden vergeben werden. Die Verwendung des Rohstoffes Biobaumwolle wird ebenfalls durch die EU-Öko-Verordnung geregelt, denn sie greift auch bei Importen aus dem Ausland. Ein einheitliches Kennzeichen für Mindeststandards und einen Begriffsschutz wie beim Bio-Siegel im Lebensmittelbereich gibt es aber bis heute nicht. Die Kriterien und Standards dieser Label setzen an unterschiedlichen Punkten in der Produktionskette an, haben verschiedene Schwerpunkte und klammern bestimmte Problembereiche bewusst aus. Sie schreiben sich den Begriff „Öko“ auf die Fahne, sind es aber gar nicht, oder sie sind nur Halb- oder Viertel-„Bio“ und lassen in gewissem Rahmen gentechnisch manipulierte Baumwolle und Pestizide zu oder auch nicht. Nur wenige Labels sind wirkliche Bio-Siegel (siehe Kasten). Eine im Hinblick auf den Standard- und Label-Dschungel begrüßenswerte unabhängige Initiative für ein einheitliches Zertifikat von Biofasern ist der „Global Organic Textile Standard“ (GOTS). Mehrere Organisationen, darunter der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN) und die britische Soil Association, haben ihn gemeinsam erarbeitet. Damit man weiß, was man auf der Haut trägt.
Relevante Siegel für giftfreie Kleidung
Nach Ansicht von Greenpeace sind derzeit das IVN Best-Label (welches aber nur für reine Naturfasern gilt) und das GOTS-Label am strengsten und am vertrauenswürdigsten, wenn es um die Kennzeichnung von gesundheitlich unbedenklichen Textilien geht. Im März 2017 ist die Version 5.0 dieses Standards für Biofasern in Kraft getreten, die Verwendung von Viskose und Modal ist auf 10 Prozent beschränkt worden (25 Prozent für Socken und Sportbekleidung). Der Einsatz von Lyocell ist wegen des verträglicheren Herstellungsprozesses nach wie vor bis zu einem Anteil von 30 Prozent erlaubt. Auch der Bluesign-Standard ist laut Greenpeace sehr streng im Chemikalienmanagement. Der Cradle-to-Cradle-Standard hingegen ist der Umweltorganisation zufolge bei verbotenen Chemikalien nicht umfassend genug, und einzelne Toleranzwerte seien zu hoch. Auch das EU-Ecolabel für Textilien („EU-Blume“) geht Greenpeace nicht weit genug: Die Liste verbotener Chemikalien sei zwar umfangreich, habe aber auch ihre Schwachstellen. Die Grenzwerte seien mitunter zu hoch und Laboranalysen am Endprodukt nur teilweise vorgesehen. Der weit verbreitete Öko-Tex-Standard 100 wird von Greenpeace am schwächsten bewertet. Hier würden ausschließlich Endprodukte auf Schadstoffe geprüft, der Produktionsprozess hingegen werde nicht berücksichtigt. Etwas umfassender sei aber das Made-in-Green-Label von Öko-Tex, das die gesamte textile Lieferkette einbezieht.Zur Vertiefung:
Greenpeace Deutschland, Textil-Label unter der Detox-Lupe.
Einkaufsratgeber für giftfreie Kleidung,
4. Auflage Juni 2016