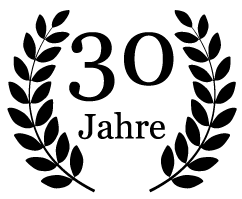„Die Politik hat sich selbst Fesseln angelegt“
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Ein Gespräch mit ANDRES FISAHN, 8. März 2011 –
Über Ursachen und Folgen der Euro-, Finanz- und Wirtschaftskrise, die Fehler der Regierung und die Notwendigkeit eines grundlegenden politischen Richtungswechsels –
Andreas Fisahn (geb. 1960) lehrt Öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht sowie Rechtstheorie an der Universität Bielefeld. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac. Mit dem Buch „Herrschaft im Wandel“ publizierte er 2008 einen wichtigen Beitrag zur kritischen Theorie des Staates. Sein aktuelles Buch heißt „Die Demokratie entfesseln, nicht die Märkte. Argumente für eine postkapitalistische Wirtschaft und Gesellschaft“.
Hintergrund: Können Sie kurz erklären, wie es zur Euro-Krise gekommen ist?
Andreas Fisahn: Die Euro-Krise ist keine eigenständige Krise, sondern ist im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise zu
| Andreas Fisahn: „Deutschland spielt eine ganz fürchterliche Rolle. Die Regierung setzt auf reine Sparpolitik. Man tut so, als ob die Krise schon bewältigt worden sei und es nun darum gehen könne, die ausgegebenen Gelder wieder einzusparen.“ |
sehen. Es handelt sich um eine lange Wirkung der Spekulationsblase, die in den USA geplatzt ist. Die Banken hatten dort Kredite an Häuslebauer gegeben, die nicht ordentlich abgesichert waren. Das ist die Oberfläche der Geschichte. Der Hintergrund ist eine ungleiche Vermögensverteilung und eine Überakkumulation des Kapitals bei den Reichen – was dazu führte, dass sie ständig nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen müssen.
Hintergrund: Was bedeutet „Überakkumulation des Kapitals“?
Andreas Fisahn: Das ist ein Begriff, den Karl Marx in die Diskussion gebracht hat. Er beschreibt das Phänomen, dass bei ständig wachsender Kapitalanhäufung die Verwertung des Kapitals schwieriger wird, das heißt, dass die Höhe der Gewinne tendenziell sinkt. Das Geld wirft einen immer geringeren Zinssatz ab. Ganz viele Reiche haben sehr viel Geld, dass sie irgendwo anlegen müssen, und damit entstehen Verzinsungsschwierigkeiten.
Hintergrund: Diese Überakkumulation des Kapitals ist aber kein neues Problem.
Andreas Fisahn: Die Spekulationsblasen entstehen im Augenblick ständig, weil einfach zu viel Geld im Umlauf ist, um die Welt „vagabundiert“ und Anlagemöglichkeiten sucht. Die Spekulationsblase, die jetzt in den USA geplatzt ist, ist nicht die erste, sondern steht in einer ganzen Reihe, die allerdings zunächst die USA und Europa nur peripher getroffen hat. Sie ist einmal um die Welt gewandert: zum Beispiel die Asien-Krise, die Russland-Krise und die Mexiko-Krise. Die erste dieser Krisen, die in Europa stattgefunden hat, setzte 1987 ein. Damals brachen die Aktienmärkte zusammen. Das war das erste Anzeichen, dass viel zu viel Geld im Umlauf ist, dass tendenziell die Gefahr besteht, dass Spekulationsblasen entstehen. In der sogenannten Realwirtschaft ist damals aber noch nicht viel passiert. Der Einbruch der Aktienkurse hat auf die reale Produktion, das Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze noch kaum Auswirkung gehabt. Die Japaner dagegen stecken bereits seit Anfang der 1990er Jahre in einer großen Krise, haben praktisch keine Wachstumsraten und ein Ausweg zeichnet sich nicht ab. Die letzte Blase, die in Europa als Problem zur Kenntnis genommen wurde, war die sogenannte Dotcom-Blase der New Economy in den Jahren 2000 und 2001. Damals wurde hoch spekuliert auf die neuen Firmen, die im Internet entstanden sind. Auch damals sind die Aktienkurse eingebrochen, ohne dass das nennenswerte Auswirkungen in der „realen“ Wirtschaft hatte.
Hintergrund: Was ist denn dann bei der Immobilienkrise in den USA anders gelaufen?
Andreas Fisahn: Die hatte direkte Auswirkungen auf die „reale“ Wirtschaft, weil die Banken in Zahlungsschwierigkeiten gerieten. DieLehman-Bank ist ja dann auch tatsächlich pleitegegangen mit der Folge, dass die anderen Banken ihre an Lehman gezahlten Kredite abschreiben mussten, damit selber in Zahlungsschwierigkeiten kamen, wie die Commerzbank oder die Hypo Real Estate (HRE), oder wenigstens den Anschein erweckten. Weil Schwierigkeiten entstanden, Kredite zu bekommen, und eine allgemeine Verunsicherung entstand, hat es in Europa die größte Rezession seit 1929 gegeben. Das Bruttoinlandsprodukt ging in Deutschland 2009 um ca. 5 Prozent zurück. Die Staatsschulden wuchsen, schon allein, weil Steuereinnahmen fehlten, aber auch, weil die Staaten den Banken unter die Arme griffen.
Ganz Europa bricht im Moment die Maastricht-Kriterien. Das sind die im Maastricht-Vertrag festgelegten Verschuldungsobergrenzen. Die liegen bei 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, was die jährliche Neuverschuldung betrifft. Außer Finnland liegen alle Euroländer weit darüber. Das zweite Maastricht-Kriterium ist: Es darf keine höhere Gesamtstaatsverschuldung geben als 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Deutschland liegt 2010 voraussichtlich bei 78 Prozent, Griechenland bei 124 Prozent. Dieses Schuldenspektakel ist aber nun durch die Krise mitausgelöst und verschärft worden. Natürlich hat der griechische Staat auch selber Fehler gemacht. Der Hauptfehler bestand darin, dass sie nicht genug Steuern eingetrieben haben. Wahrscheinlich kommt, ohne dass ich das genau belegen könnte, nach meinem Eindruck auch ein besonderes Ausmaß an Korruption hinzu, wo Subventionen versickern, ohne dass diese ihr Ziel erreichen, also reale Werte entstehen würden. So entstehen natürlich auch Schulden.
Hintergrund: Manche behaupten auch, das griechische Sozialsystem sei überdimensioniert.
Andreas Fisahn: Das würde ich nicht sagen. Die Menschen gehen dort zwar früher in Rente als hierzulande, bekommen dann aber so wenig Rente, dass sie auf der Straße stehen und Lose verkaufen. So etwas sieht man in Deutschland nicht. Und wir sind ja auch geduldig wie die Kamele – überall sonst gibt es Proteste, wenn das Rentenalter hochgesetzt wird, nur in Deutschland herrscht Friedhofsruhe. Viele Menschen in Griechenland müssen weiterarbeiten, auch wenn sie mit 60 Jahren schon in Rente gehen. Der Sozialneid, der geschürt wurde, dass die Griechen in Saus und Braus gelebt hätten, ist einfach dummes Zeug.
Hintergrund: Viele Menschen bewegt die Frage, welche Gefahr denn nun eigentlich für den Euro und ihre Sparguthaben besteht.
Andreas Fisahn: Ich verfalle jetzt nicht in Hektik, wenn der Euro erst einmal ein wenig an Wert verliert. Er ist noch weit über dem Wert, den er hatte, als er eingeführt wurde. Noch zu Anfang der Schröder-Regierung war er weit unter dem Wert, den er jetzt hat. Und Schröder hat an der Stelle richtig eingeschätzt, dass dies den Exporten der Euroländer nützt. Dass der Euro an Wert verliert, ist nicht das entscheidende Problem. Ein Problem könnte werden, wenn außer Griechenland Spanien, Italien Portugal oder auch Irland in eine Schuldenspirale geraten und zahlungsunfähig werden. Das würde dann nicht nur ein Problem für den Euro, für die Währungsunion, sondern für die gesamte Europäische Union.
Hintergrund: Wodurch ist die Griechenland-Krise denn genau ausgelöst worden?
Andreas Fisahn: Die Griechen mussten ihren Staatshaushalt refinanzieren. Das heißt, sie mussten Kredite aufnehmen, um ihre Staatsschulden zu bezahlen. Das macht man, indem man zum Beispiel Staatsanleihen ausgibt. Auf dem Markt wird dann geguckt, wie man die Staatsanleihen loswird. Wenn das schwierig ist, muss man sehr hohe Zinsen anbieten, damit sie überhaupt gekauft werden. Die Rating-Agenturen haben nun Griechenland immer weiter runtergestuft, so dass sie immer höhere Zinsen für ihre Staatsanleihen zahlen mussten. Deutschland vergibt Staatsanleihen mit 3 Prozent Zinsen, bei Griechenland waren es zum Schluss über 10 Prozent. Dann muss immer mehr Geld aus dem Staatshaushalt aufgebracht werden, um allein die Zinsen zu bedienen – man gerät in eine Schuldenspirale. Zusätzlich wurde es für Griechenland immer schwieriger, überhaupt Staatsanleihen zu verkaufen. Was die Sache dann noch verschärft, ist der Umstand, dass diese Staatsanleihen dann auch noch versichert werden. Das heißt, wenn ich als Bank meine Staatsanleihe verliere, dann tritt diese Versicherung in Kraft. Das Problem besteht nun aber darin, dass diese Versicherungen nicht bei denen bleiben, die auch im Besitz dieser Staatsanleihen sind, sondern unabhängig davon, wie Aktien gehandelt werden, und daher ganz schnell durch die Gegend rotieren. Wenn man Staatsanleihen weiterverkauft, sinkt der Zinssatz für Staatsanleihen allenfalls sehr langsam. Wenn man aber die Versicherungen weiterverkauft, steigen oder sinken deren Preise erheblich schneller, und das wirkt wiederum auf die Kreditwürdigkeit des Staates zurück. Durch diese Versicherungen, die freihändig verkauft werden können, steigt der Zinssatz deutlich schneller, als das sonst der Fall wäre.
Hintergrund: Wer ist das denn, der diese Geschäfte tätigt?
Andreas Fisahn: Die Banken. Das ist ja auch ein wunderbares System. Deshalb haben wir im Grunde unter anderem auch unsere Banken gerettet und nicht Griechenland. Der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es nach dem Vertrag verboten, direkt Staatsanleihen von Griechenland oder anderen Staaten zu kaufen. Das machen sie zwar jetzt, aber eigentlich ist es verboten. Das System funktioniert so: Die EZB gibt Geld zu einem niedrigen Zinssatz, um 1 Prozent, beispielsweise an die Commerzbank. Die Commerzbank kauft dann griechische Staatsanleihen und bekommt dann dafür einen Zinssatz von um die 10 Prozent. Das streichen die locker ein. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell für die Privatbanken. Gleichzeitig sind das aber diejenigen, die als Gläubiger Griechenlands dastehen. Die deutschen und französischen Banken sind die wichtigsten Gläubiger der griechischen Staatsanleihen. Das heißt aber auch: Wenn Griechenland pleitegegangen wäre, hätte man wieder deutsche Banken retten müssen. Wahrscheinlich war es jetzt billiger, Griechenland zu retten. Die Alternative wäre gewesen, eine geordnete Insolvenz zu machen. Dafür gibt es noch keinen Mechanismus, aber den hätte man ja schaffen können. Geordnete Insolvenz bedeutet, dass nicht allein die Staaten und damit die Steuerzahler zahlen, sondern dass die Banken zumindest einen Teil der Verluste tragen. Das ist aber in der gegenwärtigen Machtverteilung offenbar nicht durchsetzbar.
Hintergrund: Welche Rolle spielt Deutschland in der gegenwärtigen Krisenbewältigungspolitik in Europa? Wie schätzen Sie die Wirkungen des von der Bundesregierung gerade beschlossenen Sparpakets ein?
Andreas Fisahn: Deutschland spielt eine ganz fürchterliche Rolle. Die Regierung setzt auf reine Sparpolitik. Man tut so, als ob die Krise schon bewältigt worden sei und es nun darum gehen könne, die ausgegebenen Gelder wieder einzusparen. Die USA haben das bereits scharf kritisiert. Sie sagen: „Als exportorientiertes Land mit einem Überschuss in der Leistungsbilanz könnt ihr in der Krise nicht sparen. Noch ist die Krise nicht vorbei.“ Auf der europäischen und auf der internationalen Ebene hat diese deutsche Politik bereits zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Der letzte G20-Gipfel hat das ganz deutlich gemacht. Außerdem: Wenn man sich das Sparpaket der Bundesregierung anguckt, dann fasst man sich doch an den Kopf. Wenn man überhaupt sparen kann, dann muss man doch anfangs den größeren Betrag sparen und später die kleineren Beträge. Die machen das aber genau umgekehrt. Sie fangen mit kleinen Beträgen an und später soll das immer mehr werden. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist doch wieder Augenwischerei und Irreführung des Publikums.
Hintergrund: Immer dann, wenn sich wieder eine Krise manifestiert, ist in den vergangenen Jahren ein staatliches Rettungspaket geschnürt worden, und zwar egal, wer an der Regierung war. Wie muss man das politisch bewerten? Sind solche Maßnahmen im Prinzip richtig? Greifen sie zu kurz oder was ist stattdessen zu tun?
Andreas Fisahn: Sowohl als auch. Nehmen wir einfach mal dieses Bankenrettungspaket, dass 2008/2009 installiert worden ist. Man war sich darüber einig, dass ein Krisenverlauf wie der von 1929 unbedingt vermieden werden sollte. Also hat man sichergestellt, dass weiter Kredite vergeben werden können und die produzierende Wirtschaft flüssig bleibt. Richtig war, dass man eingegriffen und Geld zur Verfügung gestellt hat, um eine Spirale nach unten zu verhindern. Falsch war es jedoch, dass man überhaupt nicht darüber diskutiert hat, ob man die Banken an den Schulden beteiligen kann. Man hat gar nicht darüber diskutiert, was es bedeutet hätte, die HRE pleitegehen zu lassen und die Gläubiger an dem Verlust zu beteiligen.
Hintergrund: Warum findet so eine Diskussion nicht statt?
Andreas Fisahn: Weil die Politik völlig überfahren wurde und man meinte, ganz schnell reagieren zu müssen. Obwohl die Krise bereits 2007 in den USA losgebrochen ist, war man überhaupt nicht vorbereitet. Der Finanzminister hat das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das den SoFFin, also den Fond zur Rettung der Banken eingeführt hat, von einer privaten Kanzlei ausarbeiten lassen. Die Entscheidungsgremien, die die Mittel des Fonds verteilen, sind folglich so zusammengesetzt, dass im Grunde Privatbanker über Steuergelder entscheiden, die im Umfang über den Bundeshalt hinaus gehen. Das sind natürlich auch Machtfragen: Wer an welcher Stelle entscheidet, wie so ein Krisenmechanismus abläuft. Die Machtfrage wurde zugunsten der Banken entschieden, die ja u.a. besser informiert waren. Diese Anwaltskanzleien, die normalerweise Banken beraten und spezialisiert sind auf Kreditgeschäfte, Versicherungsrecht, Bankenrecht usw., haben das so ausgearbeitet, dass schon in dem Fond die Machtverteilung deutlich zugunsten der Banken ausfällt. Der Vorstand im Fond besteht aus drei Leuten. Das sind zwei Banker und ein Politiker. Die Banken haben die Mehrheit gegenüber der Politik. Das ist eigentlich eine merkwürdige Konstellation. Auf Grund dieser Machtverteilung haben die Banken ihre Interessen so ziemlich eins zu eins durchgesetzt.
Hintergrund: Wenn der Machtüberhang der Banken auch mit ihrem Wissensvorsprung zusammenhängt, sehen Sie dann eine Möglichkeit, diesen Vorsprung durch institutionelle Regulierungen einzuholen?
Andreas Fisahn: Das ist im Augenblick ganz schwierig. Die gesamte deutsche Ökonomie ist auf das neoliberale Modell eingeschworen, das sich auch an den Universitäten mehr oder weniger stark durchgesetzt hat. Im Grunde müsste der Staat gegensteuern und einen gewissen wissenschaftlichen Pluralismus wiederherstellen, der Gegendiskurse zulässt, von denen die Politik letztlich profitieren würde. In den USA ist das übrigens ganz anders. Dort sind die Universitäten im Vergleich zu Deutschland deutlich pluralistischer. Die Wissenschaftler, die die Krise vorausgesehen haben und die Politik aufforderten, etwas dagegen zu unternehmen, kamen vorwiegend aus den USA.
Hintergrund: Auch für Konservative könnte es eine Option sein, in dieser Hinsicht mit Linken an einem Strang zu ziehen. Denn die Institutionalisierung solcher Gegendiskurse ist ja nicht nur im Interesse der Linken, sondern im Interesse derjenigen, die überhaupt noch Politik machen wollen.
Andreas Fisahn: Das würde ich genauso sehen. Diese Krise hat das deutlich gezeigt. Wenn man einen Mainstream hat, in dem auf allen Ebenen nur in einer ökonomischen Dimension gedacht wird, schadet das am Ende der Politik an sich gegenüber der Ökonomie.
Hintergrund: Der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel führt die momentane Staatsverschuldung nicht auf die Rettungspakete, sondern auf die angeblich exorbitanten Sozialausgaben zurück. Wie kann der so etwas sagen?
Andreas Fisahn: Das ist seine Interessenposition. Natürlich haben wir Sozialausgaben, und wenn wir den Bundeshaushalt anschauen, kann man auch sagen, dass sie ein gewaltiges Paket ausmachen. Aber Sozialausgaben entstehen ja nicht aus dem Nichts und man muss die Einnahmeseite mitbetrachten, also die Frage stellen, wer eigentlich Steuern zahlt. Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es eine deutliche Umverteilung im Steueraufkommen zugunsten der Kapital- und Einkommenssteuer und zu Lasten der Mehrwertsteuer und der Lohnsteuer, und zwar in einem exorbitanten Ausmaß. Diese Verteilung kann nicht funktionieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sowieso viel zu viel privater Reichtum angehäuft worden ist. Man bekäme die Sozialausgaben wahrscheinlich schon dadurch in den Griff, dass man über die Steuerpolitik vernünftig verteilen würde. Außerdem kriegte man es in den Griff, wenn man das Potenzial der heute Arbeitslosen nicht einfach brach liegen lassen würde. Es geht also um die Umverteilung des Reichtums und die Umverteilung der Arbeit. Dadurch würde man den Sozialhaushalt entlasten, hätte höhere Steuereinnahmen und eine geringere Staatsverschuldung.
Hintergrund: Man hört immer wieder Stimmen, die sagen: Wenn wir noch die DM hätten, wäre alles besser. Wie wäre denn heute die Situation, wenn wir tatsächlich noch nicht der Eurozone beigetreten wären?
Andreas Fisahn: Wenn man von unterschiedlichen Interessen abstrahiert, dann ist die Bundesrepublik der Profiteur des Euro. Schaut man genauer hin und differenziert, dann sind es vor allem die großen Exportunternehmen, die vom Euro profitieren. Innerhalb des Hauptmarktes Deutschlands, und der liegt in Europa, sind die Wechselkursschwankungen als Problem von Verträgen und internationalen Geschäften abgeschafft worden. Wenn ich vorher mit der DM nach Spanien exportiert habe, habe ich einen Preis ausgehandelt, wusste aber nicht, ob die Peseta oder die DM zwischendurch auf- oder abgewertet wird. Das brachte eine gewisse Unberechenbarkeit in Verträge, die eine längere Laufzeit hatten. Das ganze europäische Modell ist auf ein Wettbewerbsmodell hin angelegt, in dem alle Marktzugangsschranken beseitigt sind. Das ist im Interesse jener großen Firmen, die zum Beispiel nach Spanien exportieren. Eine Währungsunion kann aber nur funktionieren, wenn man auch eine Finanz- und Wirtschaftsunion schafft, das heißt, die Steuersätze angleicht und annähernd gleiche Lebensverhältnisse herstellt. Durch die bestehenden Strukturfonds der EU werden die Leistungsbilanzunterschiede zwischen den Staaten aber nicht genügend aufgeknackt. Nur dann aber wäre die gemeinsame Währung wirklich funktionsfähig. Im Augenblick passiert aufgrund des Drucks von Deutschland aber gar nichts in diese Richtung. Es geht nur noch ums Sparen, Sparen, Sparen.
Hintergrund: Würden Sie sich zutrauen, eine Prognose über den weiteren Verlauf der Krise zu geben? Sind wir an irgendeinem Scheidepunkt angelangt, der darauf hinausläuft, die bisherige Form der Finanzmärkte zu beenden? Ist der Euro an sein Ende gelangt oder gar der Kapitalismus? Wo stehen wir im Moment?
Andreas Fisahn: Ich würde sagen, dass es drei oder vier verschiedene Entwicklungsmodelle gibt. Das eine Entwicklungsmodell ist mehr oder weniger das japanische. Das heißt, die Krise schleppt sich mit halbwegs abgesicherten sozialen Folgen mindestens noch ein Jahrzehnt hin. Das halte ich für nicht sehr unwahrscheinlich. Wir können nicht mit exorbitanten Wachstumsraten rechnen, abgesehen davon, dass das auch ökologisch nicht sinnvoll wäre. Die zweite Variante sieht so aus: Der Schuldenstand bleibt vor dem Hintergrund des weiter existierenden neoliberalen Wirtschaftsmodells mit einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich gleich, aber man kriegt eine Regulation der Finanzmärkte hin, die ein Hauptauslöser der Finanzkrise und der vorausgehenden Spekulationskrisen waren, weil über die Finanzmärkte beliebig viel Geld um den Globus herumgeschoben werden kann und nicht mehr kalkulierbare Spekulationen betrieben werden können. Die dritte Variante lautet: Die Krise verschärft sich extrem. Dann sind wiederum zwei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten gegeben. Das eine wäre eine autoritäre Lösung, die dem historischen Faschismus nicht gleichen muss und außerdem nicht nur auf Seiten der Armen, sondern auch auf der der Kapitaleigner greifen müsste. Die andere Lösung wäre die Durchsetzung eines alternativen Gesellschaftsmodells mit einer solidarischen Ökonomie, die gesellschaftlich-demokratisch reguliert wird – wobei ich dafür angesichts der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse allerdings keine großen Chancen sehe.
Hintergrund: Sie haben gerade das Thema Spekulation angerissen. Wie verhält sich die gegenwärtige Spekulation auf den Finanzmärkten zu der Möglichkeit, Politik zu machen? Werden die Regierungen derzeit handlungsunfähig gemacht?
Andreas Fisahn: Das ist natürlich mehr oder weniger ein selbst gemachtes Leiden. Auf der einen Seite sagt die Welthandelsorganisation (WTO): Ihr müsst eure Finanzmärkte für alle möglichen Finanzdienstleistungen öffnen. Auf der anderen Seite sind Kapitalverkehrskontrollen nicht mit den europäischen Verträgen vereinbar. Alle Möglichkeiten der Regulierung reiben sich momentan an dem gültigen EU-Recht. Sie sind nicht in jedem Fall verboten, würden aber – wollte man sie einführen – mindestens auf rechtliche Schwierigkeiten stoßen.
Umgekehrt heißt das aber auch, dass die unbeschränkten Finanzmärkte nicht von allein entstanden sind, sondern seit Mitte der 1970er Jahre politisch gewollt und gemacht worden sind. Die Europäischen Verträge sagen explizit: Ein Rückschritt der Liberalisierung gegenüber Drittstaaten bedarf des einstimmigen Entschlusses innerhalb des Europäischen Rates. Es gibt also ein Liberalisierungsrückschrittsverbot. Die Politik hat sich selbst Fesseln angelegt.
Hintergrund: Woran liegt es denn, dass diese Fehler gemacht wurden? Ist es die ökonomische Inkompetenz der Politiker angesichts einer immer komplexer scheinenden ökonomischen Wirklichkeit? Oder ist es eine bewusste Parteinahme für bestimmte Interessen? Die Deregulierungspolitik wurde auf Seiten der SPD und der Grünen ja von einer Politikergeneration mitgetragen, die zum Teil durchaus über zumindest rudimentäre ökonomische Kenntnisse marxistischer Prägung verfügte.
Andreas Fisahn: Da kommt Verschiedenes zusammen. Es hat einen Wandel der ökonomischen Anschauungen gegeben. Die These, dass der Weltmarkt allen Vorteile bringe, hat sich durchgesetzt. Die deutschen Exportunternehmen haben ein Interesse an offenen Märkten. England hat ein noch deutlicheres Interesse an deregulierten Finanzmärkten. Der Deregulierungsprozess reicht weit hinter Rot-Grün zurück. Nachdem Margaret Thatcher die Finanzmärkte für England geöffnet hatte, waren die Weichen gestellt. Das Ganze war begleitet von einer Ideologie, bestimmten Interessen und schließlich dem Wegfall der Systemkonkurrenz im Osten. Deshalb kann man jetzt auch nicht sagen: Wir machen einen Politikwechsel und steuern innerhalb von vier Jahren alles wieder um. Das ist unrealistisch, solange man nach den geltenden Spielregeln dieser Gesellschaft handelt und etwas anderes ist derzeit ja gar nicht sichtbar. Deshalb wird man wahrscheinlich auch wieder mehrere Jahrzehnte brauchen, bis man umgesteuert hat. Das subjektive Versagen der Politiker von Rot-Grün besteht deshalb auch nicht darin, dass sie keinen vollständigen Kurswechsel durchgesetzt, sondern eher darin, dass sie die liberalkonservative Politik der Deregulierung sogar noch verstärkt und weiter vorangetrieben haben.
Hintergrund: Haben wir angesichts der ökologischen Krise überhaupt noch genügend Zeit für ein so allmähliches Umsteuern, das Jahrzehnte dauern würde?
Andreas Fisahn: Das ist tatsächlich ein Dilemma. Aber selbst wenn es unmittelbar zu einem revolutionären Umschlag kommen könnte, hätten wir noch keine halbwegs geschlossenen Alternativmodelle, wie die Gesellschaft organisiert werden könnte. Daher wird es nicht anders als durch ein allmähliches Umsteuern gehen können. Die Menschen brauchen Zeit, um sich in diesen Prozess demokratisch einzuschalten. Es kann sein, dass wir dafür nicht genug Zeit haben. Aber vielleicht heißt es, dass wir unter anderen Bedingungen werden leben müssen.
Hintergrund: Was hat denn nun aber Demokratie mit Ökonomie zu tun – das eine ist doch Politik und das andere Wirtschaft? Nach Ansicht des einflussreichen Soziologen Niklas Luhmann sind das doch völlig voneinander getrennte Systeme?
Andreas Fisahn: Die Frage ist doch, ob man das akzeptieren muss. Luhmann tut ja nur so, als würde er das bloß beschreiben. In Wirklichkeit formuliert er die Aufforderung, dass es bei dieser Trennung bleiben solle. Wenn man das Versprechen der Demokratie ernst nimmt, dann heißt das, dass die Gesellschaft selbst über ihre Entwicklung und die Frage entscheidet, wie die Menschen leben wollen. Wenn sie zum Spielball von Märkten wird, kann sie das aber nicht. Wenn man das Versprechen der Demokratie ernst nimmt, ist die Politik dazu gezwungen, die Steuerung von wirtschaftlichen Prozessen vorzunehmen. Luhmanns Analyse ist ja schon deshalb nicht richtig, weil die Politik bei der Öffnung der Märkte, bei ihrer Deregulierung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Diese Trennung von Politik und Ökonomie ist insofern also falsch.
Hintergrund: Wie kann dann aber eine demokratische Steuerung der Ökonomie aussehen?
Andreas Fisahn: Meiner Ansicht nach zeigt die Erfahrung der realsozialistischen Staaten deutlich, dass man das nicht nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam machen kann. Denn für eine zentrale Planung ist das System dann doch wiederum zu komplex. Die notwendigen Informationen müssen auf der gesellschaftlichen Ebene demokratisch verarbeitet werden.
Hintergrund: Haben sich vor dem Hintergrund der Entwicklung der Informationstechnologie die Voraussetzungen für eine vernünftige zentrale Planung nicht wesentlich verbessert gegenüber dem Stand vor 20 Jahren?
Andreas Fisahn: Diese Diskussion gibt es. Ich halte sie aber nicht für besonders realistisch. Die Informationstechnologie kann ja immer nur das verarbeiten, was an Informationen überhaupt da ist. Informationen über Bedürfnisse, Interessen, Präferenzen müssen jedoch erst generiert werden, und das können die Computer nicht selbst tun. Natürlich lassen sich bestimmte Prozesse heute besser vorausberechnen und modellieren. Aber die Informationsgenerierung muss in der Gesellschaft selbst geschehen. Das können die Computer nicht übernehmen.
Hintergrund: Und die Informationsgenerierung in der Bevölkerung wäre nun durch Befehls- und Gehorsamsbeziehungen eingeschränkt?
Andreas Fisahn: Ja, genau.
Hintergrund: Wie sollten die politischen und ökonomischen Strukturen denn Ihrer Ansicht nach verändert werden?
Andreas Fisahn: Es geht darum, die Europäische Union zu demokratisieren. Das Parlament muss als Ort der Repräsentation der unterschiedlichen Interessen aufgewertet, der Rat dagegen entmachtet werden. Dann müssen die Finanzmärkte reguliert werden, damit man politische Steuerungsmöglichkeiten zurückgewinnt. Schließlich geht es um die Frage, wie man die Ökonomie solidarischer und demokratischer gestalten kann. Dafür wurden in der Geschichte der Arbeiterbewegung verschiedene Modelle diskutiert, die aber nie verwirklicht worden sind. Ich möchte aber noch eines vorwegsagen: Es geht jetzt nicht darum, nur über die Eigentumsformen zu diskutieren. Das ist zwar auch ein wichtiger Punkt, weil die Eigentumsformen eine bestimmte Handlungslogik vorgeben, aber nicht der allein entscheidende. Mir geht es um eine alternative Logik, die nicht nur eine Frage der Eigentumsform, sondern eine der gesellschaftlichen Steuerung ist. Darüber wird auch in der Partei Die Linke zu wenig diskutiert. Komplexe Gesellschaften bedürfen eines komplexen und differenzierten Steuerungsmechanismus. Die linke Diskussion muss in dieser Hinsicht einiges aufarbeiten und weiterentwickeln. Das ist auch nicht verwunderlich, denn wir haben nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus im Osten 20 Jahre lang nicht über Alternativen diskutiert.
Hintergrund: Können Sie denn ein paar Hinweise für mögliche institutionelle Veränderungen geben?
Andreas Fisahn: Auf der ökonomischen Ebene gab es die schwedischen Sozialfonds. Da wurde von „den Sozialpartnern“ eingezahlt in Fonds, die von den Gewerkschaften verwaltet werden, mit denen sich Gewerkschaften Anteile an Unternehmen kaufen oder eigene gründen konnten und ihre gewerkschaftlichen Interessen und Vorstellungen in die Unternehmen miteinfließen lassen konnten. Das ist von der bürgerlichen Regierung in Schweden wieder abgeschafft worden. In der Weimarer Republik gab es in der Verfassung sogenannte Wirtschafts- und Sozialräte, die normativ eine große Bedeutung hatten. Sie sollten wichtige regionalpolitische Entscheidungen treffen oder abstimmen und hatten Mitentscheidungsrechte bei Gesetzgebungsverfahren, die die Ökonomie betrafen. Diese Räte haben deswegen nicht funktioniert, weil die Unternehmer sich geweigert haben, sich mit den Gewerkschaften an einen Tisch zu setzen. Aber die Idee war gut, um auf regionaler Ebene eine Abstimmung unterschiedlicher Interessen und einen Prozess der Machtumverteilung in Gang zu setzen. Man sollte auch über das Modell der Mitbestimmung neu nachdenken, weil die Gewerkschaften in den Betriebs- und in den Aufsichtsräten mehr oder weniger in der Falle sitzen. Sie müssen darin ja immer in der Logik des Einzelunternehmens entscheiden. Der Fall Opel hat gezeigt, dass sie sogar in ein und derselben Firma in einem Standortwettbewerb untereinander stehen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Firma mit anderen Firmen ohnehin in einem Wettbewerb befindet. Deshalb müsste man überlegen, ob man an dieser Stelle die Räte von den direkten Interessen des Unternehmens und seiner Beschäftigten entkoppelt. Es wäre zum Beispiel zwingend notwendig, ökologische Interessenvertreter in die Aufsichtsräte und am besten auch in die Vorstände hineinzubringen. Das wäre für mich auch ein Moment der Demokratisierung.
Hintergrund: Wer könnte solche Reformprozesse denn in Gang setzen? Können Sie dafür schon Trägergruppen ausmachen? Früher hat man ja auf die Industriearbeiter gesetzt.
Andreas Fisahn: Hans Jürgen Urban, Mitglied im Vorstand der IG Metall – wenn ich mich da nicht irre – hat in der Zeitschrift Sozialismus einen schönen Artikel geschrieben, in dem es um die Mosaik-Linke als Perspektive geht. Aufgrund der derzeitigen Differenzierung der Gesellschaft sei es unsinnig, ein einheitliches, am besten homogenes historisches Subjekt suchen zu wollen, den Akteur auf Seiten der gesellschaftlichen Linken. Man müsse also eine Mosaik-Linke denken, in die sehr verschiedene Interessen und Perspektiven einfließen, die allerdings gebündelt, abgestimmt und vernetzt werden müssen.
Hintergrund: Der Begriff Mosaik-Linke hört sich aber nicht sehr gefährlich an. Er klingt sehr bunt und postmodern, aber nicht schlagkräftig.
Andreas Fisahn: Aber von der Buntheit kommen wir nicht weg. Es stimmt, dass die Linke im Moment nicht sehr gefährlich ist. Gerade deshalb muss man weiter für seine Vorstellungen und Ideen kämpfen. Konstantin Wecker lässt das seinen Willy sehr schön sagen: „Weiterkämpfen, Wecker, auch wenn die ganze Welt den Arsch offen hat, oder grad deswegen!“ Das wird aber nur über ein ausdifferenziertes und von mir aus auch postmodernes Konzept funktionieren: ein Mosaik-Puzzle, das zusammengesetzt wird zu einem Gesamtbild.
Das Gespräch führte Thomas Wagner. Es erschien zuerst in Hintergrund Heft 4/2010.