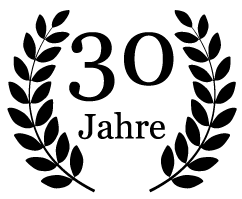Die Farce der griechischen Schulden – Geschichte einer Umverteilung zugunsten der Reichen
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von KUNIBERT RAFFER, 17. Januar 2012 –
Unter bürgerkriegsähnlichen Umständen wurde im griechischen Parlament das letzte Belastungspaket durchgeboxt und dadurch der Weg für weitere „Hilfskredite“ frei gemacht. Das bereits schwer überschuldete Griechenland erhält weitere Kredite – ein Vorgang, der in vielen nationalen Rechtssystemen als Insolvenzverschleppung unter Strafe steht. Ökonomisch ist die Sachlage klar: ein Verhältnis Schulden zu BIP wie in Griechenland ist nicht abtragbar. Als Argentinien 2001 die Zahlungen einstellte, war dieser Wert fast Maastricht-konform, 63 Prozent. Als IWF-Mitarbeiter im Juli 2001 eine Schuldenreduktion von 15 bis 40 Prozent als notwendig ansahen, lag er bei gut 50 Prozent. Selbst aus Bankkreisen wurde schon im Februar 2010 die Halbierung der griechischen Schulden vorgeschlagen. Dennoch erfolgte ein voller Bail-out, und die EU verschlimmert die Katastrophe, an deren Entstehen sie durch Tolerieren des griechischen Statistikbetrugs bei Euroeintritt maßgeblich beteiligt war, zu Lasten der Griechen und der eigenen Steuerzahler weiter. Während EU-Bürokraten und offenbar überforderte Politiker vom Schlamassel profitieren, zahlt die Bevölkerung Griechenlands und der „Retterstaaten“ die Zeche.
Hysterische Äußerungen und Aktivitäten kennzeichnen die EU-Politik. Absurdeste Behauptungen und Politikentscheidungen zugunsten der Krisenverursacher begleiten Europas Schuldenkrisen: die Insolvenz eines Eurolandes würde den Euro zerstören, oder Insolvenzen der Problemschuldner ließen sich abwenden. Griechenland zeigt mittlerweile klar, dass Letzteres nicht stimmt.
Die Behauptung, man müsse den Euro und die EU durch die Sozialisierung des Gläubigerrisikos retten, ist nachweisbar falsch. In den USA ist derzeit eine erkleckliche Anzahl von Bundesstaaten mehr oder weniger bankrott – Kalifornien ist nur in Europa am bekanntesten. Sowohl die USA als auch der US-Dollar existieren noch und scheinen dadurch nicht gefährdet. Im Unterschied zur EU übernimmt Washington die Verluste und Probleme der Gläubiger nicht. Allerdings zahlte die Treasury Milliarden an 32 Staaten, damit diese die Arbeitslosenunterstützung weiter auszahlen konnten.
Im Fall Griechenlands sofort eine geordnete Insolvenz (zumindest de facto) durchzuführen, wäre angezeigt gewesen. EU-Geld hätte dazu verwendet werden können, das Land bis zur Beruhigung der Kapitalmärkte zu finanzieren. Dies wäre nicht nur besser, sondern auch bedeutend billiger gewesen als der „Schutzschirm“. Spekulanten wäre die Lust an der Spekulation gegen weitere Eurostaaten vergangen. Da Europas Banken den Stresstest laut EU so hervorragend bestanden hatten, wären Bankenrettungen wohl nicht notwendig. Falls aber doch, hätte der Staat diese mit Gewinn durchführen können.
Das einzig erkennbar Rationale ist der Griff in die Taschen der Steuerzahler, um im offenen Bruch des Lissabon-Vertrags Spekulanten und Banken mit öffentlichen Geldern zu verwöhnen. Schon die Wortwahl – vor allem „Beteiligung des Privatsektors“ – ist absurd und in anderen Schuldverhältnissen undenkbar. Werden etwa im Falle des Konkurses eines Gemüseladens die Gläubiger durch staatliche Gelder schadlos gehalten, und ist dort ihre „Beteiligung“ (sprich Forderungsverlust) bestenfalls auf „freiwilliger Basis“ denkbar? Oder müssen diese eben ihren Verlust tragen? Eine lächerliche Frage, die sich ohne die Zumutung des derzeitigen „Schuldenmanagements“ der EU gar nicht stellen könnte.
Europa und Lateinamerika im Vergleich
Ein Vergleich mit Lateinamerika macht besonders klar, wie absurd selbst ernannte Retter des Euro, der EU, wenn nicht gar – nach Selbsteinschätzung – der Welt, derzeit agieren. Jüngst verglich Staranwalt und Schuldenspezialist Lee Buchheit, der im Wesentlichen in jede größere Umschuldung seit 1982 involviert war, Europa und Lateinamerika. Auch 1982 kamen die überexponierten Wall-Street-Banken, die es sträflich leichtsinnig unterlassen hatten, Risikovorsorge aufzubauen, nach Washington, um einen Bail-out zu verlangen: Steuergeld sollte nach Mexiko fließen, damit die Banken schadlos bleiben würden. Der US-Finanzminister lehnte dies ab. Die Banken mussten weitere Kredite geben, bis sie nach einigen Jahren stark genug waren, den „Haarschnitt“ („haircut“) zu verdauen. Die Literatur spricht von der Periode des „forced lending“, wobei der öffentliche Sektor in Form des IWF durchaus seine Forderungen aufbaute, allerdings in einem im Vergleich zu Griechenland kleinen Umfang. Immerhin betrug der Verlust der Kommerzbanken schließlich bei Mexiko 35 Prozent oder bei Ecuador 45 Prozent. Auch diese sogenannten Brady-Deals waren „freiwillig“, auch wenn der Freiwilligkeit durch US-Behörden oder der Fed schon mal auf die Sprünge geholfen wurde. Erst nach langem Lavieren beginnt die EU ebenso bei Griechenland auf freiwillige Bankenbeteiligung zu setzen – mit bislang mäßigem Erfolg.
Als Uruguay 2003 nicht länger zahlen konnte, bewog dies seine Privatgläubiger, einer Umstrukturierung der Schulden zuzustimmen. Die Alternativen wären schmerzhafter gewesen. Monate später hatte Uruguay schon wieder Zugang zu den Kapitalmärkten. Trotz der Einschränkungen des US-Rechts, das bei Änderungen der Zahlungsbedingungen Einstimmigkeit erzwingt, wurden Umschuldungen gegen Minderheiten durchgeführt, etwa in Ecuador. Das im Detail juristisch etwas komplizierte Instrument waren sogenannte exit consents. All dies geschah ohne die absurde und die Staatskassen schädigende Geschäftigkeit der EU. Es stellt sich die Frage, warum die EU nicht einfach aus der Geschichte lernt. Warum schützt sie die Gläubiger noch mehr als die USA? Gerade im Fall Griechenlands unterliegt außerdem der größte Teil der Schulden griechischem Recht, ein Vorteil den Lateinamerika nicht hatte. Der Gesetzgeber könnte das Schuldrecht ändern. Würde die Drachme wieder eingeführt, so müssten alle Eurobeträge im Land umgerechnet werden. Es ist keineswegs undenkbar, dass dies auch bei dem Inlandsrecht unterliegenden Schulden erfolgen könnte, zumindest wird dies bei Standard & Poor‘s als möglich erachtet.
Trotz der viel besseren Situation Griechenlands, werden die Gläubiger zulasten des öffentlichen Budgets und der Steuerzahler geschont. Man gibt sich kapitalfreundlicher als die USA. Investoren erhalten von Europroblemländern höhere Zinsen, aber ihre Verluste werden durch die öffentliche Hand abgedeckt. Im Ausgleich dafür „muss“ bei Staats- und insbesondere Sozialausgaben gespart werden. Der Bail-out animiert gefahrlose Spekulation und setzt den grundlegenden Marktmechanismus außer Kraft. Hohe Risikoaufschläge ohne Risiko. Die EU bezahlt alles – eine Einladung für weitere Länder zu spekulieren, die nur zu gerne angenommen wurde. Auch Zocken mit griechischen Schuldtiteln kann profitabel sein.
Zumindest in Griechenland betreibt die EU lediglich Insolvenzverschleppung. Dabei wird privates Geld widerrechtlich zunehmend durch öffentliches ersetzt. Am 15. Juni titelte die Financial Times Deutschland: „Deutsche Banken laden Hellas-Bonds am Markt ab“. Allein deutsche Banken hatten Forderungen in Milliardenhöhe zeitgerecht abgesetzt. Auch Banken aus anderen Ländern werden dies wohl getan haben. Die EU, die schon den Statistikbetrug Griechenlands tolerierte und deckte, verschlechterte die Lage aller außer die der Anleger und einiger Bürokraten und Politiker, die sich derzeit als Retter Europas gerieren. Die verhängnisvollen „Rettungsaktionen“ haben sogar die Bonität von Institutionen angekratzt, die bislang als Bollwerke der Stabilität galten. Die Forderungen der Bundesbank gegen das „Euro-System“ sind in der Krise schnell gewachsen. Die EZB wurde zur EBB (European Bad Bank), indem sie dubiose Anleihen aufkaufte. Die Krise lässt die risikolosen, weil öffentlich garantierten Renditen hinaufschnellen. Weil Staaten ihre Banken retten, leidet ihre eigene Bonität. Der gerettete Finanzsektor erklärt nun seine Retter wegen der Rettungskosten zu Sanierungsfällen. Der österreichische Finanzminister begründete sein Sparbudget damit, dass sonst die Rating-Agenturen das Land herabstufen würden; jene Agenturen, die Giftpapiere (subprime) in den USA mit AAA bewertet hatten, was die gegenwärtige Krise zumindest mit auslöste, und gegen deren bisher durch Gesetze und Regulierung verstärkten Einfluss in Europa nichts unternommen wurde. Übrigens wurde auch Griechenland über lange Zeit AAA geratet, was den Verschuldungsprozess unterstützte. Obwohl die Notwendigkeit einer europäischen Agentur oft betont und deren Fehlen beklagt wurde, gibt es sie noch immer nicht. China hat mittlerweile eine neue, international arbeitende Rating-Agentur. Europa beugt sich dagegen nun noch mehr dem „Urteil“ der US-Agenturen, bis hin zum Funktionieren des rechtswidrigen Rettungsschirms, zu „Bargeldpuffern“ und „Übergarantien“ der European Financial Stability Facility (ESFS), die stolz auf ihr „Top-Rating“ bei den namentlich angeführten Subprime-Bewertern verweist. Spät aber doch beginnt man zwar nun in Europa, verbal etwas lauter gegen die Rating-Agenturen zu wettern, sogar eine europäische Agentur taucht wieder in den Medien auf. Unerwähnt bleibt, dass die Macht der Agenturen auf Gesetzen und Vorschriften beruht, die an ihr Rating konkrete Rechtsfolgen knüpfen. Es wäre recht einfach, dies sofort zu ändern. Dazu bedarf es nur einiger weniger Gesetzesänderungen, an die aber offenbar niemand von den Zuständigen denkt. Täte man dies, wäre weitere Geldverschwendung kaum noch „argumentierbar“. Hätte die EZB nicht selbst und ohne Zwang den Rating-Agenturen bei der „Kreditqualitätsschwelle“ ihres Sicherheitenrahmens des Eurosystems nicht so viel Bedeutung eingeräumt, so wäre die spektakuläre Suspendierung dieser Mindestanforderung für irische und griechische Papiere gar nicht erst nötig gewesen. Auch die Aufmerksamkeit erregende Erklärung, man werde griechische Staatspapiere weiter akzeptieren, solange diese nicht von allen Agenturen als „defaulted“ bewertet werden, wäre unnötig, hätte die EZB diesen Agenturen nicht selbst so viel Bedeutung eingeräumt. Nun zittert man, ob die Agenturen eine freiwillige Umschuldung auch akzeptieren würden – eine Angst, die mit kleinen Gesetzesnovellen oder wenn die neue Wertpapieraufsicht ESMA den US-Amerikanern die Zulassung in Europa keine Zulassung erteilte, da diese die geforderten, ausführlichen Unterlagen nicht einreichten, als Problem gelöst wäre. Man bräuchte nur europäische Gemeinwohlinteressen zu verteidigen.
Krisenpolitik als neoliberale Umverteilungspolitik
Die durch neoliberale Politik verursachte Krise „rechtfertigt“ nun eine verstärkt neoliberale Politik. Man könnte den Austeritätskurs vielleicht akzeptieren, wären die Budgetprobleme durch öffentlich finanzierten Luxus (Champagner für Arbeitslose) entstanden. Wie gerade Irland zeigt, waren die Budgets gesund, sogar sehr gut bis zur Sozialisierung der Spekulationsverluste und Bankerboni. Die Austeritätspolitik dient der Umverteilung von der Allgemeinheit zu Spekulanten, wie sie J.K. Galbraith in seinem Buch The Predator State beschreibt – ein Griff in die Taschen der Allgemeinheit. Außerdem werden nun Geldstrafen gegen Defizite gefordert, institutionalisiertes Bußgeld für Keynesianismus. Man ächtet das Modell, das nach 1945 eine historisch einmalige Ära breiten Massenwohlstands ermöglichte. Schließlich verlangte EZB-Chef Trichet ein europäisches Finanzministerium, das mit dem letzten wesentlichen Recht nationaler, demokratisch gewählter Parlamente zugunsten der Bürokratie Schluss machen soll, dem Budgetrecht. Damit wäre die Demokratie in Europa endlich endgültig erledigt.
Die Analyse der Krisen zeigt ein differenziertes Bild. Griechenlands Krise entstand durch Betrug, offenbar mit Duldung oder Beihilfe Brüssels. Statistikfälschungen dieser Dimension bleiben Experten nicht verborgen. Griechenlands ungerechtfertigte Euromitgliedschaft ermöglichte zu billige Kredite und weiterhin extrem lasche Steuereinhebung, wobei auch das gute Rating damals und die Kapitalgewichtung (keine Kapitalunterlegung) der Basel-Normen hilfreich waren. Erst die Sozialisierung privater Spekulationsverluste brachte Irland in Schwierigkeiten, nicht ausufernde Sozialleistungen. Logischerweise darf Irland auch unter EU-Diktat den niedrigen Steuersatz für Investoren behalten, um nicht die Falschen zur Kasse zu bitten. Offenbar muss verhindert werden, dass die Krise Millionäre statt Hartz-IV-Bezieher trifft. Konsequenterweise verteidigt die deutsche Regierung Millionenboni bei der Hypo Real Estate oder im Falle der Commerzbank, auch wenn die Bank die Zinsen für die stille Einlage des Staates nicht zahlt. Auch in Österreich zahlen viele Banken keine Zinsen für das staatliche Rettungsgeld. Die Verträge wurden unerklärlicherweise so errichtet.
Ein Vergleich mit den USA, die ebenfalls viel Geld in die Bankenrettung steckten und neoliberal agieren, mag überraschen. Ende 2008 erhielt Citigroup 45 Milliarden US-Dollar an Rettungsgeld. 2010 stieg der Staat wieder aus, mit etwa 12 Milliarden US-Dollar Gewinn, zweifellos eine angemessene Rendite. Das US-Finanzministerium wies im März 2011 Gewinne von 37 Milliarden US-Dollar aus Bail-outs aus. Verträge und Entscheidungen unserer Politiker bewirken, dass Bankenrettung in Europa kein vergleichbar gutes Geschäft ist, sondern die Budgets enorm belastet.
Notwendigkeit eines Staatsinsolvenzverfahrens
Ist es wirtschaftlich unmöglich, alle Forderungen zu befriedigen, und sind im Gegensatz zu einer temporären und finanziell überbrückbaren Illiquidität Forderungskürzungen unvermeidlich, ist eine Lösung, die die Verluste und Probleme aller Beteiligten minimiert, wirtschaftlich besser und gerechter. In der Praxis hat sich über Jahrhunderte ein Verfahren herausgebildet, das sich zwar in Details und sogar in der Ausrichtung (gläubigerfreundlicher – schuldnerfreundlicher) je nach nationalem Recht unterscheidet, sich jedoch in den essenziellen Punkten gleicht. Auch ohne formelles Verfahren setzt sich die ökonomische Realität stets durch, wie die Geschichte der Staatsverschuldung zeigt. Selbst im 19. Jahrhundert, als Gläubiger Militärinterventionen veranlassen oder ein Land in Zwangsverwaltung übernehmen konnten, war dies nicht anders. Letztlich ging ein Teil der Nominalforderungen verloren; die Frage war stets nur, wann diese Realität akzeptiert würde. Auch Gläubigerzwangsverwaltung änderte nichts. Dies wird auch in Europa bereits sichtbar. Schon Adam Smith empfahl übrigens Staatsinsolvenz als die für alle Beteiligten beste Lösung
Die Erfahrung, die beim Schuldenmanagement im globalen Süden gewonnen wurde, wird in sträflicher Weise nicht genutzt, sondern es werden dieselben Fehler nochmals gemacht. Dass nicht die Beteiligten, sondern die Steuerzahler die Zeche begleichen müssen und Politiker davon profitieren, mag dies erklären.
Es stellt sich die Frage, wie ein Insolvenzmodell konkret aussehen soll. Es ist klar, dass ein insolventer Staat nicht wie eine konkursreife Firma aufgelöst werden kann und soll. Es kommt nur ein Ausgleichsverfahren infrage, welches das Weiterbestehen des Schuldners garantiert.
Schon im Februar 2010 wurde von Gros und Mayer (der zweite Autor war und ist noch immer Chefökonom der Deutschen Bank) ein Haarschnitt Griechenlands im Ausmaß von 50 Prozent vorgeschlagen. Die restlichen 50 Prozent würden durch eine öffentliche Institution garantiert, hinter der die EU-Staaten stünden (eigentlich, so die Autoren, die finanziell potenten EU-Staaten). Gegen eine, bei 50 Prozent sicher recht hohe, Gebühr tauschen Gläubiger schlechte gegen gute Forderungen. Verglichen mit dem rechtswidrigen 100-Prozent-Bail-out ist der Gros-Mayer-Vorschlag in jeder Hinsicht exzellent und nahezu selbstlos. Der Abtausch Verluste gegen Sicherheit ist ökonomisch diskutierbar. Abhängig vom konkreten Tauschverhältnis kann er sogar sehr gut sein. 50 Prozent scheinen ein ehrliches Angebot zu sein.
Der Bruegel-Vorschlag einer Staatsinsolvenz, an dem Anne Krueger (früher die Nummer 2 im IWF) mitwirkte, sieht Zwangsverwaltung als mit Demokratie unvereinbar an. Rechtsstaatlich korrekt schlägt er eine neutrale Institution als Entscheidungsinstanz vor. Dies ist prinzipiell korrekt, auch wenn beim konkret vorgeschlagenen Gerichtshof der Europäischen Union, einer EU-Institution, starke Zweifel an seiner ausreichenden Neutralität und Unbeeinflussbarkeit angebracht erscheinen. Das derzeitige Vorgehen gegenüber Griechenland wäre mit dem Bruegel-Vorschlag jedenfalls nicht vereinbar. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat explizit das Recht von Staaten anerkannt, sich von exzessiven Schulden durch Bankrotterklärung zu befreien. Dies verweigert die deutsche Regierung Griechenland, einem Land, das Deutschland 1953 mehr als die Hälfte seiner Schulden ohne Auflagen erließ.
Der Raffer-Vorschlag
Für souveräne Staaten wie auch für öffentlich-rechtliche Schuldner mit Hoheitsgewalt eignet sich nur ein Modell, das neben dem angemessenen Schutz der Souveränität Grundpfeiler jeglichen Insolvenzrechts enthält: Rechtsstaatlichkeit, Schuldnerschutz, Wahrung der Gläubigerinteressen. Mein Vorschlag übernimmt die wesentlichen Punkte des Verfahrens für öffentliche Schuldner unter der Ebene der Bundesstaaten in den USA, das sogenannte Chapter 9, Title 11, US Code, ein eigenes Insolvenzverfahren für öffentlich-rechtliche Schuldner (sogenannte municipalities), dessen Ausweitung auf Bundesstaaten in den USA derzeit diskutiert wird, allerdings ohne die offizielle, unangebrachte und irrlichternde Aufgeregtheit der EU. Ob sich diese Idee durchsetzen kann, bleibt abzuwarten, denn derzeit genießen die Bundesstaaten kraft des 11. Verfassungszusatzes quasisouveräne Immunität. Insbesondere Ausländer dürfen nicht auf Zahlung klagen, die Union oder andere Bundesstaaten aber schon. Als Gläubiger dies umgingen, indem sie bei Staats- und nicht bei Bundesgerichten klagten und Recht bekamen, ignorierten die betroffenen Staaten dies einfach. Offenbar hat dieses Verhalten die US-Bundesstaaten nicht für immer vom Kapitalmarkt abgeschnitten.
Die Adaptierung dieses Chapter 9 – der Raffer-Vorschlag, von NRO wie der Jubilee-Bewegung oder erlassjahr.de auch FTAP (Fair Transparent Arbitration Procedure) genannt – schützt die Hoheitssphäre des Schuldners, gibt der Bevölkerung ein Anhörungsrecht und behandelt die Gläubiger fair. Wie jedes gute Insolvenzrecht muss es auch im besten Interesse der Gläubiger sein. Das Anhörungsrecht der Bevölkerung ist ein demokratisches Element, das für die EU und den IWF absolut tabu ist, im Unterschied zu einem autoritären EU-Superfinanzministerium, das demokratisch legitimierte Parlamente ausschalten soll.
Alle Insolvenzverfahren werden von einem unabhängigen und absolut unbefangenen Gremium, dessen Mitglieder keinerlei Eigeninteresse in der Sache haben dürfen, geleitet. Im Inland sind dies Gerichte. International empfiehlt sich Schiedsgerichtsbarkeit, ein traditionelles Instrument des Völkerrechts. Nur so kann der Grundpfeiler jeglicher Rechtsstaatlichkeit gesichert werden, dass niemand in eigener Sache richten darf. Dies wird bei Schuldnerstaaten gröblichst verletzt. Die traurigen Ergebnisse gläubigerdominierten „Schuldenmanagements“ unterstreichen diese Notwendigkeit klar.
Der Schuldnerschutz hat im Chapter 9 zwei Komponenten: Municipalities dürfen, ja, müssen grundlegende Dienste (etwa im Sozialbereich) sowie das Anhörungsrecht der Betroffenen im Verfahren aufrechterhalten. Bei Staaten müsste dies (wie übrigens auch im Chapter 9 als Möglichkeit vorgesehen und von mir 1987 vorgeschlagen) durch Repräsentation ausgeübt werden. Gewerkschaften, Unternehmerverbände, NRO oder etwa UNICEF könnten die Sicht der Bevölkerung darlegen. Dieses Minimum an Demokratie sollte selbst in der EU möglich sein. Privatisierungen unter Druck wie derzeit in Griechenland, die zu Verkäufen weit unter dem Marktwert zwingen, wären nicht möglich. Eine Verschleuderung des Schuldnervermögens zugunsten einiger weniger Käufer, die auch bei Griechenland profitieren würden, ist weder ökonomisch noch ethisch zu rechtfertigen, auch nicht, wenn man prinzipiell, aber ehrlich für Privatisierung (im Unterschied zum Beutemachen) eintritt. Zwar ist es absolut gerechtfertigt, von Schuldnern den Verkauf von Vermögen zu verlangen, um Gläubigerforderungen besser befriedigen zu können, doch darf das nicht zur Plünderung des Volksvermögens des Schuldnerlandes führen.
Alle Forderungen außer Krediten, die Schuldner während des Verfahrens finanzieren, müssen gleich behandelt werden. Nicht nur der Privatsektor, auch der öffentliche Sektor muss endlich dem Marktmechanismus ausgesetzt werden. In deutlicher Weise schließt mein Vorschlag jedwede Bevorrangung von Gläubigergruppen aus. Es könnte sogar argumentiert werden, dass die Kreditvergabe im Rahmen des Rettungsschirms die Krise nur hinauszögerte und vergrößerte, somit missbräuchliche Kreditvergabe darstelle, für deren Schäden zu haften sei. In einigen Staaten, vor allem Frankreich, Belgien und Italien, gibt es diesen Haftungsgrund. Der argentinische Jurist Juan Pablo Bohoslavsky versucht, aus diesen Rechtsquellen ein generelles, völkerrechtliches Prinzip abzuleiten. Danach wären die Privatgläubiger zu bevorrangen.
Einige Elemente meines Vorschlags, einst als utopisch bezeichnet, sind bereits gang und gäbe: der Schuldnerschutz ist Teil der Initiative für arme, schwer verschuldete Länder (HIPC), die Transparenz wird generell durch die Beteiligung von NRO in hohem Maße hergestellt. Multilaterale Kredite sind schon lange nicht mehr tabu, wenn auch noch immer rechtswidrig bevorzugt. Nur der Kernpunkt der Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige und unbefangene Entscheidungsinstanz, wird von den Gläubigerstaaten vehement abgelehnt. Dies führt auch dazu, dass es an Fairness gegenüber der Bevölkerung des Schuldnerlandes sowie gegenüber vielen Gläubigern mangelt.
Insistiert man auf der Forderung eines Haarschnitts in Griechenland, so zerreißt schließlich der Lügenschleier einer „Solidarität mit Griechenland“, die wir angeblich zeigen sollen. Des Pudels Kern wird sichtbar: man fürchtet, dass Banken pleitegehen könnten. Es werden immer wieder credit default swaps ins Spiel gebracht, praktisch unregulierte Derivate, von denen niemand weiß, wer wie viel davon hält oder wie viel im Verlustfall zahlen muss. Die Politik der Liberalisierung schuf ein Monster, vor dem sie sich jetzt fürchtet, das aber mit einem Bankenrettungspaket in den Griff zu bekommen wäre. Die Solidarität mit Griechenland entpuppt sich als Solidarität mit Investoren, als neoliberale Umverteilung und als Unwahrheit. Äußerungen deutscher Bankenvertreter lassen erwarten, dass Bankenpleiten zumindest in Deutschland kein Massenphänomen sein würden. Besonders die EZB hat mit Forderungskürzungen mittlerweile allerdings durch angehäufte Problempapiere ein selbst verschuldetes Problem.
Statt Spekulanten Geld nachzuwerfen und so die Krise anzufeuern, sollte die EU insolvente Staaten nach einem Insolvenzverfahren, wie ich es vorschlage (1), finanzieren, bis sich die Kapitalmärkte beruhigen. Dies wäre sinnvoller, billiger und marktwirtschaftlich, wenn auch nicht im Spekulanteninteresse. Allfällige Bankenrettungsaktionen sollten nach US-Muster so erfolgen, dass das Budget von dieser Dienstleistung profitiert. Der Marktmechanismus käme endlich wieder zum Tragen, und die Budgets würden entlastet.
(1) für Details s. http://homepage.univie.ac.at/kunibert.raffer/net.html
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund Heft 3 / 2011
Der Autor:
Kunibert Raffer ist Außerordentlicher Professor am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien und Honorarprofessor der Universidad Nacional de Río Negro, Argentinien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Internationaler Handel, Internationale Finanzen, Entwicklungshilfe.