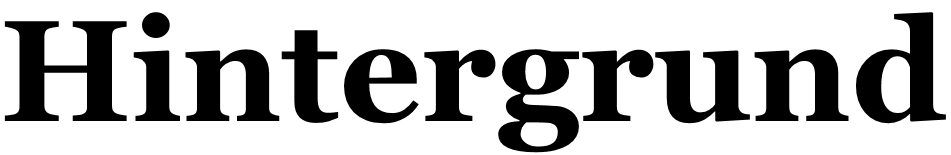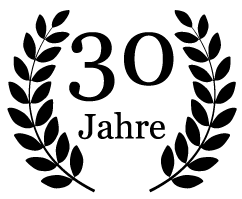Die Sozialstaatswirtschaft als Systemalternative
Der Beitrag stellt eine System- und Sozialalternative vor, deren Genese auf die marktwirtschaftliche und sozialstaatliche Periode der Nachkriegszeit zurückführt. Diese Alternative existiert heute noch als mehr oder weniger latente Anlage in modernen Wirtschaftsgesellschaften und harrt einer ökonomisch-politischen Geburtshilfe. Ein Beitrag zur Debatte um Alternativen.
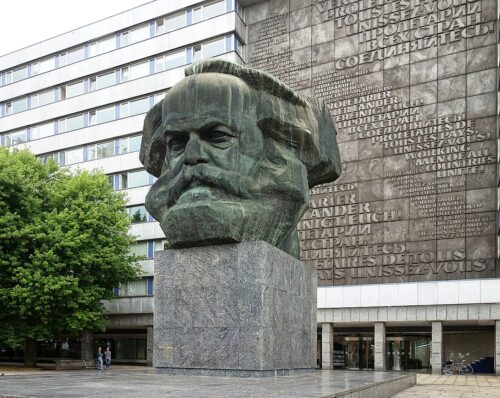 Karl Marx Denkmal in Chemnitz
Karl Marx Denkmal in ChemnitzMit Blick auf Karl Marx’ beste Gedanken und die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts überbordende Entwicklung gesellschaftlicher Produktivkräfte erscheint es wie eine Selbstverleugnung oder nahezu Bankrotterklärung, wenn man meint, es habe sich bis dahin noch keine Systemalternative im Schoße des Bestehenden vorbereitet, so Marx. Das meint kein Bündel von sozialen Mächten, Produktionstechnologie und Sozialingenieurskunst, sondern eine sich innerlich anbahnende, neuartige Reproduktions- und Praxisformierung.
Diese Forschungsorientierung bricht mit dem zähesten Dogma der traditionellen politischen Ökonomie: Dass die Marxsche Kapital- und Sozialtheorie vor allem als Kritik vorgängiger Theorien sowie kapitalistischer Zustände und Probleme aufzufassen sei anstatt als wesentlich transformative, stets auch nach der Alternative fragende Analytik. Diese wurde notgedrungen halbfertig hinterlassen und muss in verschiedener Hinsicht historisch relativiert wie fortentwickelt werden.
Das Kernproblem
Das seither immer noch fragliche Kernproblem betrifft eine kapitalistische oder aber alternative Reproduktionsformierung. Dazu boten die Marxschen Reproduktionsschemata mit ihrer genialen Abteilungsgliederung sowie Untersuchungen über die Reproduktion, Zirkulation und Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals einen Grundhalt. Dies etwa auch als Folie für versuchte mathematische und werttheoretische Operationalisierungen oder im Vergleich mit Keynesianischen Aggregaten.
Dabei wurde jedoch nicht erkannt, dass inzwischen der besteuernde Staat durch sein Finanz- und Haushaltswesen, seine mehr oder weniger projektierende Sozial- und Wirtschaftspolitik ein integraler Prozessknoten im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess geworden war. Die Schemata bildeten dies und die daraus folgenden Konsequenzen nicht mehr ab. Man hätte die Problematik an der steigenden Staatsquote ablesen oder vermuten können, dass durch die tendenziell steigende Infrastrukturisierung etwas Neues ins Spiel kommt.
Ausgaben und Dispositionen des Staates betreffen vor allem die im weitesten Sinne infrastrukturellen, allgemeinen und gemeinschaftlichen Grundlagen der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. Marx hatte bereits erfasst, dass es damit eine besondere Bewandtnis hat und der Staat dabei eine entscheidende Rolle spielt. Auf dem Stand seiner theoretischen Explikation konnte er es aber zunächst mit der Annahme gut sein lassen, dass es sich um einen kollektiven Verbrauch handelt, der den Rahmen der Kapitaltheorie nicht sprengt.
Die anschließende Kapital-, Akkumulations- und Krisentheorie verfuhr weiter in diesem Sinne. Mit Blick auf die konzentrierte Massenproduktion und die aktive Rolle des Steuer- und Sozialstaates wurde etwa ein staatsmonopolistischer oder auch Teilhabekapitalismus identifiziert. Im globalen Maßstab blieb der Imperialismus im Blick. So erschien es als reine Illusion, an die Sozialstaatlichkeit systemüberwindende Hoffnungen zu knüpfen. Kann man aber nicht doch von einem Sozialkapitalismus sprechen, in dem sich eine Systemalternative anbahnte?
Der transformative Ansatz und das Versagen der negatorischen Kritik
Letztere Sichtweise lässt sich erklären, indem das waren- und industriewirtschaftliche, in sich gegliederte Reproduktionskonzept um eine komplementär gestellte neue Hauptabteilung des Sozial- Infrastrukturellen erweitert und die Rolle des Sozialstaates als eine zentrale, fiskal-, haushalts- und sozialpolitisch vermittelnde Instanz zwischen beiden Flügeln anerkannt wird. Das ganze trinodale, das heißt durch diese drei Prozessknoten verbundene Gefüge kann sodann einer erneuten Wert-, Reproduktions- und Praxisanalytik unterzogen werden.
In marxistischen Theorien der kapitalistischen Entwicklung standen andere Fragen an, auch betreffs damaliger Versuche sozialistischer Ökonomie. Aber über die Marxsche Reproduktionskonzeption hinausgehen? Trotz aller Kontroversen wurde der traditionelle Kanon nicht überschritten, und in der folgenden Periode beschäftigte man sich mit dem neoliberalen Rollback, dem US-Imperialismus, der Entwicklung des Finanzkapitalismus und der Globalisierung. Trotz unzähliger, beißender Kritik an kapitalaffinen Wirtschaftslehren und asozialen Verhältnissen konnte aber keine reelle Alternative vorgewiesen werden.
Rückblickend stellt sich die mangelnde forschende und transformative Fortentwicklung der Wissenschaft der politischen Ökonomie in jener sozialkapitalistischen Periode als ein Versagen mit weitreichenden Konsequenzen dar: Von einer negatorisch gestimmten Kapital- und Krisentheorie her oder gar im Kontext sogenannter Wertkritik war es praxislogisch niemals möglich, zu einer Systemalternative mit andersartigem ökonomischem Kalkül zu kommen. Das gleiche Problem betrifft im Grunde alle kritischen Gesellschaftstheorien.
Von da tragen entsprechende Theoriebildungen den Stempel abstrakter Negation. So verfing man sich etwa in letztlich ergebnislosen Debatten nach dem Muster Plan oder Markt, suchte nach einem schlecht vermittelten Dritten Weg oder lehnte sich mangels eigener Alternativen an die sowjetische Staatsplanwirtschaft an, die letztlich scheitern sollte. Dieser logische Duktus führt zu abstraktem Utopisieren, auch zu nicht genügend formationell und gesellschaftlich wie geschichtlich konkreten Ideen des Sozialismus.
Voraussetzungen und Kernpunkte der transformativen Systemanalytik
Es war ein Mangel an Formanalytik, in den volkswirtschaftlich selbstbezüglichen, sozial-infrastrukturellen Hervorbringungen die ganz eigene, nicht warenförmige Formbildung sozialwirtschaftlicher Dienste und die Konstitution einer neuen Reproduktionsabteilung zu verfehlen. Diese können und müssen nunmehr als positiv werteschaffend zur Geltung kommen, und somit erscheint der Reichtum kapitalistischer Gesellschaften keineswegs mehr nur in Warenform.
Man konzentrierte sich auf die Darstellung der Kapitaltheorie, dagegen lag die originäre wert-, reproduktions- und praxistheoretische Forschungsmethode kaum im Blick. Lagen deren Ergebnisse nicht bereits in Marxschen Schriften vor, war das überlieferte Instrumentarium nicht ausreichend, um den kapitalistischen Progress im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie zu fassen? Das hieß aber, auf Phänomene der Zeit fertige Interpretationsschemata anzuwenden. Entsprechende Rekonstruktionen der dialektisch entfalteten Kapitaltheorie schlossen den weiter gespannten Horizont der sogenannten Grundrisse nicht ein.
Schließlich sind ein Praxisdenken und die dialektische Realitätskonzeption erforderlich, die von der Formbestimmtheit und widersprüchlichen, mehrfältigen Dimensionierung der Praxis ausgeht. Marx hat für die hier fragliche, höchste, formationelle Widersprüchlichkeit das Denkbild gebraucht, dass sich die Alternative schließlich im Schoße des Alten vorbereitet haben müsse. Selbst konnte er auf der Suche nach der neuen Produktionsweise kaum über Übergangsformen und Generalformeln hinauskommen, weil der Industriekapitalismus seiner Zeit noch keine untergründig alternativ- oder latenzhaltige Übergangsgesellschaft war.
Das vollständige Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 3/4 2025 unseres Magazins, das im Bahnhofsbuchhandel, im gut sortierten Zeitungschriftenhandel und in ausgewählten Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. Sie können das Heft auch auf dieser Website (Abo oder Einzelheft) bestellen.
HORST MÜLLER (1945), Ausbildung als Industriekaufmann, Studium und Engagement seit 1968, Dr. phil. 1982. Sozialinformatiker im öffentlichen Dienst 1984 bis 2010. Vieljährige Aktivitäten zu Bloch und auf dem inter- nationalen Feld der Praxisphilosophie, seit 2001 Redakteur des Portals praxisphilosophie.de. Hauptwerk 2015: Das Konzept Praxis im 21. Jahrhundert, 2021 in 2. überarbeiteter Auflage. Schwerpunkte: Konkrete Praxisphilosophie und Dialektik, Politische Ökonomie und Systemalternativen, Stadt- und Sozialforschung, Konzepte gesellschaftlicher Transformation.