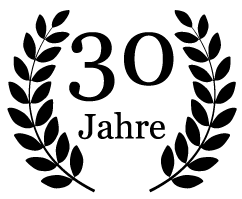"Wenn er ja sagt, was meint er dann?"
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von URI AVNERY, 22. Juni 2009 –
"Na, sie haben ja sicher was zu feiern", sprach mich der Reporter einer populären Radio-Station nach Netanyahus Rede an. "Er nimmt ja den Plan an, den Sie vor 42 Jahren formuliert haben!" (Es war vor 60 Jahren, aber wer zählt noch.)
Gideon Levy schrieb auf der Titelseite der "Haaretz", " Der mutige Aufruf Uri Avnerys und seiner Freunde vor vier Jahrzehnten hallt heute wider, obschon schwach, von einem Ende (des politischen Spektrums in Israel) zum anderen.
Ich würde lügen, würde ich den Moment der Befriedigung leugnen, aber er war schnell vorbei. Es war keine "historische" Rede. Es war nicht einmal eine "große" Rede. Es war eine schlaue Rede.
Sie enthielt einige Scheinheiligkeiten, um Barak Obama zufrieden zu stellen, gefolgt von einer gehörigen Portion genau entgegen gesetzter Punkte, um die extrem Rechten in Israel zu beruhigen. Nicht viel mehr.
NETANYAHU ERKLÄRTE "wir reichen unsere Hand zum Frieden".
In meinen Ohren hörte sich das bekannt an: Im Sinai-Krieg 1956 war einer meiner Redaktionsmitarbeiter in die Einheit eingezogen worden, die Sharm-Al-Sheikh eroberte. Er, der in Ägypten aufgewachsen und der arabischen Sprache mächtig war, interviewte den ranghöchsten der gefangenen ägyptischen Offiziere, einen Oberst. "Jedes Mal, wenn Ben Gurion verkündete, er reiche seine Hand zum Frieden", sagte der Ägypter, "waren wir in höchster Alarmbereitschaft."
Das war tatsächlich Ben Gurions Methode. Vor jeder Provokation verkündete er, "wir reichen unsere Hand zum Frieden", und fügte dann Bedingungen hinzu, von denen er wusste, dass sie für die Araber auf keinen Fall akzeptabel waren. So entstand eine für ihn ideale Situation: Israel erschien in den Augen der Welt als friedliebend, während die Araber wie notorische Friedens-Verweigerer aussahen. Damals machte in der israelischen Führung der Scherz die Runde: Die arabische Ablehnung ist unsere Geheimwaffe.
Diese Woche hat Netanyahu diese Methode aufgewärmt.
ICH UNTERSCHÄTZE natürlich nicht die Tatsache, dass der Chef der Likud-Partei die Worte "palästinensischer Staat" ausgesprochen hat.
Worte tragen politisches Gewicht. Einmal ausgesprochen, entwickeln sie ihr eigenes Leben. Man kann sie nicht, wie einen Hund, zurück rufen.
In einem beliebten israelischen Lied fragt der Junge das Mädchen: "Wenn Du Nein sagst, was meinst Du dann?" Man könnte genauso gut fragen: Wenn Netanyahu Ja sagt, was meint er dann?
Auch wenn die Worte "palästinensischer Staat" von Netanyahu nur unter Druck und ohne jede Absicht, sie in die Tat umzusetzen, ausgesprochen wurden, hat die Tatsache Gewicht, dass das Regierungsoberhaupt und der Chef der Likud-Partei gezwungen waren, diese Worte auszusprechen. Die Idee des palästinensischen Staats ist nun zu einem Teil des nationalen Konsens geworden, und nur eine Hand voll von Ultra-Rechten lehnt sie weiterhin direkt und unverblümt ab. Das ist aber erst der Anfang. Der Haupt-Kampf wird sein, die Idee in die Tat umzusetzen.
DIE GESAMTE Rede war nur an einen gerichtet: Barak Obama. Sie war nicht dazu gedacht, sich an die Palästinenser zu wenden. Klar war, dass die Palästinenser nur ein passives Gesprächsobjekt darstellen zwischen dem Präsidenten der USA und dem Premierminister Israels. Außer in einigen abgedroschenen Klischees sprach Netanyahu über sie, nicht zu ihnen.
Seinen Worten nach ist Netanyahu bereit, mit der "palästinensischen Öffentlichkeit" zu verhandeln, natürlich "ohne Vorbedingungen". Will sagen: ohne Vorbedingungen von Seiten der Palästinenser. Von Netanyahus Seite gibt es allerdings jede Menge Vorbedingungen, von denen jede einzelne für sich schon versichert, dass kein Palästinenser, kein Araber und kein Moslem zustimmen würde, in Verhandlung zu treten.
1. Bedingung: Die Araber müssen anerkennen, dass der Staat Israel der "Nationalstaat des jüdischen Volkes" ist (nicht "jüdischer Staat", wie irrtümlich von der örtlichen und weltweiten Presse verbreitet wurde). Wie schon Husni Mubarak verkündet hat: Kein Araber wird so etwas akzeptieren, denn es würde bedeuten, dass anderthalb Millionen arabische Bürger Israels an diesem Staat nicht teilhaben, und sie würde von vorne herein die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge verneinen – die Trumpfkarte der arabischen Seite.
Hier muss erinnert werden: als die Vereinten Nationen 1949 die Teilung in einen "jüdischen Staat" und einen "arabischen Staat" beschloss, beabsichtigten sie nicht, den Charakter dieser Staaten zu definieren. Sie stellten nur Tatsachen fest: Es gibt im Land zwei rivalisierende Bevölkerungen, deshalb muss das Land zwischen ihnen aufgeteilt werden. (Jedenfalls wären 40 % der Bevölkerung des "jüdischen" Staats arabisch gewesen.)
2. Bedingung: Die palästinensische Autonomiebehörde muss vorher ihre Herrschaft über den Gazastreifen festigen. Wie? Die israelische Regierung verhindert ja jeden Durchgang von der Westbank zum Gazastreifen, und keine palästinensische Truppe kann von hier nach da. Die Möglichkeit, das Problem durch eine palästinensische Einheitsregierung zu lösen, ist auch verwehrt: Netanyahu erklärte ein für alle mal, es gäbe keine Verhandlungen mit einer palästinensischen Führung, die "Terroristen" mit einschließe, "die uns vernichten wollen" – seine Art, Hamas zu beschreiben.
3. Bedingung: Der palästinensische Staat wird entmilitarisiert sein. Das ist keine neue Idee. Fast in allen bisher vorgelegten Friedensplänen ist von Sicherheits-Vorkehrungen die Rede, die Israel vor palästinensischen Angriffen und Palästina vor israelischen Angriffen schützen. Aber nicht das hat Netanyahu im Sinn: Er sprach nicht von Gegenseitigkeit, sondern von Einseitigkeit. Von einem palästinensischen Staat, dessen Luftraum und Grenzübergänge von Israel kontrolliert würden, also einer Art vergrößertem Gazastreifen. Dabei wahrte er Überheblichkeit und Demütigung; allein das Wort "Demilitarisierung" sollte genügen, die Palästinenser zum "Nein" zu bewegen.
4. Bedingung: Das ungeteilte Jerusalem bleibt unter israelischer Herrschaft. Dies wurde nicht als israelische Ausgangsposition zu Verhandlungen präsentiert, sondern als endgültige Entscheidung. Das allein genügt, zu versichern, dass kein Palästinenser, kein Araber und kein Moslem diesen Vorschlag annehmen kann.
In den Oslo-Verträgen steht, Israel werde um Jerusalems Zukunft verhandeln. Es ist ein allgemein gültiger juristischer Grundsatz, dem nach einer, der in Verhandlungen tritt, sich verpflichtet, dies bona fide zu tun, auf der Basis von Geben und Nehmen. Deshalb beinhalten alle existierenden Friedenspläne die Rückkehr Ostjerusalems – ganz oder teilweise – unter arabische Kontrolle.
5. Bedingung: Zwischen Israel und dem palästinensischen Staat werden "verteidigbare Grenzen" festgelegt. Dies ist das Code-Wort für ausgeweitete Annexionen. Seine Bedeutung: Keine Rückkehr zu den Grenzen von 1967, auch nicht mit Gebietsaustausch, der Israel erlauben würde, einige der großen Siedlungen seinem Gebiet zuzuschlagen. Um "verteidigbare Grenzen" fest zu legen, muss ein beträchtlicher Teil der besetzten Gebiete (die insgesamt nur 22 % des Gebiets des mandatorischen Palästina vor 1948 ausmachen) israelisches Gebiet werden.
6. Bedingung: Das Flüchtlingsproblem wird "außerhalb israelischen Territoriums" gelöst. Das heißt: Nicht ein einziger Flüchtling wird zurückkehren dürfen. Tatsächlich stimmen alle überein, dass nicht Millionen von Flüchtlingen nach Israel zurückkehren. Nach der arabischen Friedensinitiative soll eine Lösung "von beiden Seiten akzeptiert" werden, – das heißt, Israel muss zustimmen. Man geht davon aus, dass die Parteien der Rückkehr einer symbolischen Anzahl von Flüchtlingen zustimmen. Dies ist eine äußerst beladene und empfindliche Angelegenheit, wer Frieden will, muss sich ihrer mit Vorsicht und größtmöglicher Empfindsamkeit annehmen. Netanyahu tut genau das Gegenteil: Seine provokative Feststellung, ohne jede Empathie, soll automatisch zur Ablehnung führen.
7. Bedingung: Kein Einfrieren des Siedlungsbaus. Das "normale Leben" der Siedler wird fortgeführt. Das heißt – es wird weiter gebaut, sozusagen für die "natürliche Vermehrung". Der palästinensische Verhandler Michael Tarasy illustriert diesen Umstand so: "Wir verhandeln, wie wir uns die Pizza teilen, während dessen isst Israel sie auf."
Das war die ganze Rede. Nicht weniger interessant ist, was nicht in ihr gesagt wurde. Zum Beispiel Begriffe wie: Road Map, Annapolis, die arabische Friedensinitiative, Besatzung, Palästina, (palästinensische) Souveränität, Öffnung der Grenzübergänge (nach Gaza), die Golanhöhen, und vor allem: Es fand sich in der ganzen Rede nicht ein Anflug von Respekt gegenüber dem Feind, der, so besagt das alte jüdische Sprichwort, in einen Freund verwandelt werden muss.
WAS IST ALSO wichtiger? Was überwiegt? Die verbale Anerkennung eines "palästinensischen Staates" durch Netanyahu, oder die Bedingungen, die diese Worte inhaltlich entleeren?
Die Reaktion der Öffentlichkeit ist interessant. In der ersten Umfrage am Tag nach der Rede bekunden 71 % der Befragten Unterstützung, aber 55 % glauben, Netanyahu habe sich "amerikanischem Druck gebeugt", 70 % glauben nicht, dass in den kommenden Jahren ein palästinensischer Staat entsteht.
Was genau unterstützen diese 71 %? Die Lösung "palästinensischer Staat", oder die Bedingungen, die seine Entstehung verhindern, oder gar beides?
Es gibt natürlich eine extrem rechte Minderheit, die einen Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten dem Verzicht auf Gebiete zwischen Mittelmeer und Jordan vorzieht. An der Straße nach Jerusalem hängen große Plakate mit einer Bildkollage Obamas, dem man eine Keffieh, die traditionelle arabische Kopfbedeckung, aufgesetzt hat. (Sie macht jeden schauern, der sich an genau die gleiche Kollage mit dem Bild von Yitzhak Rabin erinnert.) Aber die Mehrheit der Bevölkerung versteht, dass ein Bruch mit den USA auf jeden Fall vermieden werden muss.
Netanyahu und der rechte Flügel hatten gehofft, dass die Rede von den Palästinensern geradewegs abgelehnt würde, und sie so als notorische Friedens-Verweigerer da stünden, während die israelische Regierung sich als derjenige präsentieren könne, der den ersten, kleinen aber bedeutenden Schritt in Richtung Frieden tut. Sie sind sich sicher, dass es diesen Preis umsonst und gratis gibt: Keine Errichtung eines palästinensischen Staates, keinerlei Zugeständnisse von Seiten der israelischen Regierung, die Besatzung bleibt wie sie ist, der Siedlungsbau geht weiter, und Obama wird alles akzeptieren.
DIE FRAGE IST also: Wie wird Obama reagieren?
Die erste Reaktion war minimal. Eine höflich positive.
Obama legt es nicht auf einen frontalen Zusammenstoss mit der israelischen Regierung an. Es sieht so aus, als wolle er "sanften" Druck ausüben, vorsichtig, nachdrücklich, aber ruhig. Ich meine, es ist eine kluge Einstellung.
Kurz vor der Rede traf ich mich mit dem Ex-Präsidenten Jimmy Carter im Hotel "American Colony" in Ost-Jerusalem. Das Treffen war von Gush Shalom organisiert worden, es nahmen Vertreter einiger israelischer Friedensorganisationen daran teil. In meinen einleitenden Worten erinnerte ich daran, dass wir uns im selben Zimmer befanden, in dem sich vor sechzehn Jahren, als in Washington die Oslo-Verträge unterschrieben wurden, israelische Friedensaktivisten und führende Palästinenser aus Jerusalem trafen und Champagner-Flaschen öffneten. Die Euphorie dieser Momente ist spurlos verschwunden.
Israelis und Palästinenser haben die Hoffnung verloren. Auf beiden Seiten wünscht sich die überwältigende Mehrheit ein Ende des Konflikts, glaubt aber nicht, dass Friede möglich ist – und beide Seiten beschuldigen die jeweils andere, dafür verantwortlich zu sein. Unsere Aufgabe ist es, den Glauben, dass er möglich ist wieder zu beleben.
Dafür brauchen wir ein dramatisches Ereignis, einen belebenden elektrischen Schock – wie den Besuch Anwar Sadats in Jerusalem 1977. Ich schlug vor, Obama solle nach Jerusalem kommen, um sich direkt an die israelische Öffentlichkeit zu wenden, vielleicht sogar vom Rednerpult der Knesset, wie Sadat.
Nachdem er allen Teilnehmern zugehört hatte, ermutigte uns der ehemalige Präsident und präsentierte einige eigene Vorschläge.
DER ENTSCHEIDENDE PUNKT sind in diesem Moment natürlich die Siedlungen. Wird Obama auf einem absoluten Baustopp beharren oder nicht?
Netanyahu hofft, sich aus dieser Sache unbeschadet heraus zu winden. Er hat jetzt wieder einen neuen Gag: Begonnene Projekte müssen zu Ende geführt werden. Man kann ja nicht mitten drin aufhören. Die Pläne sind schon genehmigt. Die Mieter warten auf den Einzug, die muss man ja nicht leiden lassen. Überhaupt wird der Oberste Gerichtshof einen Baustopp nicht erlauben. (Ein besonders lächerliches Argument, wie: Das Gericht gestattet dem Dieb, noch ein bisschen von dem gestohlenen Geld auszugeben, bevor er verurteilt wird.)
Wenn Obama darauf herein fällt, muss er sich nicht wundern, wenn er, verspätet, herausfindet, dass diese Projekte 100 000 Wohn-Einheiten mit einschließen.
Und das bringt uns zur wichtigsten Tatsache in dieser Woche: Die Siedler haben nach Netanyahus Rede nicht protestiert. Hie und da wurde halbherzig Kritik geübt, aber der größte Teil dieser Bevölkerung in Waffen schwieg.
Was uns an den unvergessenen Sherlok Holmes erinnert, der erzählte, wie er einen geheimnisvollen Fall löste, indem er auf das "seltsame Verhalten des Hundes in der Nacht" aufmerksam machte.
"Aber der Hund hat ja nachts gar nichts getan!" erwiderte jemand.
"Eben das genau ist seltsam", bemerkte Holmes.
Der Autor:
Uri Avnery ist Journalist, Friedensaktivist und ehemaliges Knesset-Mitglied.
Avnery engagiert sich seit 1948 für eine Aussöhnung Israels mit dem palästinensichen Volk.
Er war Gründer und ist Leiter der Friedensinitiative "Gush Shalom" (Der Friedensblock), die im Jahr 1997 den Aachener Friedenspreis und im Jahr 2001 den Alternativen Nobelpreis erhielt.
Übersetzt von: G. Weichenhan-Mer