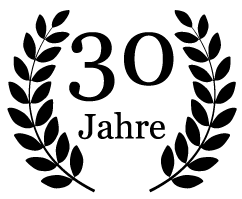Nichts dringlicher als Frieden
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Eindrücke aus dem Kriegsgebiet Donbass –
Von SUSANN WITT-STAHL, Donezk, 10. September 2014 –
Warteschlangen vor den Tankstellen an der Straße von Dnipropetrowsk nach Donezk. Wer weiter hinein in den Südosten fahren will, der nutzt die Chance und deckt sich mit mehr oder weniger lebensnotwendigen Dingen ein, die in Donezk gar nicht oder nur noch mit großer Mühe zu bekommen sind: Griwna aus dem Geldautomaten, Treibstoff, Zigaretten, Bier oder auch härtere Alkoholika.
Die Fahrt nach Donezk dauert eine Ewigkeit. Für knapp 300 Kilometer – eigentlich sind es weniger, aber die Kampfzonen müssen umfahren werden – braucht man etwa sechs Stunden. Ein Großteil der Landstrassen war schon immer in einem sehr schlechten Zustand, aber die vielen Panzer, die hier in den vergangenen Monaten bewegt wurden, haben zu allem Übel noch tiefe Rillen in den Asphalt gefräst.
In den letzten Tagen sind vorwiegend Truppentransporter der ukrainischen Armee unterwegs. Panzer sind nur vereinzelt auf den anliegenden Feldern zu sehen. „Viele andere stehen versteckt in den Wäldern und hinter Hügeln“, erzählt der Fahrer und Guide Maxim Iwanow*, der im normalen Leben – das zurzeit nicht zu haben ist – in Donezk als Geschäftsführer eines Konsumgütervertriebs seine Brötchen verdient.
An vielen Orten gibt es Block Posts (Kontrollstellen) des Militärs. Auf der Suche nach Invasoren, die die ukrainischen Medien jeden Tag routinemäßig vermelden (ohne sie irgendwo konkret nachzuweisen), interessieren sie sich vorwiegend für Fahrzeuge, die aus Richtung „Novorossia“, den vor einigen Monaten ausgerufenen und nicht anerkannten Volksrepubliken im Donbass kommen. In einigen Dörfern und kleinen Städten wie Krasnoarmijsk am Ufer des Flusses Hryschynka ist vor drei Monaten die Wasserversorgung zusammengebrochen und bis heute nicht wiederhergestellt worden. An einer Tankstelle auszutreten, ist nicht mehr möglich. Einmal eben schnell ausserhalb der Stadt anzuhalten und im Gebüsch zu verschwinden, sei gar nicht zu empfehlen, warnt Iwanow. „Die Armee hat viele Gebiete an der Grenze zur Volksrepublik Donezk vermint.“
Das gilt vor allem für die Umgebung von Marinka, direkt vor den Toren der Millionenstadt, nach der der erst wenige Monate alte Staat benannt ist. Marinka, wo laut New York Times vor einigen Wochen noch die Fahne des faschistischen Bataillons „Asow“ wehte, das unter einem Banner mit Wolfsangel-Symbol – unter dem schon in den 1940er-Jahren Divisionen der deutschen Waffen-SS in der Ukraine gemordet hatten – für die neue Regierung in Kiew kämpft, war Anfang August von ihren Truppen erobert worden und ist momentan „neutrale Zone“, quasi Niemandsland. Hier sind die Verwüstungen des Bürgerkrieges deutlich sichtbar: Eine abgebrannte Sonnenblumenölraffinerie, aus der immer noch dichter Qualm aufsteigt, überall zerstörte Strommasten und Krater von Granaten und anderen Geschossen. „Das ist also die ,grüne Linie‘, der sogenannte humanitäre Korridor, den das ukrainische Militär der Zivilbevölkerung zugesichert hat“, sagt Iwanow ironisch und zeigt auf die Reste einer Rakete, die sich tief in die Fahrbahn gebohrt hat. „Auch an anderen Stellen hat die Armee die Straße beschossen“, berichtet er. „Als ich hier mit meinem Wagen in einer Kolonne warten musste, flogen die Geschosse in Richtung Donezk über meinen Kopf hinweg. Ich konnte ihr Pfeifen hören.“ Der ukrainischen Regierung, ihrem Militär und auch den Medien traue niemand mehr, betont er. Die Zivilbevölkerung habe sich über Facebook, Twitter und andere soziale Medien vernetzt, um sich gegenseitig über die akuten Gefahren auf dem Laufenden zu halten.
Es herrscht Kriegsrecht
Donezk hat sich mittlerweile in eine Geisterstadt verwandelt. Nahezu alle Geschäfte, Restaurants, Cafes, Theater, Kinos und andere Orte, die das Großstadtleben attraktiv machen, sind geschlossen. Die Straßen sind in vielen Vierteln so gut wie leer gefegt. Den Gesichtern der wenigen Bewohner, die unterwegs sind, sind die ständige Angst, die Sorgen und anderen Strapazen, die der mit gnadenloser Härte geführte Bürgerkrieg ihnen auferlegt, deutlich anzusehen. Viele sehen erschöpft aus und wirken kraftlos. Die ständigen zermürbenden Artillerie-Angriffe der ukrainischen Armee haben nicht nur Tote, Verletzte und zerstörte Gebaude, sondern auch Wunden in der Psyche der Menschen hinterlassen.
Mindestens 300.000, vielleicht sogar bis 500.000 Menschen haben die Stadt verlassen. Wer geblieben ist, hat Mühe, seinen Alltag bewältigt zu bekommen. Die wenigen Supermärkte, die noch geöffnet haben, schließen bereits am späten Nachmittag – es mangelt an Waren, vor allem aber an Kundschaft. Viele Menschen haben nur Geld, um das Nötigste zu kaufen – manche nicht einmal das. Erschwerend hinzu kommt: Seit rund drei Wochen sind alle Banken geschlossen. Der gesamte Zahlungsverkehr läuft nur noch gegen Bares. Viele Arbeitnehmer kommen nicht mehr an ihre Löhne und Gehälter heran, die auf ihre Konten überwiesen wurden. Noch schlimmer trifft es die Alten und Schwachen. Renten, Arbeitslosenhilfe und andere Sozialleistungen wurden das letzte Mal vor zwei Monaten gezahlt. Die Volksrepublik kann die Bevölkerung nur notdürftig versorgen mit ein paar Lebensmitteln und Medikamenten. Hilfsbedürftige ohne Verwandte und gute Freunde haben es schwer in diesen Tagen.
Die Schulen und Universitäten sind geschlossen. Wer heiraten möchte, muss in den „Nachbarstaat“ Ukraine fahren; wer sich einfallen lässt, hier auf die Welt zu kommen, erhält eine nirgendwo auf der Welt gültige Geburtsurkunde der Volkrepublik Donezk. Während die Feuerwehr und die Müllabfuhr gut funktionieren, hat sich der komplette Polizeiapparat in das rund 110 Kilometer entfernte Mariupol am Asowschen Meer abgesetzt. Die Mühlen der Justiz mahlen nicht mehr langsam, sondern vorerst gar nicht mehr. In Streitfällen kommen Vertreter der neuen Verwalter und schlichten. Sie sorgen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und verhängen Sanktionen. Bewohner berichten von Plünderungen und Diebstahl durch Milizionäre, die meist nicht mehr besitzen als das, was sie am Leib tragen: Flecktarn-Kleidung und eine Feuerwaffe. Für schwere Vergehen ist (vorläufig) die Todesstrafe wieder eingeführt worden – es herrscht Kriegsrecht. Wer nach 22 Uhr auf der Strasse gesichtet wird, sollte eine plausible Erklärung vorweisen können. Vor einigen Tagen seien drei Mitarbeiter seiner Firma, junge Kerle, beim Biertrinken in der öffentlichkeit erwischt worden, berichtet Iwanow. „Sie wurden in Arrest genommen und müssen zwei Wochen Dienst an den Block Posts schieben.“
Für die Bewohner in Donezk eine zusätzliche Gefahr und Belastung: Da es niemanden mehr gibt, der Überschreitungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Alkohol am Steuer und andere Verstöße gegen die Verkehrsordnung überwacht, herrscht auf den Straßen Anarchie. Dass es nicht zu einer spürbaren Zunahme von Unfällen kommt, ist wohl vorwiegend der Tatsache zu verdanken, dass auf den Straßen der Stadt aufgrund von Ermangelung an Verkehrsteilnehmern und erhöhten Spritpreisen wenig los ist und ein durchgetretenes Gaspedal meist ohne negative Folgen bleibt.
Der Albtraum geht weiter
Die Situation in Donezk habe sich seit der Vereinbarung der Waffenruhe etwas verbessert. Die Artillerie-Angriffe, die bislang bis ins Zentrum der Stadt reichten, seien weniger intensiv, findet Vsevolod Petrowsky, ein linker Aktivist, der von Verfolgung bedroht wäre, wenn die neue Regierung in Kiew den Donbass vollständig unter ihre Kontrolle bringen würde. Aber dass die Detonationen im Großen und Ganzen ausbleiben, ist für ihn kein Grund, Entwarnung zu geben. Die Menschen hier sind nach wie vor von Kriegsgewalt massiv bedroht. Das gilt besonders für die Bewohner der Randbezirke von Donezk.
Für viele andere, die die Stadt verlassen haben, geht der Albtraum an ihren Zufluchtsorten weiter. „Meine Mutter, Tante und Großmutter sind in einem Dorf in der Nähe von Mariupol zwischen die Fronten geraten“, berichtet Petrowsky. In Zaichenki, dem einen Nachbarort, ist das Bataillon „Wostow“, das auf der Seite der Volksrepublik Donezk kämpft, in Stellung gegangen. Im anderen, in Kominternovo, steht das von der Bevölkerung am meisten gefürchtete faschistische Bataillon Asow. Viele Menschen werden von einem Ort zum nächsten und wieder zurückgetrieben und sind nirgendwo mehr sicher. So geht es auch Maxim Iwanows Familie. Iwanow hatte seine Frau, seine sechsjährige Tochter, seinen achtjährigen Sohn und seine Großeltern nach Berdjansk gebracht. Aber am vergangenen Freitag waren dort in der Nähe heftige Kämpfe ausgebrochen. „Dort sind rund 90 ukrainische Soldaten umgekommen. Einer ihrer Kameraden, der das Gemetzel überlebt hatte und versprengt worden war, stand plötzlich bei meiner Frau vor der Tür und bat schwer traumatisiert mit zitternden Händen um Wasser.“ Als in den Stunden danach die Front immer bedrohlicher näher rückte, lieh sich Iwanow kurzerhand einen Kleinbus, nahm den Höllentrip in das Kampfgebiet auf sich und holte seine Familie zurück nach Donezk.
Aber auch hier wird am größtenteils zerstörten Flughafen, unweit von Iwanows Haus, wieder heftig gekämpft. Heute morgen waren bis in die Innenstadt Explosionen zu hören. Verbände der ukrainischen Armee stehen unter Feuer der Milizen der Volksrepublik. Wenn jene mit schwerem Geschütz antworten, dann könnten erneut Wohngebiete getroffen werden. „Die Menschen hier wollen, dass Poroschenko und Putin endlich handeln. Sie warten sehnsüchtig auf neue handfeste Ergebnisse der Verhandlungen der Kontaktgruppe in Minsk“, sagt Petrowsky. Maxim Iwanow, der mittlerweile über einen Lösungsweg für seine Familie nachdenkt, den andere längst beschritten haben, nämlich die Auswanderung nach Russland, äussert sich ähnlich. „So kann es nicht mehr weitergehen. Wir sind die meiste Zeit unseres Lebensalltags damit beschäftigt, für unsere Sicherheit zu sorgen“, sagt er mit ernster Miene. „Es gibt nichts, was wir jetzt dringender brauchen, als Frieden.“
* Name geändert
{simplepopup name=“Hintergrund2014″}
Durch das Schließen dieser Einblendung kommen
Sie kostenlos zum Artikel zurück.
Aber:
Guter Journalismus ist teuer. Das Magazin Hintergrund
ist konzernunabhängig und werbefrei. Die Online-Artikel
sind kostenlos. Damit das so bleiben kann, bitten wir um
eine Spende. Entweder auf unser Spendenkonto
Hintergrund
IBAN: DE51 4306 0967 1103 6594 01
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank
oder via Paypal
Hier können Sie ein Abo für die
Print-Ausgabe bestellen.
Vielen Dank
{/simplepopup}