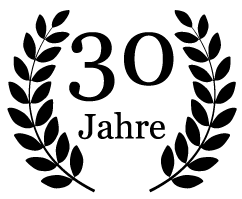„Im Namen der Welt“
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
An der Seite der alten Nordmächte klagte der Internationale Strafgerichtshof zu Den Haag bisher ausschließlich Afrikaner an. Mit ramponiertem Image geht er in das zehnte Jahr seines Bestehens. Eine Bestandsaufnahme. –
Von GERD SCHUMANN, 27. April 2012 –
Den Haag, 11. März 2003. Manche Hoffnung, viele Illusionen, jedoch wenig Nüchternheit begleiten die feierliche Gründungszeremonie in dem altehrwürdigen Gebäude. Wo sich im 15. Jahrhundert die Ritter vom Orden des Goldenen Vlieses versammelten, werden jetzt 18 Richterinnen und Richter vereidigt. Aus dem von ihnen geführten Internationalen Strafgerichtshof (International Criminal Court, ICC) soll absehbar eine Art „Weltgericht“ erwachsen.
UN-Generalsekretär Kofi Annan schüttelt dessen erstem Präsidenten Philippe Kirsch, einem Kanadier, die Hand, die niederländische Königin Beatrix klatscht würdevoll lächelnd Beifall: Knapp fünf Jahre nach Verabschiedung des Rom-Statutes (1), auf dem der ICC basiert, werde ein neues Kapitel in der Justizgeschichte aufgeschlagen, heißt es. Fürwahr ein „ambitioniertes Projekt“ (2). Genozid und Kriegsverbrechen können nunmehr verfolgt, das Humanitäre Völkerrecht angewandt und Täter bestraft werden. Das sei zuletzt in Nürnberg ab 1945 geschehen, als die Nazi-Elite abgeurteilt wurde. So die Legende.
Einsamer Ritter
Heute, im zehnten Jahr seines Bestehens, nagen Kritik und Zweifel am Ansehen des Gerichtshofes. Angesichts seiner Tatenlosigkeit „den Völkerrechtsbrüchen der mächtigen Nationen“ gegenüber wird inzwischen gar dessen „Legitimität“ (3) hinterfragt. Manchmal scheint es, als stände der im April 2003 von den Mitgliedstaaten des Rom-Statutes gewählte Argentinier Luis Moreno Ocampo ziemlich allein auf weiter Flur, wenn er wieder einmal euphorisch seine Herkules-Aufgabe beschwört. „Ich habe die beste Mission auf der Welt. Ich bringe Gerechtigkeit.“ (4)
Das verkündete er schon 2008, und unter dem macht er es bis heute nicht. Er wirkt besessen und irgendwie weltfremd, der 59-jährige Chefankläger des Court zu Den Haag. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir gezeigt, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist.“ (4) Tatsächlich jedoch, so wurde immer öfter gespöttelt, habe sich sein „theatralischer Gestus des Ritters gegen das Böse“ lediglich vor Fernsehkameras gut gemacht. (5) Ein selbst ernannter „Retter der Welt“, der nach dem Motto handelt: Der Schein bestimmt das Sein. Dabei falle seine Bilanz eher mager aus.
Das stimmt so nicht. Zwar hat sich Moreno Ocampo, „einer der einflussreichsten Juristen der Welt“ (6), stets gerne als Freund großer Worte dargestellt, diese prätentiös vorgetragen, den kleinen Finger der linken Hand leicht abgespreizt; Eindruck: weltmännischer Typ von Format, grau meliert, seriös. Der verliert sich nicht in Kleinigkeiten, wirkt allzeit entschlossen. Doch hat er auch dementsprechend gehandelt und seine Agenda rigoros durchgezogen. Haftbefehle gegen amtierende oder ehemalige Präsidenten erlassen beispielsweise. Al-Bashir, al-Gaddafi, Gbagbo – zwischen 2008 und 2011 waren es bereits drei Lieblingsbösewichte des Westens, die er offiziell jagen durfte. Jede Fahndung eine neue Schlagzeile in der Weltpresse.
Ausschließlich Afrikaner standen und stehen auf ICC-Steckbriefen, Namen von Rang oder auch nicht, doch ausschließlich Afrikaner. Moreno Ocampos Aktivitäten befeuerten die Kontroverse zwischen Nord und Süd. Seine Arbeit beim ICC trug in heiklen Situationen dazu bei, dass der – auf nationaler Ebene schon ewig existente – Graben zwischen Arm und Reich auch transnational deutlich sichtbar wurde. Der Graben zwischen den neuen Blöcken in Nord und Süd war nach der Zeitenwende, dem Ende der globalen Bipolarität, richtig tief ausgehoben worden. Das betraf nicht nur Flüchtlingsströme, sondern zuvorderst Abhängigkeitsverhältnisse.
Auschwitz in Darfur
In einigen Situationen entstand der Eindruck, der Chefankläger leide an einer eitlen Selbstüberschätzung – wie in Sachen der westsudanesischen Provinz Darfur. Zweieinhalb Millionen Flüchtlinge bestimmter ethnischer Zugehörigkeit würden dort in Camps „unter Völkermordzuständen, wie in einem gigantischen Auschwitz“ (7) gefangen gehalten, sagte er und versuchte mit seinem ahistorischen Vergleich militärische Interventionen im Namen der Menschenrechte zu provozieren. Auschwitz-Rampe, Saddam gleich Hitler, auch Gaddafi. Das Muster ist bekannt. Zugleich stellte er „implizit die achtzig Nichtregierungsorganisationen und 14 UN-Vertretungen, die dort (in Darfur) arbeiten, als Komplizen einer planmäßigen Vernichtung“ dar. (8)
Er hätte wissen müssen, was er tut. Und vielleicht wusste er es auch und machte lediglich einen Job, der in die politische Landschaft passt. Immerhin besitzt er das Recht, sich „seine Fälle selber aus(zu)suchen und nach den Vorermittlungen (zu) entscheiden, ob er Anklage erhebt“ (9) – eine hohe Verantwortung, die er dazu einsetzte, eine Reihe von richtungsweisenden Projekten anzuschieben. Sie brachten ihm – und seinem Gericht! – den gleich in mehreren der wenigen behandelten Fälle erhobenen Vorwurf des „Neokolonialismus“ ein. Oder der einseitigen Parteinahme. Oder des juristischen Flankenschutzes für die Politik.
In jedem Fall hinterlässt Moreno Ocampo eine miese Bilanz, wenn er demnächst endlich seinen Hut nimmt. Am 16. Juni 2003 hatte er das Büro im 14. Stock des Gerichtshofes bezogen, war auf der höchsten Ebene seines Berufsstandes gelandet, nachdem er sich zuletzt als Professor der Rechtswissenschaften an den Universitäten in Buenos Aires, Yale und Harvard betätigt hatte. Sein programmierter Abgang nach neun Amtsjahren wird nun zunehmend begleitet von der trügerischen Hoffnung, dass sich der ICC doch noch erholen könnte von den schweren Imageschäden, die ihm Moreno Ocampo beigebracht hat. Dabei wird übersehen, bewusst oder nicht, dass die Person des Chefanklägers lediglich Duftnoten setzen kann innerhalb eines Systems – nicht mehr. Die, die er hinterließ, rochen und riechen zwar streng und beeinflussten natürlich das Klima am Gerichtshof. Aber nicht dessen Charakter.
Die Nachfolgerin
Über Moreno Ocampos Nachfolgerin Fatou Bensouda wird zwar gesagt, sie gelte als „umsichtig und besonnen“. (10) Allerdings wirkt die ehemalige Staatsanwältin und Ministerin aus Gambia bereits seit 2004 als Stellvertreterin des Chefanklägers „im zweiten Glied“ und gilt als treue Dienerin ihres Herrn. Bensouda, bekannt für ihre „imposante Statur und ihre kaleidoskopische Garderobe“ (11), wurde im Dezember 2011 per Akklamation und ohne Gegenkandidatur von den 120 Mitgliedsländern des Rom-Statutes gewählt. Sie wird zunächst umfassend damit beschäftigt sein, das von ihrem Vorgänger zurückgelassene Erbe zu schultern.
Schwer zu tragen hat sie vor allem an dem dubiosen wie skandalösen Verfahren gegen Laurent Gbagbo, dem gewaltsam abgesetzten Präsidenten von Côte d’Ivoire. Der Untersuchungshäftling soll, nachdem er erstmals im Dezember 2011 dem Gericht vorgeführt worden war, vom 18. Juni an mit den Vorwürfen bezüglich des Bürgerkrieges 2011 konfrontiert werden – von Moreno Ocampo erhoben, demnächst von Bensouda vertreten.
Gbagbo, der kolonialkritische Historiker und Politiker, dessen Front Populaire Ivorien (Ivorische Volksfront) der Sozialistischen Internationale angehört, regierte das westafrikanische Land von 2000 bis April 2011. Seine Verfolgung demonstriert prototypisch nicht nur die Rolle des Gerichtshofes als Partei. Auch wird deutlich, wie der reiche Norden der Erde das ICC für seine Zwecke funktionalisiert. Vor diesem Hintergrund könnte schon der erste Fall, den Chefanklägerin Bensouda eigenständig betreuen wird, zum Fanal werden – für sie und für das Gericht. Wenn alles mit rechten Dingen zuginge.
Der Fall Gbagbo
Doch ist bereits die Story vom Haftbefehl gegen Gbagbo so zwiespältig wie geschichtsträchtig. „Abidjan, le 14 décembre 2010“ steht als Datum im Briefkopf des „Président“ der „République de Côte d’Ivoire“. Unterschrieben ist das Dokument (12), das an den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofes gerichtet ist, von Alassane Ouattara. Der Freund von Frankreichs Präsidenten Nicolas Sarkozy und – als Anhänger der ehemaligen Kolonialmacht – langjähriger Gbagbo-Konkurrent, befand sich an jenem 14. Dezember 2010, geschützt von UN-Blauhelmtruppen, im mondänen „Golf Hôtel“ der ivorischen Metropole Abidjan, 306 klimatisierte Zimmer, „angenehm ausgestattet, Blick auf die Lagune, den Swimmingpool oder die Bay of Cocody“. (13) Die Auseinandersetzungen um das Ergebnis der Stichwahlen vom 28. November 2010 nahmen groteske Züge an. Beide, Gbagbo im Präsidentenpalast, Ouattara aus dem Golfhotel, erklärten sich zu Siegern und ließen sich vereidigen.
Die Zeit zum Reden, für Verhandlungen zwischen den Rivalen, eines vernunftgesteuerten Umgangs mit zweifelhaften Stimmergebnissen und auf Korruption deutenden Inszenierungen schien zwingend gekommen. Doch sie brach nie an. Sarkozy hatte rasch seinen „bon ami“ anerkannt, die „internationale Gemeinschaft“ war überraschend schnell gefolgt, selbst die Afrikanische Union erkannte Ouattara an. Ohne indes die Folgen zu bedenken. Der seit 2002 anhaltende Konflikt drohte erneut in Krieg umzuschlagen. Die Westafrikanische Gemeinschaft ECOWAS spielte mit dem Szenario einer militärischen Intervention zugunsten ihres und des Westens Favoriten. Folglich konnte sich „Le Président“ stark fühlen – aber eben nur der eine von zweien.
Während der dramatischen Wochen zu Beginn des Jahres 2011, als sich diplomatische Abordnungen in Abidjan die Klinke in die Hand gaben, blockierte Ouattara die fieberhafte Suche nach einem Ausweg. Der ehemalige Spitzenfunktionär des Internationalen Währungsfonds bewegte sich keinen Millimeter, blieb stur, schien sich seiner sicher, obwohl nun fast der gesamte afrikanische Kontinent auf seine Verweigerungshaltung mit Verständnislosigkeit reagierte. Wusste er, dass die Würfel auf internationaler Bühne längst zu seinen Gunsten gefallen waren? Jedenfalls endete die Doppelherrschaft nach opferreichen Kämpfen, Massakern und Massenfluchten. Letztlich machten die UN-Blauhelme und die französische Legionärstruppe „Licorne“ (Einhorn) den Sieg von Ouattaras Nordarmee klar. Gbagbo wurde nach seiner Festnahme am 11. April 2011 misshandelt, verschleppt und schließlich am 5. Dezember nach Den Haag überstellt.
Der neue starke Mann, der am 21. Mai 2011 offiziell – und widerrechtlich? – das Präsidentenamt übernahm, hatte sich verblüffend weitsichtig gezeigt, als er Den Haag bereits ein halbes Jahr zuvor wissen ließ, dass er die Zuständigkeit des ICC für Côte d’Ivoire anerkenne. Nach dem Triumph über Gbagbo bekräftigte er dies noch einmal; genau so, als wolle er das Gericht drängen, seinen gefangenen Rivalen anzuklagen. Anfang Oktober geschah das schließlich. Der ICC folgte dem Antrag seines Chefanklägers und nahm „Ermittlungen“ auf, die am 23. November 2011 im Haftbefehl gegen Gbagbo mündeten. Er ist der erste ehemalige Staatschef, der vom ICC in Haft genommen wurde.
Gegen Ouattara indes wird nicht ermittelt, obwohl „von beiden Seiten unglaubliche Grausamkeiten verübt worden“ seien. „Gleichwohl sitzen nur die Anhänger Gbagbos auf der Anklagebank“, konstatiert Thomas Scheen, Afrika-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (14). Seine Kollegin von der Zeit, Andrea Böhm, bestätigte das und wies auf absehbare Folgen hin: „Auf dem ICC lastet nun der juristische wie politische Druck, auch gegen die andere, inzwischen regierende Seite zu ermitteln. Gelingt dem Gerichtshof das nicht, so könnte Gbagbos Auslieferung nach Den Haag die Spannungen wieder anheizen.“ (15) Auf etwa die Hälfte der Bevölkerung „wirkt die gewaltsame Machtübernahme Ouattaras mit Unterstützung der französischen Armee wie eine zweite Kolonisierung und der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten wie Siegerjustiz“. (16)
Die „Einhörner“ bleiben
Die Rekolonisierung der Côte d’Ivoire hat das Land lediglich formal wiedervereinigt. Der Riss zwischen den Parteien, Ethnien und Religionen ist tiefer denn je. Ende Januar 2012 machte Ouattara seinen Antrittsbesuch bei Nicolas Sarkozy und unterzeichnete ein „neues Verteidigungsabkommen“. Entgegen seinen 2007 verkündeten Pläne, vom afrikanischen Kontinent abzuziehen, erklärte Sarkozy nun, dass die nahe dem Flughafen von Abidjan stationierte „Force Licorne“ „dauerhaft“ (17) im Land bleibe.
Der ICC indes bestätigte in Côte d’Ivoire seine dem Westen verpflichtete Afrika-Politik. Seit Eröffnung 2003 hat sich der Court nach und nach als eine Institution etabliert, die innerhalb internationaler Machtstrukturen selbst zur politischen Partei geworden ist, ausgerichtet auf das Recht des Stärkeren. Einseitig griff er in politische und bewaffnete Prozesse ein, die nach Besonnenheit verlangen.
Der proklamierte Vorsatz des ICC, durch das Verfolgungsbeispiel – wir kriegen euch alle! – potenziellen Tätern präventiv Einhalt zu gebieten, wirkt unglaubwürdig, solange die wichtigsten Protagonisten von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression – jenen vier Delikten des Humanitären Völkerrechts, zu denen der ICC laut Rom-Statut arbeiten soll – keinerlei Furcht vor Verfolgung zu haben brauchen.
Unbehelligte Kriegsverbrecher
Vom Gerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden können lediglich Täter aus einem Staat, der das Statut ratifiziert hat. Das trifft auf derzeit 120 Länder zu, darunter alle 27 EU-Mitglieder. 32 Staaten haben das Statut signiert, aber nicht ratifiziert. Etwa 40 stehen abseits. Auch politische und ökonomische Schwergewichte wie Russland und China haben sich dem Rom-Statut aus unterschiedlichen Gründen nicht angeschlossen. Einen Sonderweg beschritt die Supermacht USA, die seit geraumer Zeit auf krasseste Weise das Völkerrecht verletzt. Das macht ihre Akteure zu den potenziell wichtigsten Angeklagten des ICC. Washington unterzeichnete zwar im Jahr 2000 das Rom-Statut – vor allem wohl, um seiner Menschenrechtsrhetorik nicht zu schaden. Doch bereits zwei Jahre später erklärte es demonstrativ, es ziehe seine Signatur zurück und werde das Statut nicht ratifizieren – ein in der Diplomatie mehr als unüblicher Vorgang, den ansonsten lediglich Israel und Sudan praktizierten.
Man wolle „beobachten“, in welche Richtung sich der ICC entwickeln werde, ließ die US-Seite wissen. In Wirklichkeit beförderte der „Krieg gegen den Terror“ Washingtoner Bedenken. Inzwischen stehen Guantánamo, Abu Ghuraib, das System geheimer Folterlager, Afghanistan und der Irak inklusive der Giftgas-Lüge des US-Außenministers Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat im Februar 2003 als Synonyme für den Bruch des Völkerrechts. Sie verlangen, ja, rufen geradezu nach dem Internationalen Gerichtshof. Washington setzt derweil auf bilaterale Abkommen, in denen US-Bürgern von den jeweiligen Vertragspartnern Straffreiheit gewährt wird.
George W. Bush und Anthony Blair, so meinte einst der britische Rechtsanwalt Steven Kay, besäßen einen „eingebauten Immunitätsschutz“. (18) Zwar können Anklagen in Den Haag auch auf Antrag des UN-Sicherheitsrates und auch auf Betreiben des ICC selbst erhoben werden, doch damit rechnet niemand. Washington braucht angesichts der internationalen Kräftekonstellation nicht zu fürchten, dass die Gesichter von Ex-Präsident Bush, des Kriegsverbrechers, und seines Nachfolgers ebenso wie deren schuldig gewordenes Personal auf ICC-Steckbriefen verewigt würden. Folglich behalten die drei Haftbefehle gegen amtierende und ehemalige Präsidenten afrikanischer Staaten einen faden Beigeschmack – was im Übrigen insgesamt für die bisherige ICC-Praxis gilt.
Der Fall al-Bashir
Etwa zwei Dutzend Fälle werden vom ICC behandelt. Aus Uganda betrifft das vier führende Mitglieder der Lords Resistance Army, einer gefürchteten Rebellengruppe. Prozesse gegen fünf Angeklagte aus der Demokratischen Republik Kongo – Beteiligte an den Rohstoff-Kriegen zwischen 1995 und 2003 in den Nordostprovinzen – laufen oder wurden kürzlich beendet; darunter auch der gegen Thomas Lubanga Dyilo, einen Milizenführer, dem die Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten vorgeworfen wird – grausame Tatbestände. Allerdings bleibt, auch was die Kongo-Prozesse betrifft, offen, warum andere Involvierte wie der ruandische Präsident Paul Kagame unbehelligt bleiben sollen. Immerhin galt und gilt dessen Hauptstadt Kigali immer noch als Hauptumschlagplatz für die mit viel Blut und Waffen bezahlte Ware aus dem Kongo: Coltan, Edelsteine, Gold, angekauft von westlichen Konzernen.
Vier anhängige Fälle betreffen die Kämpfe um das westsudanesische Darfur. Unter anderem wurde auf Moreno Ocampos Antrag hin 2008 erstmals Haftbefehl erlassen gegen einen amtierenden Präsidenten, Sudans Staatsoberhaupt Omar Hassan al-Bashir. Nicht nur arabische Staaten und die Afrikanische Union kritisierten das Vorgehen. Die politischen Folgen seien unabsehbar. Der Gerichtshof gefährde mit seiner Entscheidung die Friedensverhandlungen – ab Oktober 2007 unter Vermittlung von Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi geführt – zwischen Aufständischen und der Zentralgewalt. Tatsächlich argumentierten darfurische Rebellengruppen später mit dem Haftbefehl. Zugleich allerdings entstand, vom ICC sicher nicht gewollt, eine breite afrikanische Solidarisierung mit al-Bashir. Alle AU-Mitglieder außer Botswana und Tschad erklärten, sie würden – bei Staatsbesuchen al-Bashirs oder auf politischen Gipfeln – den Haftbefehl ignorieren. Dafür werden sie vom ICC bis heute getadelt.
Der Fall al-Gaddafi
Auch die Zentralafrikanische Republik und die Republik Kenia gehören zu den Schauplätzen, auf die der ICC seinen Fokus gerichtet hat. Ebenso wie Libyen. Aus dem Maghreb-Land sollen zwei führende Politiker angeklagt werden – Saif al-Islam Gaddafi und Abdullah al-Senussi. Unklar blieb, ob ihnen nicht in Libyen selbst ein „kurzer Prozess“ gemacht werden wird. Indes wurde am 22. November 2011 das Verfahren gegen Muammar al-Gaddafi wegen „seines Todes eingestellt“, wie der ICC lapidar mitteilte.
Bezüglich der ehemals „Sozialistischen Arabisch-Islamischen Volksrepublik Libyen“ hatte sich Moreno Ocampo schon bald nach Aufstandsbeginn Mitte Februar 2011 aufgeschlossen gezeigt mitzumischen. Libyen ist zwar, wie auch Sudan und Côte d’Ivoire, kein Mitglied des Rom-Statutes, doch wurden schon am 3. März Ermittlungen eingeleitet und im Mai Haftbefehle gegen Gaddafi, seinen Sohn Saif al-Islam und seinen Schwager al-Senussi beantragt. Während französische und britische Kampfjets mit Bomben und Raketen die Niederschlagung des monarchistisch-islamisch beeinflussten Aufstandes verhinderten, die öffentliche Infrastruktur zerstörten und ungezählte Menschen töteten, unterstützte der ICC den völkerrechtswidrigen Krieg mit juristischer Logistik. „Mit ihrer Entscheidung sind die drei Richter dem Gesuch von Chefankläger Luis Moreno Ocampo in Rekordzeit gefolgt. Gerade sechs Wochen ist es her, dass der argentinische Chefankläger in Den Haag Haftbefehl gegen Gaddafi und seine engsten Vertrauten beantragte.“ (19)
Die strafrechtliche Verfolgung al-Gaddafis durch den Haager Hof wurde Teil der propagandistischen und militärischen Treibjagd. Der „Übergangsrat“ der bunten Rebellentruppen setzte ein Kopfgeld von 1,7 Millionen US-Dollar aus. NATO-Flugzeuge und schwer bewaffnete Aufständische trieben den Oberst schließlich in die Falle. Mit Erlass des Haftbefehls durch den ICC waren Gefangennahme, Misshandlung und Erschießung des arabischen Afrikaners wenn nicht direkt vorbereitet, so doch massiv befördert worden. Dazu gehören auch die Qualen, denen der Oberst seitens der „Befreier“ Libyens ausgesetzt war: „Auf Handybildern ist einer der Rebellen zu sehen, wie er dem Diktator einen Stock in den After stößt und sich ein dunkler Fleck auf der Khakihose ausbreitet.“ (20)
Angesichts der grausamen Bilder sowie der tagelangen Zurschaustellung von Gaddafis Leichnam sah sich Moreno Ocampo gezwungen, Ermittlungen zu den Todesumständen des Staatsoberhauptes anzukündigen. Es gebe den „ersten Verdacht“ eines „Kriegsverbrechens“, verkündete er in New York vor dem UN-Sicherheitsrat. Ermittler seien in Libyen gewesen, „um der Übergangsregierung ihre Bedenken zum Tod Gaddafis vorzubringen und die Aufklärung und Verfolgung von Kriegsverbrechen während des monatelangen Konfliktes zu besprechen“. (21) Zu seiner eigenen Verwicklung in den Mordfall Gaddafi schwieg der Chefankläger. Das fatale ICC-Engagement darf offensichtlich nicht zu einem Thema werden – weder in Libyen noch Sudan noch Côte d’Ivoire. Es spricht grundsätzlich gegen die Existenz des ICC.
Druck ausüben
Dass der Gerichtshof zu einem Herrschaftsinstrument gegen Unbotmäßige werden würde, die den Vorgaben von „Freedom and Democracy“ nicht folgen, mochten viele seiner ursprünglichen Befürworter nicht einmal denken. Gegen Mitte der 1990er Jahre, als das „Projekt Weltgericht“ debattiert wurde, waren die über 1500 beteiligten Nichtregierungsorganisationen, die sich zur „Koalition für einen internationalen Strafgerichtshof“ zusammenschlossen, von ihrer Idee überzeugt. Auch angesichts zunehmender Übergriffe in Konfliktgebieten erhofften sie, dass bereits die Existenz eines internationalen Gerichtes Druck auf mutmaßliche Täter ausüben könnte, ein Glaube, dem Moreno Ocampo heute noch anhängt.
„Wir setzen auf Abschreckung. Politische Führer können nicht mehr davon ausgehen, dass sie straffrei bleiben.“ (22) Seine Kollegin Carla del Ponte dagegen bezweifelt den „Präventionseffekt“. Enttäuschend sei diesbezüglich der Status quo. „Vielleicht braucht es mehr Zeit. Vielleicht braucht es einfach mehr Zeit.“ Hilflosigkeit und vielleicht auch Naivität klingen durch, wenn die langjährige Chefanklägerin (1999-2007) im Jugoslawien-Tribunal ICTY (23) versucht, Rolle und Wirkung des ICC zu bewerten.
UN-Sondergerichte
Carla del Ponte und ihre Kollegen an anderen in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten eingerichteten UN-gestützten Sondertribunalen, die „ad hoc“ und zeitlich beschränkt zu Konflikten und Kriegen in einzelnen Ländern geschaffen wurden, klagen individuelle Schuld an. Diese wird ausnahmslos unabhängig von historischen und politischen Rahmenbedingungen betrachtet. Ausgeklammert bleiben in allen ICC-Fällen, aber auch in Sachen Ruanda und Jugoslawien, die Ursachen und Hintergründe für Völkerrechtsbruch, die in der Regel mit kolonialen Strukturen, neokolonialer Ausbeutung und westlichen Machtansprüchen in untrennbarer Verbindung stehen. Ein derart eindimensionales Herangehen schließt per se nicht nur die Sieger als Verdächtige aus, sondern sorgt zudem für eine genehme Auswahl der Angeklagten.
Unterwerfung des Südens
Mit seiner „puristischen“ Herangehensweise passt sich der ICC in eine Politik zur Unterwerfung des Südens ein – wie vor dem ICC Luis Moreno Ocampo, so in den UN-gestützten Tribunalen zu Jugoslawien und Ruanda die Schweizer Juristin Carla del Ponte, ehemals Bundesanwältin der Alpenrepublik. Sie habe das „Humanitäre Völkerrecht mit Leben erfüllt“, lobte jüngst die westdeutsche Juristin Jutta Limbach. (24) Diese hatte sich einst selbst im Anschlussverfahren der DDR an die Bundesrepublik als Westberliner Justizsenatorin scharf profiliert und war dann zur Chefin des Bundesverfassungsgerichtes aufgestiegen.
Limbach sagt über del Ponte, als „Ausbund an Willenskraft und Kampfgeist, an Beharrlichkeit und Furchtlosigkeit, an Gerechtigkeitssinn, Selbstdisziplin und Durchsetzungsvermögen“ so etwas wie ein Ebenbild ihrer selbst: „Sie ist nicht müde geworden, die Völkergemeinschaft in die Pflicht zu nehmen, um die Ergreifung der Verdächtigen zu erreichen. Der Vorwurf, sie politisiere, wenn sie öffentlich über Sanktionen gegen untätige Balkanstaaten nachdachte, hat sie nicht bekümmert.“24
Chefanklägerinnen nehmen die „Völkergemeinschaft“, die es nicht gibt, „in die Pflicht“ und fordern schon mal Strafmaßnahmen („Sanktionen“), wenn verschiedene Länder („Balkanstaaten“) sich ihrem, im Interesse des Westens liegenden, Postulat nicht beugen. „Wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die Macht hat, hat das Recht“, sang einst Rio Reiser in Agitpropmanier. Sonderbar, dass seine holzschnittartige Beschreibung der hässlichen BRD-Klassenjustiz so genau übertragbar scheint auf internationale Institutionen. Um Parteilichkeit zu rechtfertigen, wird das Recht als objektiv und das Gericht als neutral bezeichnet. So wird es möglich, die eigene Beteiligung am Unrecht auszublenden.
Ein Kreuz für jeden
Mit geradezu verblüffender Offenheit entgegnete Carla del Ponte einst auf die Bemerkung, dass in ihrem Arbeitszimmer in Den Haag Fahndungsplakate an der Wand hängen: „Ja, wir haben sie durchgestrichen, die Gesuchten, wenn wir sie verhaftet hatten. Milošević war natürlich sehr groß drauf, und als wir wussten, dass er zum Haag kam, strichen wir ihn durch.“ (25) Ein Kreuz für den politischen Gefangenen Slobodan Milošević, Präsident der Republik Serbien (1989-1997) und der Bundesrepublik Jugoslawien (1997-2000), zu Zeiten, als die NATO ihren Angriffskrieg begann.
Milošević blieb das einzige Staatsoberhaupt, das von del Ponte angeklagt wurde. Seine Kollegen Franjo Tudjman in Kroatien, Alija Izetbegović in Bosnien-Herzegowina und Hasim Thaci in der sich als „Republik“ verstehenden serbischen Provinz Kosovo blieben ungeschoren, obwohl sie während der Sezessionskriege ihre katholischen oder muslimischen Söldner befehligten. Als Frau del Ponte nach ihrer Demission in Den Haag, und also sehr spät, zu spät, in ihren Memoiren vom Ausschlachten serbischer Gefangener für den Organhandel durch die vom heutigen Premier angeführte, von US-Ausbildern gedrillte paramilitärische UCK (Befreiungsarmee des Kosovo) berichtete, hörte ihr kaum noch jemand zu. Thaci stand auf der richtigen Seite und wurde kürzlich von Angela Merkel besucht. Als „Mutter der Kosovaren“ sei sie gefeiert worden, die Kanzlerin, „die sich entschlossener als die kosovarische Regierung in Priština für die Interessen des Kosovo einsetzte“. (26) Also gegen die serbischen Interessen.
Niemals wurde auch nur erwogen, den deutschen Verteidigungsminister Rudolf Scharping juristisch zu belangen, weil er einen – frei erfundenen – „Hufeisenplan“ zur Rechtfertigung des Kosovo-Krieges präsentiert hatte. Darin wurde behauptet, dass Milošević‘ Volksarmee die systematische Vertreibung und Vernichtung von albanisch-stämmigen Kosovo-Flüchtlingen vorhabe. Oder Gerhard Schröder und Josef Fischer, die den Schwur der KZ-Häftlinge ignorierten, wonach nie wieder Krieg ausgehen dürfe von deutschem Boden, und erst recht nicht gegen ehemals besetzte Länder. Bomben auf Belgrad, ausgerechnet Belgrad.
Die enttäuschte Kopfjägerin
Über Slobodan Milošević sagt del Ponte immer noch: „Natürlich ist er ein Krimineller“. (27) Der 64-Jährige, gesundheitlich schwer angeschlagen, starb in seiner Zelle des Haager Gerichtshofes am 11. März 2006. Anträge zur Behandlung in einem Moskauer Spezialkrankenhaus waren abgelehnt worden. Das Verfahren wurde nach viereinhalbjähriger Prozessdauer ohne Abschlussbericht eingestellt. Carla del Ponte – „während seiner Aussagen war er wirklich fähig, muss ich sagen. Natürlich hat er seine Fähigkeiten in eine negative Richtung ausgebildet“27 – blieb bis 2007 im Amt, acht Jahre und vier Monate lang. Auf die Frage nach ihrer schwersten Niederlage antwortet sie: „Milošević. Die größte Niederlage war der Tod von Milošević, denn damit entging er seiner Verurteilung. Wir waren fast fertig mit dem Prozess, und ich hatte mein Plädoyer schon vorbereitet, da starb er. Das war eine große Enttäuschung.“ (28)
Als die Kopfjägerin enttäuscht Den Haag verließ, standen die beiden serbischen Bosnier Ratko Mladić und Radovan Karadžić noch auf dem Fahndungsplakat. Letztgenannter hatte während der Dayton-Verhandlungen zur Beendigung des Bosnien-Krieges 1995 Straffreiheit für sich ausgehandelt. Als er 2008 verhaftet wurde, wollte der direkt beteiligte US-Unterhändler Richard Holbrooke allerdings nichts mehr davon wissen.
Wie naiv-tolldreist muss man sein – oder zumindest vorgeben zu sein – um in höchste Funktionen der internationalen Gerichte in Den Haag zu gelangen? Carla del Ponte beispielsweise bemängelt die, wegen der Souveränität von Staaten, eingeschränkten Möglichkeiten, vermeintlicher Täter habhaft zu werden. Ihre Schlussfolgerung: „Es wäre natürlich vorteilhaft, wenn die internationale Justiz eine Polizei hätte, die auf der ganzen Welt verhaften, Hausdurchsuchungen und andere Zwangsmaßnahmen ausüben könnte. Fantastisch!“ (29) Das Weiße Haus allerdings würde nicht behelligt, schon dessen Erwähnung führt in eine „negative Richtung“. Danach gefragt, antwortet sie genervt: „Ich weiß nicht, warum Sie George Bush erwähnen. Ich würde niemanden namentlich nennen.“ Westliche Politiker könnten nicht angeklagt werden, weil sie nichts verbrochen hätten. „Denn wir sprechen hier von Straftaten, wir sprechen nicht von Politik.“ (30)
Wahrheitssucher Handke
Peter Handke, im Krieg gegen den jugoslawischen Vielvölkerstaat zunächst der von der westlichen Welt gescholtene, dann geächtete Wahrheitssucher, ein literarischer Hochkaräter, besuchte den Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. „Rund um das Große Tribunal“, so der Titel seiner Beobachtungen, träten „im Namen der Welt“ Strafverfolger und Straffahnder auf, die sich gar als „die Protagonisten und darüber hinaus die Künstler einer neuen, unerhörten Epoche“ fühlen würden. Als „Parteien“, denn „auch die internationalen Richter, indem sie im Sold der ,Weltgemeinschaft‘ und ihr Amt der Sache gemäß nie und nimmer gegen diese Gemeinschaft (Europäische Union, NATO, USA etc.), sondern ausschließlich gegen den inzwischen fast stimmlosen Rest vom Rest der Welt ausüben, sind ja Partei“ (31) – zudem großmächtig und mit vielerlei Zwangs- und Gewaltmitteln ausgestattet. Handke fragt, nach welchem Gesetz denn Unrecht abgeurteilt werde. „Und welche Welt wird gemeint, wenn heute in unseren Zonen öffentlich ,die
Welt‘ ausgesprochen und verlautbart wird?“ (32)
Das Jugoslawien-Tribunal dauert an und erlebt 2013 mindestens noch das zwanzigste Jahr seiner Existenz. Es wird, nach all dem Trouble um sein tendenziell einseitiges Vorgehen gegen die serbischen Verlierer beim Streit um Erhalt oder Zerschlagung des Vielvölkerstaates, zumindest den Schein eines fairen Verfahrens gegen Radovan Karadžić wahren müssen. Das scheiterte im Fall Milošević an der fundierten, unbeirrten Gegenbeweisführung des Angeklagten, der so manches Mal das Gericht vorführte. Auch das war möglich, auch wenn es – natürlich nicht – medial gewürdigt wurde.
Die Zerstörung Jugoslawiens ließ sich nicht anders als in antiserbischer Pose und Aktion rechtfertigen. Die Etablierung der neuen südslawischen Staaten Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und, noch überwiegend nicht anerkannt, Kosovo fand in Konfrontation mit Belgrad statt. Diese hält trotz aller Lockrufe der EU bis heute an. Carla del Ponte, zur Schweizer Botschafterin in Argentinien (2008-2011) aufgestiegen, kritisiert, dass ihr Nachfolger in der Chefanklage zu Den Haag, Serge Brammertz, ihre einst knallhart antiserbisch ausgerichtete Prozessstrategie nicht „gewechselt“ hat. Schließlich wollten die Serben inzwischen „kooperieren“, meint sie fernab jeglicher politischer Strategien. „Also muss man sie loben.“ (33)
Geld und Macht
Del Ponte ist nicht Moreno Ocampo, nicht Bensouda. Personen stehen lediglich für Institutionen, in diesem Fall internationale Gerichte. Von denen gibt es in Den Haag – neben dem vom Sierra-Leone-ad hoc-Tribunal wegen befürchteter Unruhen ausgelagerten Prozess gegen Liberias ehemaligen Staatschef Charles Taylor – noch den bereits 1945 gegründeten Internationalen Gerichtshof (International Court of Justice, ICJ), der für die Rechtsprechung der Vereinten Nationen zuständig ist. Er soll sich um Streitangelegenheiten zwischen Staaten kümmern und demonstriert, wie die anderen auch, doch meist nur, wie er sich der Weltordnung angepasst hat. 1999 schaffte er es sogar, die jugoslawische Klage gegen den Angriffskrieg der NATO abzulehnen, weil ja die Klägerin in ihrer ursprünglichen Gestalt als Jugoslawien nicht mehr existierte und also kein Mitglied laut ICJ-Statut sei.
Immerhin verfügt dieser Gerichtshof mit dem „Friedenspalast“ in Den Haag über einen repräsentativen Sitz. Dieser fehlt dem ICC. Für das nüchterne Bürogebäude der ING Real Estate an der Ecke Maanweg/Regulusweg im Stadteil Laak muss Miete gezahlt werden. Das soll sich spätestens 2015 ändern. Dann soll ein nagelneuer, noch zu errichtender ICC-Komplex bezogen werden. Die Zeit drängt. Schon jetzt kommt die mit einigen Dutzend Beschäftigten 2003 gestartete Behörde auf 750 Mitarbeiter. Allein etwa 300 von ihnen, ein Riesenheer, arbeiten für die Anklage. Weit über 100 Millionen Euro kostet der Apparat jährlich, aufgebracht von den Mitgliedsländern mit Japan und der BRD an der Spitze. (34)
Das Grundstück für den zukünftig dauerhaften ICC-Sitz steuern die Niederlande bei. Die Baufinanzierung wird durch großzügige Kredite abgedeckt. Für Sicherheit und ein angenehmes Ambiente ist auch gesorgt: Das Gelände gehört zur Alexanderkaserne und liegt im Haager Seebad Scheveningen.
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund Heft 2/2012.