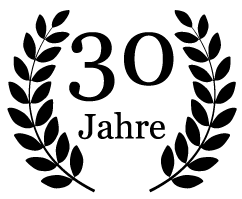Das Gespenst der Multipolarität
Was den Westen wirklich an Russland stört
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Es ist ein Mechanismus, nach dem man mittlerweile die Uhr stellen kann: Sobald im politischen Betrieb des Westens etwas tatsächlich oder nach dem Ermessen wichtiger Interessengruppen schiefläuft, dauert es nur Stunden, bis der erste Verdacht gegen Russland oder China geäußert wird. Ob in den USA der aus Sicht von Teilen des Establishments Falsche Präsident wird oder in Berlin irgendwelche Privatdaten von Politikern geleakt werden, stereotyp heißt die Devise: Cherchez le Russe. Und auch wenn – im letzteren Fall – ein zwanzigjähriger Nerd aus Mittelhessen als Urheber ermittelt wird, ist es wie in Lessings Nathan: Wenn man ihnen dieses Mal nichts hat nachweisen können, dann eben beim nächsten Mal.
Natürlich ist es unmittelbar nicht falsch zu sagen, so gehe eben Feindbildpflege, und natürlich kann man die Infamien und Lächerlichkeiten, zu denen sich diese Feindbildpflege versteigt, im laufenden Betrieb kritisieren oder dem Spott preisgeben. Nur erklärt das nicht, warum es genau dieses Feindbild ist und kein anderes. Hierzu nachstehend ein paar Überlegungen.
Was stört den Westen NICHT an Russland?
Ganz sicher nicht die Systemfrage. Die ist seit 1991 erledigt, als die Sowjetunion ihren konkurrierenden Gesellschaftsentwurf aufgab und sich der allein selig machenden Lehre des Kapitalismus anschloss. Russland wollte sich in den Weltkapitalismus integrieren. Aber dieser Wille wurde vom Westen systematisch mit solchen Konditionen versehen, dass er, was die Seite der Integration angeht, inzwischen auf eine harte Probe gestellt wird. Russland wurde insbesondere durch die Sanktionen auf einen Weg paralleler kapitalistischer Entwicklung mehr gestoßen, als dass es ihn gewählt hätte. Neu ist das aus russischer Sicht freilich nicht: Unter Stalin stand die Sowjetunion vor ähnlichen Herausforderungen, nämlich ihre Modernisierung aus eigener Kraft zu bewerkstelligen. Dass Stalin also heute in Russland differenzierter betrachtet wird, als nur zum «Massenmörder» gestempelt zu werden, muss niemanden wundern.
Eine ganze Reihe von Vorwürfen betrifft die inneren Verhältnisse Russlands. Die Kritik läuft darauf hinaus, dass es in Russland anders zugehe – anders als nicht etwa im realen Leben der kapitalistischen Welt, sondern anders, als es die idealistischen Verbrämungen imperialistischer Politik verlangen. Der Großteil dieser Vorwürfe fällt zumindest insofern auf den Westen selbst zurück, als er sie gegenüber Russland – ob sie in der Sache nun berechtigt sind oder nicht – selektiv und damit heuchlerisch erhebt. Sind vielleicht Geschäftsleute, die politischen Einfluss nehmen und ihr Geld steuervermeidend ins Ausland schaffen, eine in der «freien Welt» unbekannte Erscheinung? Es wird so getan, indem man für diese Gruppe ein neues Wort in Umlauf bringt und sie «Oligarchen» nennt. Korruption mag in Russland verbreitet sein – und sie ist sicher vom kapitalistischen Standpunkt aus als Erhöhung der Transaktionskosten unerwünscht, weswegen auf diesem Thema auch ständig öffentlich herumgeritten wird –, aber das Land befindet sich mit einem Hoffnungsträger des Westens auf gleichem Fuß: Der Korruptionsindex von Transparency International – nur einmal als gängige Währung in der Diskussion zitiert, ohne seine Grundannahmen inhaltlich zu hinterfragen – lässt Russland auf Platz 135 und die Ukraine auf Platz 130 vergleichbar schlecht aussehen 1. Dabei hat sich die Position der Ukraine in den Jahren seit dem Euromaidan nach derselben Quelle nicht etwa verbessert, sondern verschlechtert 2, sie ist also nach dieser Dynamik auf dem besten Wege nicht in die «euroatlantische Zivilisation», sondern in Richtung «russischer Verhältnisse». Notorische Mafiastaaten wie Kosovo oder Montenegro erfreuen sich wohlwollender westlicher Betreuung, letzterer wurde im Jahr 2017 sogar in die NATO aufgenommen, um die Adria zum mare atlanticum zu machen. Korruption stört den Westen also nicht, wenn sie auf der geopolitisch richtigen Seite auftritt.
Die «multipolare Ordnung»
wird, falls sie zustande
kommt, gestützt auf
die «Pole» Washington,
Moskau, Peking und vielleicht
Brüssel, ein Dreier-
oder Viererdirektorium
werden, das an die Situation
vor dem Ersten Weltkrieg
erinnert.
Eindringen in fremde Computernetze? Kerngeschäft aller Geheimdienste, mit der NSA an der Spitze. Trotzdem fiel Angela Merkel, als das Hacking ihres eigenen Mobiltelefons bekannt wurde, nicht mehr ein, als zu behaupten: Verbündete auszuspionieren, das «geht nun wirklich überhaupt nicht». Doch, Mutti, es geht.
Was undemokratische innere Verhältnisse angeht, so haben der NATO-Partner Recep Tayyip Erdoğan, der mit US-Hilfe an die Macht gebrachte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro oder der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte mit Sicherheit mehr Dreck am Stecken als Wladimir Putin. Und dass Russland Kriege in seinem Umland führe? Das unterscheidet das Land, selbst wenn es so stimmen würde, wie es behauptet wird, nicht von etlichen Protégés des Westens wie Israel und Saudi-Arabien. Und apropos Saudi-Arabien: Nach dem Fall Jamal Chaschukdschi sollte es eigentlich um die Affäre Skripal im Westen ganz schnell totenstill werden. Der erste Durchgang zeigt also: keine Scheußlichkeit, die der Westen Russland anlastet, die er nicht selbst begeht oder zumindest durchgehen lässt.
Was stört den Westen wirklich an Russland?
Gern wird im Westen behauptet, Russland habe mit der «Annexion» der Krim die «Friedensordnung nach dem Ende des Kalten Krieges» verletzt. Das ist in mehrerer Hinsicht verlogen. Erstens deshalb, weil nach dem Ende des (ersten) Kalten Krieges keine Friedensordnung eingetreten, sondern das Kriegführen leichter geworden ist. Es standen noch sowjetische Truppen in Ostdeutschland, als die auferstandene Regionalmacht BRD schon die Aufteilungskriege in Jugoslawien nicht nur politisch förderte, sondern die neuen Klientelstaaten gleich noch mit nicht mehr benötigten NVA-Waffen ausstattete. Im Nahen Osten führten die USA schon im Jahr 1991 den ersten Krieg, so wie sie ihn sich vorstellten: selbst provoziert – Saddam Hussein hatte die USA vorab über seine Pläne gegenüber Kuweit informiert und zu hören bekommen, die USA seien in der Frage desinteressiert –, aus einer Position vollständiger Überlegenheit und mit dem Ziel, dem Rest der Welt klarzumachen, wo künftig der Hammer hängt. Ist es Zufall, dass Saddam Hussein ein langjähriger Verbündeter der Sowjetunion war?
Falsch ist die Formel von der «Friedensordnung nach dem Ende des Kalten Krieges» auch insofern, als es ein Euphemismus ist, den nach 1991 eingetretenen Zustand eine «Ordnung» zu nennen. «Ordnung» setzt jemanden voraus, der ordnet, und jemanden, der sich ein- oder unterordnet und somit die eigene Subalternität anerkennt. Also ein entschiedenes Kräfte- bzw. Unterwerfungsverhältnis. Diese Genugtuung hatte der Westen mit Blick auf Russland nur wenige Jahre in den Neunzigern. Aber das hat ihn auf den Geschmack gebracht. In Russland waren damals Leute an der Macht, die nicht nur unfähig, sondern auch unwillig waren, der Expansion des einstigen Gegners etwas entgegenzusetzen. Ob Michail Gorbatschow im Jahr 1990 wirklich so dumm oder vertrauensselig war, sich das im Zuge der «2 + 4»-Gespräche gegebene mündliche Versprechen, der Westen werde sich über das Gebiet der DDR hinaus nicht nach Osten ausdehnen, nicht schriftlich bestätigen zu lassen, ob ihm angesichts der Wirtschaftsprobleme der sterbenden Sowjetunion keine andere Wahl blieb 3 oder ob die Interpretation zutrifft, eine solche Expansion habe damals in Moskau niemand auch nur gedanklich auf dem Schirm gehabt – egal, US-Außenminister James Baker konnte später in seinen Memoiren schreiben, man habe Russland aus Osteuropa «hinausgetrickst»4. Die «Friedensordnung von 1991» hat der Sowjetunion und Russland als ihrem größten Nachfolgestaat eine Niederlage bereitet, die nicht nur materiell, sondern auch bezüglich der politischen Demütigung des unterlegenen Gegners dem nahekommt, was die Gegner des deutschen Kaiserreiches dem republikanischen Nachfolgestaat im Jahr 1919 in Versailles aufzwangen.
Russische Einwände etwa gegen die Förderung der Sezession des Kosovo von Serbien wurden in den 1990er Jahren vom Westen systematisch missachtet; der Moskauer Hinweis, dass dieser Präzedenzfall einer Grenzveränderung ohne völkerrechtliche Grundlage noch schlimme Folgen haben werde, wurde in den Wind geschlagen. Ein paar Regimewechsel später traf es den libyschen Präsidenten Muammar Al-Gaddafi – schon wieder einen der wenigen verbliebenen Alliierten Russlands. Und noch einmal sah Russland dem üblen Spiel aus der Ferne zu, enthielt sich im Sicherheitsrat und protestierte nachträglich. Das war unter dem Präsidenten Dmitrij Medwedjew. Aber die westliche Libyen-Intervention war aus Moskauer Sicht der Rubikon in der Politik gegenüber dem «fernen Ausland»: Noch einmal würde Russland vergleichbaren Alleingängen des Westens nicht tatenlos zusehen.
Solange Russland nur verbal oder symbolisch protestierte, konnte sich der Westen leisten, dies zu ignorieren: so wie im Jahr 1999, als der damalige Ministerpräsident Jewgenij Primakow auf die Nachricht vom NATO-Bombardement Belgrads sein Regierungsflugzeug, mit dem er auf dem Weg nach Washington war, in der Luft umkehren ließ. Als 2007 – zwei NATO-Erweiterungsrunden in Osteuropa immer näher an die Grenzen Russlands und die Aufkündigung mehrerer Rüstungskontrollverträge durch die USA später – Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz den westlichen Unilateralismus erstmals explizit kritisierte 5, taten alle westlichen Zuhörer überrascht. Die Kritik Putins klang im Jahr 2007 noch mahnend verbrämt, fast im Ton alter Fürstenspiegel: Die westliche Politik sei unklug und kurzsichtig, weil sie nur Instabilität säe; Weltherrschaft eines Zentrums könne allenfalls vorübergehend existieren. Aber in ihrer Klarheit und ihrem rhetorischen Schliff machte die Rede Geschichte: Die Kritik, unipolare Herrschaft dauere nie ewig, verweist logisch auf Kräfte, die ihr aktiv ein Ende machen.
Russlands aufgenötigter Antiimperialismus
Anderthalb Jahre nach dieser Rede machten russische Truppen im Kaukasus den georgischen Versuch zunichte, die Anfang der 1990er Jahre von Georgien abgespaltene Region Südossetien gewaltsam zurückzuerobern. Der Fünftagekrieg in Georgien war ein Warnschuss gegen die Annäherungspolitik Georgiens unter Präsident Micheil Saakaschwili an die NATO, und er war einer, der sicher nicht nur der Sorge um das Selbstbestimmungsrecht der Südosseten entsprungen war. Immerhin liegt der südliche Ausgang des unter dem Kaukasus-Hauptkamm hindurch führenden Roki-Tunnels in Südossetien. Eine klassische Wer-wen-Frage: Hätte Russland Saakaschwilis Schlag hingenommen, hätte der nicht mehr nur potenzielle Gegner den Nordausgang der Röhre kontrolliert. Trotzdem verzichtete Russland damals auf die endgültige Demütigung Georgiens durch die Eroberung von Tiflis, die niemand hätte verhindern können. Es ließ sich auf einen von der EU vermittelten Waffenstillstand ein. Die Warnung sollte reichen.
Doch sie reichte nicht. Der Westen nahm zwar zur Kenntnis, dass weitere Expansionsschritte in Osteuropa nicht mehr so glatt ablaufen würden wie bisher. Verzichtet haben NATO und EU auf solche Versuche deshalb noch lange nicht. Wenige Monate nach der taktischen Niederlage in Georgien fiel der EU etwas Neues ein: eine Politik der «Östlichen Nachbarschaft». Sie zielte darauf, die Länder an Russlands westlicher und südlicher Peripherie auch unterhalb der kritischen Schwelle einer EU-Mitgliedschaft – die EU-intern ohnehin wegen ihrer Kosten nicht durchzusetzen gewesen wäre – an diese anzubinden: Es ging darum, ein «nahes Ausland» Brüssels zu schaffen, eben das, was der Westen Russland seit 1991 stets als Hegemonialpolitik vorgeworfen hatte. Am dramatischsten fielen die Ergebnisse dieser Hegemonialkonkurrenz in der Ukraine aus, die im Jahr 2013 von Brüssel vor die Alternative gestellt wurde, sich für eine Einflusssphäre zu entscheiden: EU oder Eurasische Wirtschaftsunion. Die Folgen sind bekannt und müssen hier kein weiteres Mal dargestellt werden. Es reicht festzuhalten, dass der Westen die Beziehungen zu Russland von dem Moment an durch Sanktionen verschlechterte, als Russland sich nicht gefallen ließ, was ihm bei weiterer Tatenlosigkeit gegenüber dem verfassungswidrigen Staatsstreich westlich inspirierter Kräfte in Kiew gedroht hätte: der Verlust der Krim als Marinebasis, von der aus die russische Schwarzmeerküste gesichert, das Schwarze Meer kontrolliert und Macht in den Mittelmeerraum projiziert werden kann. Notfallpläne für diesen Fall lagen sicher schon früher in den Schubladen des Generalstabes in Moskau; im Jahr 2014 wurde diese Karte gezogen. Nebenbei bemerkt: Teil der «Friedensordnung von 1991» – um das Wort ein letztes Mal zu benutzen – war auch die Blockfreiheit der Ukraine und nicht eine Ukraine auf NATO-Kurs. Davon redet im Westen niemand. Das russische Eingreifen in den Syrienkrieg im Herbst 2015 war der nächste Schritt der Demonstration: Mit uns ist wieder zu rechnen. Widerwillig hat der Westen dies zur Kenntnis genommen.
Genau dies, dass Russland der westlichen Expansion nicht mehr nur rhetorischen, sondern auch praktischen Widerstand entgegensetzt, ist der Kern des Konfliktes, und deshalb ist er so prinzipiell und nicht einfach durch einen «Reset» zu beenden. Alles westliche Gerede von «werteorientierter Außenpolitik» verschleiert dies nur mühsam. Denn «Werte» ist ein Begriff, der in der Außenpolitik zunächst einmal nichts zu suchen hat – und übrigens auch vom Westen in der eigenen außenpolitischen Praxis so behandelt wird: maximal als Begleitmusik. Es sei nochmals an solche vom Standpunkt «liberaler Werte» aus nichts als unappetitliche Bündnispartner wie Saudi-Arabien erinnert.
Putin macht sich mit den Machthabern in Riad zwar auch die Finger schmutzig, aber er behauptet auch nicht, werteorientierte Außenpolitik zu betreiben. Das ist die zynische Ehrlichkeit der russischen Position. Außenpolitik ist die Sphäre der Interessen, denn in ihr treten sich Subjekte gegenüber, die einander prinzipiell gleich sind. Und zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt, wusste schon Hegel 6 – mit ihren Abstufungen Erpressung und Kompromiss. Genau zu solchen machtpolitischen Kompromissen sah der Westen keine Veranlassung mehr, als er in den Neunzigern anfing, seine – natürlich faktisch weiterhin interessengeleitete – AußenTrotz politik als «werteorientiert» zu deklarieren. Natürlich fielen ein paar grüne Heulbojen auf diesen Schmarrn herein, aber was beweist das außer den Umstand, dass nicht nur Joschka Fischer bei Madeleine Albright – die den Tod einer halben Million irakischer Kinder im Irakkrieg und infolge der US-amerikanischen Sanktionen für «die Sache wert» erklärte – auf dem Schoß saß und sich von ihr in Praxis des «ethischen Imperialismus» einweisen ließ?
Über Werte gibt es nämlich nichts zu diskutieren. Wer seine Werte exportieren will, verhält sich gegenüber dem Rest der Welt so wie im 19. Jahrhundert die europäischen Kolonialmächte, die für sich beanspruchten, «die Zivilisation» nach Afrika zu tragen, und das auch noch als «Bürde des weißen Mannes» bezeichneten. «Werteorientierte Außenpolitik» ist eine triumphalistische Formel für den Anspruch, keine entgegenstehenden Interessen mehr gelten lassen zu müssen. Immerhin ist der arroganteste Spruch aus jener Zeit westlicher Hybris, der vom «Ende der Geschichte» (Francis Fukuyama) – denn er impliziert, niemand außer den etablierten Akteuren könne mehr als historisches Subjekt auftreten, das Kräfteverhältnis sei ein für alle Mal geklärt –, inzwischen in der Versenkung verschwunden. Die Prognose des USamerikanischen Politikwissenschaftlers hat sich nicht bewahrheitet, eingetreten ist stattdessen das Gegenteil: Multipolarität.
Ein Gespenst geht um …
Es wird heute viel darüber geklagt, dass sich Russland unter Putin «von Europa abgewandt » habe. Die Ironie besteht darin, dass Putin ursprünglich ein russischer Westler und «Europäer» wie aus dem Bilderbuch war. Nur wurde sein Werben um eine gleichgewichtige Einbeziehung seines Landes in den Westen – oder, was hier dasselbe ist, den globalen Norden – von dessen Seite so oft zurückgewiesen und mit klassischer Hegemonialpolitik erwidert, dass er gezwungen war, Russland zu dem zu machen, was er ursprünglich überhaupt nicht vorhatte: einem «Gegenpol» zum westlichen Unilateralismus.
Wer seine Werte exportieren
will, verhält sich gegenüber
dem Rest der Welt so wie im
19. Jahrhundert die europäischen
Kolonialmächte, die
für sich beanspruchten, «die
Zivilisation» nach Afrika zu
tragen, und das auch noch
als «Bürde des weißen
Mannes» bezeichneten.
Dass auf dieser Grundlage inzwischen in Russland eine «orthodox-slawische Zivilisation» herbeigeredet wird, die Russland kennzeichne und die ihrem Inhalt nach ein konservatives Panoptikum ist, ist Folge und nicht Ursache dieser Entwicklung. Ebenso ist es Folge und nicht Ursache, dass auf dieser Grundlage eine Allianz Russlands mit China herangereift ist; die ersten Schritte dazu hatte übrigens der schon erwähnte Jewgenij Primakow eingeleitet, nicht zufällig ein Asienspezialist. Beide ehemals sozialistischen Großmächte haben in einem Punkt ein gemeinsames Interesse: nicht von den «alten» Hegemonialmächten USA und EU in ihre Entwicklung hineinregiert zu werden. Dass die Entwicklungsziele dabei durchaus unterschiedlich sind, begrenzt die Reichweite solcher Allianzen – aber erst langfristig. Putin hat Russland die Aufgabe gestellt, sich als kapitalistische Macht unter den ersten fünf Volkswirtschaften der Welt zu etablieren. Das ist ehrgeizig und kann gelingen oder auch nicht. China verfolgt nachholende Entwicklungsziele zu einer «harmonischen Gesellschaft», die dann vielleicht noch Sozialismus heißt, vielleicht aber auch anders, deren Ziele jedoch mit den humanistischen Postulaten des Sozialismus sicherlich eher vereinbar sind als Russlands Konkurrenzehrgeiz. Der Aufstieg Chinas wird inzwischen selbst von seinen Gegnern als Tatsache akzeptiert, auch wenn die immer aberwitziger wirkende Sanktionspolitik der USA darauf abzielt, ihn noch zu verhindern. Es geht den USA darum, die eigene Hegemonie zu sichern, solange das noch geht, und jeden zu «bestrafen» – mit welchem Recht eigentlich? –, der eigene Ambitionen entwickelt: ob Russland, Iran, Nordkorea oder China. Nicht einmal die Bundesrepublik ist von diesem Furor ausgenommen, wenn sie die Frechheit besitzt, russisches Gas zu beziehen. Die VRC hat die kritische Masse an Menschen, Wissen und Kapital – an der Waffenseite arbeitet sie –, um den USA notfalls den Finger zu zeigen. Russland hat Waffen, die die USA zu einem gewissen Respekt zwingen. Der Rest ist offen.
Man soll die «Multipolarität» der künftigen «Weltordnung» nicht unnütz schönreden, wie Russland das tut – nicht nur deshalb, weil sie von ihren «Polen» den politischen Willen erfordert, ein solcher sein zu wollen. Die Entwicklung Brasiliens vom Hoffnungsträger eines neuen Lateinamerikas unter Lula da Silva zu Trumps Speichellecker unter Bolsonaro illustriert das. BRICS ist als politisches Konzept spätestens damit beerdigt. Die «multipolare Ordnung» wird, falls sie zustande kommt, gestützt auf die «Pole» Washington, Moskau, Peking und vielleicht Brüssel, ein Dreier- oder Viererdirektorium werden, das an die Situation vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Ob, wie Russland offenkundig hofft, daraus ein System abgesprochener Interessenausgleiche werden kann, steht allerdings keinesfalls fest. Der Historiker Fritz Fischer hat in seinen Publikationen gezeigt, wie die Befürchtungen der damaligen deutschen Führung, einem späteren Krieg nicht gewachsen zu sein, sie dazu veranlassten, die Entscheidung lieber heute als morgen zu suchen.7 Und der Hoffnung, dass die inzwischen erreichten Zerstörungspotenziale insbesondere die vom relativen Abstieg bedrohten Teile dieses Direktoriums veranlassen würden, angesichts des Risikos der Selbstzerstörung vom Mittel des Krieges abzusehen, steht eine weitere Erkenntnis des alten Hegel entgegen: «Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben.»8 Auch die Revolutionen im Oktober 1917 und im November 1918 kamen erst nach dem Krieg.