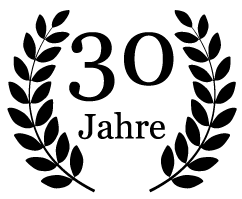Barack Obama als Kriegsherr
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von KNUT MELLENTHIN, 29. März 2009 –
Des Kaisers neue Töne –
Barack Obama hat am 27. März seine seit Wochen angekündigte „umfassende neue Strategie für Afghanistan und Pakistan“ vorgestellt. (1) Damit werden die beiden Länder erstmals hochoffiziell als gemeinsamer Kriegsschauplatz definiert. Denn dort befindet sich, wie der US-Präsident gleich am Beginn seiner Rede in einer auch für Erstklässler leicht verständlichen Diktion und Logik verkündete, nicht nur „der gefährlichste Ort der Welt“ für alle Amerikaner, sondern es steht darüber hinaus „die Sicherheit der Menschen überall auf der Welt auf dem Spiel“. Irgendwo dort in den unwegsamen Bergen des paschtunischen Grenzgebiets liegt die Zentrale des Bösen, die für alle terroristischen Anschläge von London bis Bali verantwortlich ist. Irgendwann wird man die Bösewichte ganz sicher erwischen und damit die „terroristische Bedrohung" ein für alle mal beenden – aber bis dahin kann es noch viele Jahre dauern. So lange muss man afghanische und pakistanische Dorfbewohner bekämpfen, vorzugsweise töten, deren kulturelle Vorstellungen zwar hinter der abendländischen Aufklärung zurückbleiben, aber die ganz gewiss nicht die Absicht haben, Boeings in amerikanische Hochhäuser zu steuern.
Dass er eine „neue Strategie“ verkünden wolle, sagte Obama schon im zweiten Satz, gleich nach dem „Good morning“. Die Klarstellung macht Sinn, denn ohne weiteres würde man das, was er dann vortrug, weder für eine Strategie noch für neu halten. Dass die US-Truppen in Afghanistan um 17.000 Mann verstärkt werden sollen, hatte er schon im Februar angeordnet. Jetzt, nach seiner Rede, sollen weitere 4.000 Soldaten hinzukommen, die als Ausbilder und Einsatzberater der afghanischen Armee eingesetzt werden. Danach wird Washingtons Truppenstärke dort rund 60.000 Mann betragen – doppelt soviel wie die übrigen NATO-Kräfte zusammen. Die Dominanz der USA in der Aufstandsbekämpfung und Besatzungspolitik wird durch diese Verstärkung noch deutlicher werden. US-Medien sprechen von einer »Amerikanisierung des Krieges«. Auch im Süden des Landes, wo bisher britische, kanadische und niederländische Einheiten relativ eigenständig tätig waren, wird das US-Militär künftig die Führung übernehmen.
Aber eine neue Strategie wird dadurch nicht produziert. Obama ließ, beispielsweise, mit keinem Wort erkennen, dass die amerikanischen Streitkräfte von ihrer selbst innerhalb der NATO als extrem kontraproduktiv kritisierten Art der Kriegführung abgehen wollen.
Dass die afghanischen Streitkräfte bis zum Jahr 2011 auf 134.000 Mann verdoppelt werden sollen, wie Obama jetzt offiziell ankündigte – es war schon vorher bekannt – verdient gleichfalls nicht den Namen einer neuen Strategie. Dem Krieg ein „afghanisches Gesicht“ zu geben, Afghanen gegen die eigene Bevölkerung kämpfen zu lassen, davon hatte auch schon George W. Bush geträumt, so wie Lyndon B. Johnson verheißungsvoll die „Vietnamisierung“ des Vietnamkriegs versprochen hatte. Es ist der Traum der Kriegsherren zu fast allen Zeiten gewesen – nur scheitert er meist an den Realitäten.
Dass Obama nicht nur die militärische Komponente des Krieges eskalieren will, sondern zugleich eine „massive Aufstockung ziviler Maßnahmen“ angekündigt habe, gefällt besonders den Grünen. Tatsächlich hat Obama zwar gesagt, dass in Afghanistan „landwirtschaftliche Spezialisten und Erzieher, Ingenieure und Anwälte“ benötigt werden, und das nicht nur in Kabul, „sondern von Grund auf in den Provinzen“. Er hat auch einen „substantiellen Anstieg unserer zivilen Kräfte“ versprochen. Mehr jedoch nicht, keinerlei konkrete Zahlen. In der Presse war vor der Rede des Präsidenten von einer Aufstockung der in Afghanistan tätigen amerikanischen „Zivilisten“ um mindestens 50 Prozent auf sage und schreibe „mehr als 900“ die Rede. (2) Ein „Zivilist“ auf 60 Soldaten. Neben Regierungsangestellten wird es sich vielfach um Personal von Privatfirmen handeln.
Aus Kostengründen ist das Personal von USAID, der für Auslandshilfe zuständigen Organisation des State Department, in den letzten zwei Jahrzehnten so heruntergefahren worden, dass man sich nicht nur überwiegend auf Privatfirmen (private contractors) stützen müssen, sondern dass man nicht einmal genug Leute hat, um deren Arbeit zu kontrollieren. Zu dieser Feststellung kommt die internationale Hilfsorganisation Oxfam, die in diesem Zusammenhang grundsätzliche Kritik an der Arbeit der US-Bürokratie insbesondere in Afghanistan übt. (3) Darüber kein Wort in Obamas Rede, der es im Übrigen sogar vermied, irgendeine Angabe über die Kosten der zivilen Hilfe zu machen, die künftig in Afghanistan eingesetzt werden soll. Das fiel umso mehr auf, da er für Pakistan einen Betrag nannte, nämlich jährlich 1,5 Milliarden Dollar für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre. (Die militärischen Kosten der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan liegen derzeit bei 2 Milliarden Dollar monatlich.)
Erstmal nur zuhören
Eine Schlüsselfrage für das Verhältnis der USA zur moslemischen Welt, das sich in der Amtszeit von Präsident Bush enorm verschlechtert hat, wird das Agieren Amerikas im israelisch-palästinensischen Konflikt sein. Das Problem wird jetzt noch dadurch verschärft, dass die nächste israelische Regierung zu der von den USA offiziell favorisierten „Zwei-Staaten-Lösung“ nicht einmal Lippenbekenntnisse ablegen will, und dass Israel künftig durch einen Außenminister repräsentiert wird, der ein rechtsextremer Demagoge ist.
Am 27. Januar, eine Woche nach seiner Amtseinführung, gab Obama dem in Dubai ansässigen, aber in saudi-arabischem Besitz befindlichen Sender AlArabiya ein Interview – das erste überhaupt in seiner neuen Rolle als Präsident. Wer wollte, mochte darin eine freundliche Geste an die moslemische Welt im Allgemeinen und die arabischen Staaten im Besonderen sehen.
Gleich die erste Frage betraf den Nahost-Konflikt: „Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, wie Sie Ihre persönliche Rolle sehen. Denn Sie wissen ja, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich nicht einschaltet, passiert gar nichts – wie die Geschichte des Friedenmachens zeigt. Werden Sie Ideen einbringen, Vorschläge vorlegen, Rahmen abstecken, wie es einer Ihrer Vorgänger gemacht hat? Oder werden Sie lediglich die Streitparteien auffordern, mit eigenen Lösungsvorschlägen zu kommen, wie es ihr direkter Vorgänger tat?“ (4)
Antwort: „Nun, ich denke, am wichtigsten ist es für die USA, sich gleich einzuschalten.“ Deshalb habe er George Mitchell (5) als seinen Nahost-Beauftragten gewählt. „Und ich habe ihm gesagt, er soll damit anfangen, dass er zuhört, denn allzu oft beginnen die USA damit, dass sie etwas diktieren – so in der Vergangenheit zu einigen dieser Themen – und wir kennen nicht immer alle beteiligten Faktoren. Also lasst uns zuhören. Er wird mit allen wichtigen Beteiligten sprechen. Und dann wird er mir Bericht erstatten. Auf dieser Grundlage werden wir eine spezifische Antwort formulieren. Letzten Endes können wir weder den Israelis noch den Palästinensern sagen, was das Beste für sie ist. Sie werden einige Entscheidungen treffen müssen.“
Die Formel, man wolle zunächst einmal hauptsächlich „zuhören“ oder auch „zuhören und lernen“ (6), vernimmt man von den führenden Diplomaten der USA jetzt ständig. Auf Anhieb mag sie sympathisch erscheinen und den Eindruck einer neuen Nachdenklichkeit vermitteln, die man vor allem unter Obamas Vorgänger vermisst hatte. Aber wie ernst kann man diese Floskel nehmen, wenn beispielsweise der afghanische Präsident Hamid Karzai am 13. Februar öffentlich beklagte, dass Obama seit seiner Amtseinführung noch kein Wort mit ihm gesprochen habe? (7) Oder wenn die CIA am 14. Februar ein Ziel im pakistanischen Südwasiristan beschießt, nachdem der amerikanische Sondergesandte Richard Holbrooke zwei Tage zuvor in Islamabad von allen Gesprächspartnern gehört hat, dass man diese Angriffe nicht nur als Verletzung der Souveränität Pakistans betrachtet, sondern sie auch für politisch völlig kontraproduktiv hält?
Um das zu erfahren, hätte Holbrooke nicht einmal nach Islamabad reisen müssen: Die pakistanische Position zu diesen Angriffen ist seit langem bekannt. Unter anderem sind sie vom pakistanischen Parlament mehrmals in einstimmig gefassten Resolutionen verurteilt worden. Überhaupt kann man voraussetzen, dass die US-Administration die wesentlichen Standpunkte der wichtigsten Politiker und Parteien im Nahen Osten ebenso wie etwa in Afghanistan und Pakistan genau kennt. Besonders gilt das selbstverständlich für den israelisch-palästinensischen Konflikt, in den alle US-Regierungen schon seit Jahrzehnten intensiv und permanent verwickelt sind. Mitchell übrigens, den Obama jetzt zum „Zuhören“ nach Israel schickt, hatte im Jahr 2000 eine von Präsident Bill Clinton eingesetzte Fact-Finding-Kommission zum Nahost-Konflikt geleitet, verfügt also über spezifische Kenntnisse.
Vor diesem Hintergrund ist die Antwort Obamas gegenüber Al-Arabiya als Ausrede für eine Fortsetzung seiner Politik der Passivität und des stummen Abwartens zu diagnostizieren, die er schon während des Gaza-Massakers im Januar praktiziert hatte. Damals rechtfertigte er sich damit, dass es nur einen amtierenden Präsidenten der USA gebe, und das war zu jener Zeit noch Bush. Am 6. Januar äußerte Obama im Gespräch mit Journalisten erstmals, dass „der Verlust des Lebens von Zivilisten in Gaza und Israel“ für ihn „eine Quelle tiefer Betroffenheit“ sei, vermied aber die Forderung nach einem Waffenstillstand oder eine Kritik an der strategisch gewollten Unverhältnismäßigkeit der israelischen Angriffe. Erneut argumentierte er, sich während der Amtszeit von Bush nicht zur Nahost-Politik äußern zu können. Zugleich kündigte er aber an: „Nach dem 20. Januar werde ich zu diesem Thema eine Menge zu sagen haben, und ich gehe keinesfalls von dem ab, was ich während des Wahlkampfs gesagt habe: dass wir uns vom ersten Moment unserer Amtszeit an wirkungsvoll und konsequent für den Versuch einsetzen werden, den Konflikt im Nahen Osten zu lösen. Das ist etwas, dem ich verpflichtet bin.“ (Reuters, 6. Januar)
Jetzt, wo Obama selbst Präsident ist, fehlen ihm angeblich Kenntnisse über die Ansichten der Streitparteien, um sich qualifiziert zu äußern. Die deutlichen Worte zum Nahost-Konflikt, die er versprochen hatte, hat er immer noch nicht gefunden. Seine Aussage im Al-Arabiya-Interview, er könne den Israelis und Palästinensern nicht sagen, was am besten für sie ist, deutet auf die grundsätzliche Absicht hin, sich an seinem direkten Vorgänger Bush Junior zu orientieren, statt an dessen Vater George H. W. Bush (1989-1993) und an Bill Clinton (1993-2001), die beide in Maßen eine aktive Rolle im Friedensprozess anstrebten.
Kein Interesse an Friedensverhandlungen
Die Lage nach der israelischen Parlamentswahl vom 10. Februar ist so, dass dort keine Regierung zustande kommen kann, die sich politisch auch nur zentimeterweise auf eine Verständigung mit den Palästinensern zubewegt. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, am 11. Februar, dem Tag nach der Wahl: „Wenn es nur von Netanjahu und von seinen Freunden abhängig ist, kann es natürlich nicht zu einem Frieden kommen. (…) Aber die echte Frage liegt anderswo oder die Antwort liegt anderswo, nämlich in Washington. Die Frage ist, was Obama tun wird, weil wenn Obama, wie manche Leute es glauben, sich entscheiden wird, sich ernsthaft in den Nahost-Prozess einzumischen, was kein amerikanischer Präsident in Wirklichkeit bis heute getan hat – alle haben nur Lippenbekenntnis gezollt -, dann könnte sich alles ändern, weil wir derartig von Amerika abhängig sind, dass wir den Amerikanern keine Stirn bieten können. Das Frage ist, ob Obama das will. Er hat aber andere Probleme. (…) Aber wenn er sich einmischen will, dann können wir in kurzer Zeit einen Friedensvertrag haben (…). Wenn er sich nicht einmischen will, dann, glaube ich, werden wir alle ins Stocken geraten, weil die neue Regierung kein Interesse daran hat, den Friedensprozess fortzusetzen.“ (8)
Primor bestritt in diesem Zusammenhang, dass es dabei überhaupt um die Frage eines „Kollisionskurses“ (zwischen Obama und der nächsten israelischen Regierung) gehen könne: Israel sei total von den USA abhängig, könne ohne diese gar nicht existieren. Daher – so offenbar die nicht explizit ausgesprochene Schlussfolgerung – würde sich jede israelische Regierung fügen müssen, falls Obama sich entscheiden würde, Druck auf den Abschluss eines Friedensabkommens auszuüben.
Diese Einschätzung muss man wohl mit einiger Skepsis bewerten. Seit Dwight D. Eisenhower (1953-1961) und in sehr viel geringerem Maß John F. Kennedy (1961-1963) hat kein US-Präsident mehr einen grundsätzlichen Konflikt mit einer israelischen Regierung und mit der Pro-Israel-Lobby im eigenen Land riskiert. Eisenhower war der letzte amerikanische Präsident, der – vor allem während des Suez-Krieges 1956 – einen solchen Konflikt erfolgreich durchgestanden hat. Das ist mittlerweile über 50 Jahre her. Seit langem steht das Tabu, keinesfalls irgendeine Form von amerikanischem Druck auf Israel auszuüben, unter den von der Israel-Lobby verteidigten Prinzipien ganz weit oben. Sie konnte sich dabei in tendenziell kritischen Situationen in den letzten Jahrzehnten immer wieder auf eine riesige Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses verlassen. Was die derzeitigen Verhältnisse im Kongress angeht, sei daran erinnert, dass der Senat am 8. Januar einstimmig und das Abgeordnetenhaus am 9. Januar bei nur fünf Nein-Stimmen Resolutionen verabschiedeten, die das Gaza-Massaker als gerechte Selbstverteidigung unterstützten und die „unerschütterliche Verbundenheit“ mit Israel „als jüdischer und demokratischer Staat in sicheren Grenzen“ betonten. (9) Harry Reid, Fraktionsführer der Demokraten im Senat, verlangte nach der Abstimmung in der NBC-Sendung „Meet the Press“ die Fortsetzung des Krieges: „Israel muss weitermachen, bis sie die Raketen und Mörsergeschosse stoppen, die nach Israel kommen, die dort Israelis töten und verstümmeln.“
Noch kein konkretes Angebot an Iran
Mit Israel, der pro-zionistischen Lobby und höchstwahrscheinlich auch der Kongressmehrheit würde es Obama ebenfalls zu tun kriegen, wenn er auf eine umfassende Verständigung mit dem Iran hinarbeiten würde. Dafür gibt es aber bisher noch keine Anzeichen, auch wenn falsche oder zumindest voreilige Darstellungen in den Mainstream-Medien etwas anderes suggerieren.
Derzeit gibt es, entgegen anderslautenden Deutungen und Behauptungen, noch kein konkretes Gesprächsangebot der USA an den Iran. Obama erläuterte die Sachlage in seiner ersten Pressekonferenz am 9. Februar so: „Mein Team für nationale Sicherheit untersucht zur Zeit unsere bisherige Iran-Politik. Es betrachtet dabei Gebiete, auf denen wir einen konstruktiven Dialog führen könnten, wo wir direkt in Beziehung zu ihnen treten könnten. Meine Erwartung ist, dass wir in den kommenden Monaten nach Einstiegen suchen, die geschaffen werden können, wo wir beginnen können, uns am Tisch direkt gegenüber zu sitzen – diplomatische Einstiege, die es uns erlauben, unsere Politik in eine neue Richtung zu lenken.“ Es gebe „zumindest die Möglichkeit einer auf gegenseitigen Respekt und Fortschritt gegründeten Beziehung“, sagte Obama, auch wenn das „nicht über Nacht“ geschehen könne, „weil im Lauf der Jahre eine Menge Misstrauen aufgebaut wurde“.
Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete am 15. Februar, William Burns, Staatssekretär im amerikanischen Außenministerium, habe auf dem letzten Treffen der Iran-Sechs (10) am 4. Februar davon gesprochen, dass die Prüfung der bisherigen Iran-Politik und die Ausarbeitung einer neuen Initiative etwa zwei Monate in Anspruch nehmen werde. Das würde darauf hinweisen, dass etwa Anfang bis Mitte April mit der Verkündigung der Schlussfolgerungen durch Obama zu rechnen ist. Die Vertreter Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens seien über die Verzögerung „sehr enttäuscht“ gewesen und hätten eine „Beschleunigung“ des Prozesses gefordert.
Am 20. März nutzte der US-Präsident das altpersische Neujahrsfest Nowruz für eine diplomatische Geste gegenüber dem Iran: In einer Video-Botschaft (11) an die Bevölkerung und die Führer der Islamischen Republik drückte er den Wunsch aus, die seit drei Jahrzehnten angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern auf eine neue Grundlage von Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt zu stellen.
Obamas Ansprache ging allerdings weder auf konkrete Themen ein noch enthielt sie praktische Vorschläge. Stattdessen erteilte der Präsident den Iranern wieder einmal Empfehlungen, die er besser selbstkritisch an die Politik der USA und damit auch an seine eigenen Handlungen und Pläne richten sollte: Iran könne den ihm zustehenden Platz in der Welt nicht mit „Terror oder Waffen“ erreichen. Wirkliche Größe bestehe nicht in der Fähigkeit, etwas zu zerstören, sondern aufzubauen und zu schaffen. Konstruktive Beziehungen zwischen den USA und Iran seien nicht durch Drohungen voranzutreiben.
Die iranische Führung reagierte mit vorsichtiger Skepsis, aber grundsätzlich gesprächsoffen. „Ändern Sie Ihr Verhalten, dann ändern wir unser Verhalten“, forderte der höchste Führer des Landes, Ajatollah Khamenei, am 21. März die USA auf. „Unsere Nation verabscheut die Sprache von Drohungen und Lockungen. Aber wir haben keine Erfahrung mit dem neuen Präsidenten und der neuen US-Regierung. So behalten wir uns unser Urteil vor und werden es auf Ihre Handlungen gründen.“ „Wechsel sollte nicht in Worten mit bösen Hintergedanken bestehen. Wenn Sie nur ihre politische Taktik ändern wollen, aber gleichzeitig an Ihren bisherigen Zielen festhalten, dann ist das kein Wechsel, sondern Betrug. Wenn Sie wirklich Wechsel meinen, dann sollte er in der Praxis zu sehen sein. (…) Zeigen Sie es uns, wenn es wirklich einen Wechsel gegeben hat. Haben Sie Ihre Feindseligkeit gegen die iranische Nation beendet? Haben Sie die beschlagnahmten iranischen Vermögenswerte freigegeben? Haben Sie die Sanktionen aufgehoben? Haben Sie Ihre feindliche Propaganda eingestellt? Haben Sie die bedingungslose Unterstützung des zionistischen Regimes eingestellt?“ – So lange die US-Regierung an den aggressiven Methoden der vergangenen drei Jahrzehnte (seit der „Islamischen Revolution“ 1979) festhalte, werde auch Iran bei seiner Politik gegenüber den USA bleiben. (12)
Inzwischen hat Iran zugesagt, sich an einer internationalen Afghanistan-Konferenz zu beteiligen, die am 31. März unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Den Haag stattfinden soll. Außenministerin Hillary Clinton hatte zuvor eine ausdrückliche Einladung an die Iraner ausgesprochen. NATO-Sprecher James Appathurai erklärte, fast schon überschwenglich: „Die Tatsache, dass Iran eingewilligt hat, zur Konferenz in Den Haag zu kommen, ist eine gute Nachricht und stellt einen neuen Schritt bei der Rationalisierung des Themas Afghanistan dar.“ – In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt gegeben, dass es „vor kurzem“ im Brüsseler NATO-Hauptquartier zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten zu einem „informellen Kontakt“ zwischen einem iranischen Diplomaten und einem Vertreter des Generalsekretärs der Allianz gekommen sei. Thema sei Afghanistan gewesen. (13)
Als Zeichen einer grundsätzlichen Entspannung sollten solche Episoden aber nicht überschätzt werden. Zwar liegt das Interesse der USA, sich mit dem Iran in einer Reihe von Fragen – zu denken ist dabei neben Afghanistan selbstverständlich auch an Irak – zu arrangieren, auf der Hand. Ebenso klar ist aber, dass man dabei nicht weit kommen wird, so lange Washington darauf besteht, sich „die militärische Option“, also die Möglichkeit eines Angriffskriegs gegen Iran, „“offen zu halten“. (14) Unter allen nur erdenklichen Streitfragen zwischen beiden Staaten nimmt die durch nichts bewiesene Behauptung, Iran strebe nach der Produktion oder dem Erwerb von Atomwaffen, eine zentrale und überragende Stellung ein. Das gilt umso mehr, wenn diese Behauptung mit zurechtphantasierten engen Zeitangaben – wie etwa, Iran könnte innerhalb von drei, sechs oder zwölf Monaten eine Atombombe bauen – verknüpft wird. Dadurch steht die US-Regierung unter einem zum Teil selbst erzeugten Handlungsdruck, dem sie sich auch bei unterstelltem Willen zu einer diplomatischen Einigung kaum entziehen könnte.
Schwer belastet würden Gespräche, wenn sie denn zustande kämen, auch durch die israelischen „roten Linien“, mit denen Außenministerin Clinton konfrontiert wurde, als sie Anfang März den Nahen Osten bereiste. Die Tageszeitung Haaretz beschrieb am 3. März (15) die nicht offiziell veröffentlichten israelischen Vorgaben für eventuelle Gespräche mit dem Iran so:
„1. Jeder Dialog muss eingeleitet und begleitet werden durch härtere Sanktionen gegen Iran, sowohl im Rahmen des UN-Sicherheitsrats als auch außerhalb von diesem. Anderenfalls könnten die Gespräche vom Iran ebenso wie von der internationalen Gemeinschaft als Hinnahme des iranischen Atomprogramms aufgefasst werden.“
2. „Vor Beginn des Dialogs sollten die USA zusammen mit Russland, China, Frankreich, Deutschland und Großbritannien einen Aktionsplan formulieren, was man tun will, wenn die Gespräche scheitern. Insbesondere muss es eine Vereinbarung geben, dass das Scheitern der Gespräche sofort extrem harte internationale Sanktionen gegen Iran zur Folge haben wird.“
3. „Für die Gespräche muss ein Zeitrahmen gesetzt werden, um Iran daran zu hindern, Zeit zur Vervollständigung seiner nuklearen Entwicklung herauszuschinden. Außerdem sollten die Gespräche als ‚einmalige Gelegenheit’ für Iran definiert werden.“
4. „Es kommt wesentlich auf das Timing an. Die USA sollten sich überlegen, ob es Sinn macht, die Gespräche vor den iranischen Präsidentenwahlen im Juni zu beginnen.“
Es droht sich der Gang der Ereignisse des Jahres 2002 zu wiederholen. Im Juni jenes Jahres kündete Präsident Bush in ganz groben Zügen eine „Roadmap“ für israelisch-palästinensische Friedensverhandlungen an. Dann schalteten sich die israelische Regierung (damals unter Ariel Sharon) und die amerikanische Israel-Lobby ein: Sie setzten so viele Einwände und Einschränkungen durch, dass die „Roadmap“ weitgehend ihre Handschrift trug, als Bush sie schließlich im September 2002 offiziell vorlegte. Falls Obama es jetzt wirklich den israelischen Politikern und der Lobby überlässt, in die Details des bisher nur vage angekündigte Gesprächsangebot an den Iran hinein zu redigieren, würde die Sache nicht nur inhaltlich beschädigt, sondern bekäme auch einen zionistischen „Stallgeruch“, der es den Iranern von vornherein schwer machen würde, sich darauf einzulassen.
Israels Regierungen, wie immer sie sich politisch zusammensetzen, können für solche Störmanöver regelmäßig auf starke Unterstützung aus dem Kongress vertrauen. Am 26. März veröffentlichten sieben äußerst einflussreiche demokratische Abgeordnete einen offenen Brief an Obama, in dem sie ihre Forderungen formulierten – die sich weitgehend mit den israelischen Vorstellungen und den strategischen Ratschlägen der amerikanischen Israel-Lobby decken. (16)
Die Hauptpunkte ihres Appells:
1. Die Gesprächsofferte an den Iran soll zwar „ernsthaft und glaubwürdig“ sein, aber zeitlich knapp befristet. Ziel müsse sein, Iran in allernächster Zukunft zur Einstellung der Uran-Anreicherung zu veranlassen. Dem Iran dürfe nicht gestattet werden, „diplomatische Diskussionen als Deckung für die Fortsetzung der Arbeit an seinem Atomprogramm zu benutzen“. Die Einstellung der Arbeiten müsse so oder so innerhalb ganz weniger Monate nach Eröffnung der Diskussion erreicht werden.
2. Die Gespräche sollten deshalb so schnell wie möglich begonnen werden, um nötigenfalls rasch die Konfrontation zu verschärfen. Keinesfalls dürften – wie in Washington an manchen Stellen erwogen wird – die iranischen Präsidentenwahlen im Juni abgewartet werden.
3. Falls die Gespräche nicht sehr schnell die gewünschten Ergebnisse – vollständiges iranisches Einlenken – bringen, müsse Obama „sofort die Ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen“, um den wirtschaftlichen Druck auf Iran zu verstärken. Unter den konkreten Vorschlägen ragen zwei heraus: Reedereien, deren Schiffe den Iran anlaufen, soll der Zugang zu US-amerikanischen Häfen verweigert werden. Und ausländische Unternehmen, die in Irans Erdöl- und Gas-Sektor investieren, sollen mit Strafmaßnahmen belegt werden.
4. Obama müsse auch die Verbündeten zu ähnlichen Sanktionen veranlassen. Unter anderem sollen sie den Unternehmen ihrer Länder verbieten, Iran mit Raffinerieprodukten (hauptsächlich Benzin) und mit Maschinenteilen für iranische Raffinerien zu beliefern. Die Kampagne gegen den Iran müsse auch in den Beziehungen zu Russland und China „höchste Priorität“ erhalten.
Im Oktober 2008 wurde ein Strategiepapier des Bipartisan Policy Center veröffentlicht, in dem es um die Strategie des nächsten US-Präsidenten gegenüber dem Iran ging. (17) Darin wurde der Vorschlag entwickelt, der iranischen Führung ein vergiftetes Gesprächsangebot zu machen, das mit einem sehr kurz befristeten Ultimatum – die Rede war dort von 90 Tagen – verbunden werden sollte. Sollte dann keine Einigung erreicht sein, würde das Scheitern des „Angebots“ als Rechtfertigung für eine erhebliche Verschärfung der Maßnahmen gegen Iran, einschließlich der immer wieder ins Spiel gebrachten „militärischen Option“, dienen. Schon im Vorfeld eines solchen Vorstoßes sollte die EU dahin gebracht werden, diesem „festen und endgültigen Zeitplan“ zuzustimmen.
Unter den elf Politikern und Militärs aus beiden Kongressparteien, die für dieses Papier verantwortlich zeichneten, war auch Dennis Ross. Er ist jetzt Chefberater des Außenministeriums für die Iran-Politik.
Anmerkungen
1) Prepared Remarks of President Barack Obama: A New Strategy for Afghanistan and Pakistan. Transkript:
http://www.nytimes.com/2009/03/27/world/asia/27remarks.html?pagewanted=print
2) In Afghan War, U.S. Dominance Increasing. Washington Post, 26.3.2009.
3) Afghanistan aid program flawed. USA Today, 25.3.2009
4) Obama tells Al Arabiya peace talks should resume. Video und Transkript des Interviews.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/27/65087.html
5) George Mitchell war ab 1995 Sonderbeauftragter von Präsident Bill Clinton für den Friedensprozess in Nordirland und spielte eine maßgebliche Rolle in den Verhandlungen, die schließlich zum Belfaster Good-Friday-Abkommen von 1998 führten. Im Jahr 2000 leitete er eine von Clinton eingesetzte Fact-Finding-Kommission zum Nahost-Konflikt. Sein 2001 vorgelegter Bericht entsprach nicht den Wünschen der israelischen Regierung; unter anderem forderte er ein Ende der Ausdehnung der illegalen Siedlungen in den besetzten Gebieten.
Mitchell hat eine libanesische Mutter. Mit seiner Ernennung durchbrach Obama erstmals die Tradition seiner Vorgänger, den Posten des Nahost-Beauftragten mit Leuten zu besetzen, die enge Beziehungen zu Israel und zur amerikanischen Pro-Israel-Lobby unterhielten.
6) So Richard Holbrooke, Obamas Sonderbeauftragter für Afghanistan und Pakistan, laut BBC, 15. Februar 2009.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7887839.stm
7) Karzai bei Al-Jazeera, laut Al-Jazeera Online vom 15. Februar.
http://english.aljazeera.net/news/asia/2009/02/20092155283479467.html
Am 18. Februar meldete sich Obama erstmals telefonisch bei seinem Kabuler Kollegen.
8) Transkript des am 11. Februar ausgestrahlten Interviews:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/917879/
9) Resolution des Senats:
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=sr111-10#
Resolution des Abgeordnetenhauses:
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=hr111-34
10) Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats – China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA – plus Deutschland. Daher auch die im Westen gebräuchliche Bezeichnung „5 + 1“.
11) Offizielles Transkript der Video-Botschaft:
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Videotaped-Remarks-by-The- President-in-Celebration-of-Nowruz/
12) Khameini sprach anlässlich des Nowruz vor Zehntausenden Menschen in Maschhad, wo sich eine der wichtigsten religiösen Stätten der Schiiten befindet. Transkript der Rede:
http://www.juancole.com/2009/03/osc-khameneis-speech-replying-to-obama.html
13) NATO hold first direct talks since Islamic Revolution. AFP, 27.3.2009
14) Auf die Frage, ob „die militärische Option“ gegen Iran auch unter dem neuen Präsidenten Barack Obama „auf dem Tisch bleiben“ werde, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs, am 28. Januar: „Der Präsident hat seine Meinung nicht geändert, dass er sich alle seine Optionen offenhalten sollte. Wir müssen alle Elemente unserer nationalen Macht einsetzen, um in Bezug auf den Iran unsere Interessen zu schützen.“ (U.S. keeps options on the table on Iran. Reuters, 3.3.2009)
Einen Tag zuvor hatte US-Generalstabschef Mike Mullen auf eine Frage der Jerusalem Post geantwortet, dass der Einsatz militärischer Gewalt gegen Iran „eine Option“ bleibe, wenn auch „als letztes Mittel“. (Mullen: Using force against Iran still an option. Jerusalem Post, 27.1.2009)
15) Israel to present Clinton with ‘red lines’ on talks with Iran. Haaretz, 3.3.2009.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1068177.html
16) http://www.internationalrelations.house.gov/press_display.asp?id=602
Die Unterzeichner sind:
Steny H. Hoyer, Fraktionsführer der Demokraten.
Howard L. Berman, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses.
Ike Skelton, Vorsitzender des Streitkräfte-Ausschusses.
Silvestre Reyes, führendes Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses und des Geheimdienst-Ausschusses.
Henry A. Waxman, Vorsitzender des Ausschusses für Energie und Handel.
Gary L. Ackerman, führendes Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses. Vorsitzender der Unterausschüsse für den Nahen Osten und Südasien sowie für Asien und Pazifik.
Robert Wexler, Vorsitzender des Unterausschusses für Europa im Außenpolitischen Ausschuss.
17) Meeting the Challenge – U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development.
http://www.bipartisanpolicy.org/ht/a/GetDocumentAction/i/8448