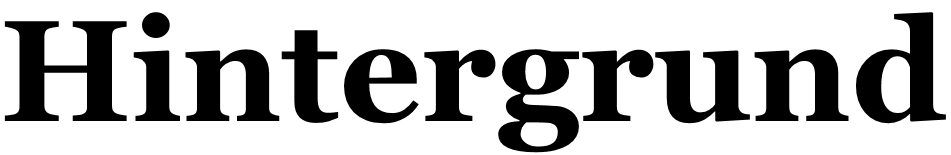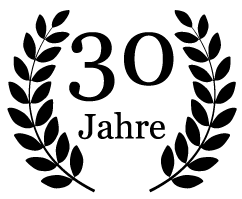Wider die Kriegsertüchtigung und Hochrüstung
Die derzeit Regierenden in der Bundesrepublik Deutschland wollen mit einer neuen »russischen Gefahr« die Gesellschaft »kriegstüchtig« machen. Damit wird eine massive Aufrüstung gerechtfertigt, die es seit Ende des Kalten Krieges so nicht mehr gab. Das droht auch nach der Bundestagswahl. Was fehlt, sind friedenspolitische Initiativen.
 Fighter-Jet
Fighter-JetDie Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP startete Ende 2021 als „Koalition des Fortschritts“. Am 27. Februar 2022, drei Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, war damit Schluss. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rief im Bundestag die „Zeitenwende“ aus. Völkerrechtsgemäß wäre ein Plädoyer für eine Politik der „friedlichen Streitbeilegung“ nach Kapitel VI der UN-Charta gewesen. Aber davon war nicht die Rede. Olaf Scholz setzte auf Eskalation: „Unterstützung der Ukraine“, „Zäsur in der deutschen Außenpolitik“. Die „Verteidigungsausgaben“ müssten deutlich gesteigert werden. Und so geschah es denn auch.
Wieder einmal dominiert das bellizistische Leitmotiv der Außenpolitik des alten Rom, „Si vis pacem para bellum“ (Wer den Frieden will, bereite den Krieg vor), die deutsche Außenpolitik. Bis 2029, so verlangte Boris Pistorius am 5. Juni 2024 im Bundestag, müssten wir „kriegstüchtig“ sein: Putins „Kriegslust“ (!), so sein Argument, werde nicht „an den Grenzen der Ukraine“ haltmachen.
Heute wird klar, wie und inwieweit sich die Zeiten damit verändert haben: Forderungen nach Abrüstung und Entspannung sind unerwünscht, allenfalls noch angängig für politische Täuschungsmanöver. Das Friedensthema wird vor allem als Debatte um mehr Rüstung behandelt. Die etablierten Parteien überbieten sich im Wettbewerb darüber, wer für die höchsten Rüstungsausgaben ist. Fehlanzeige für Fortschritte bei der Klimapolitik und dem Ausbau des Sozialstaates; dagegen Hochrüstung, Militarisierung der Außenpolitik, Steuersenkungen für die Unternehmer und sozialer Rückbau.
Nach vielen Streitereien endete die Ampel am 6. November 2024 mit der Entlassung des Bundeswirtschaftsministers Christian Lindner (FDP). Am 11. Dezember 2024 stellte Olaf Scholz nach Artikel 68 des Grundgesetzes die Vertrauensfrage. 510 Abgeordnete des Bundestages verweigerten ihm dieses Vertrauen. Der Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten am 27. Dezember 2024 wird am 23. Februar 2025 die Wahl zum 21. Bundestag folgen. Zentraler Streitpunkt in der Ampel war die Dauerkrise der deutschen Wirtschaft.
Wirtschaftsflaute und kein Ende
Im Bundestagswahlkampf 2025 steht dieser desolate Zustand der Wirtschaft im Mittelpunkt. Lösungsvorschläge, die überzeugen, fehlen. Wieder einmal fällt ein Wahlkampf mit einer Krise der Wirtschaft zusammen. Und erneut wird im Wahlkampf völlig ausgeblendet, dass zyklische Überproduktionskrisen nun einmal zum Kapitalismus gehören, ihre Ursachen in der kapitalistischen Produktionsweise haben, ziemlich unabhängig von der Staatspolitik.
Eine anhaltende Konjunkturflaute prägte die Ampelzeit von Anfang an. Seit zwei Jahren ist sie zur Rezession geworden. Schon 2023 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zurückgegangen; 2024 erneut: um 0,2 Prozent des Vorjahres-BIP. Die Bruttowertschöpfung in der Industrie verringerte sich um 3,0 Prozent. Alles deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft auch weiter auf Talfahrt ist. Dabei gibt es unübersehbar auch hausgemachte Ursachen für wirtschaftliche Fehlentwicklungen: die Abkoppelung vom russischen Erdöl und Erdgas und die Hinnahme des Verfalls der Infrastruktur. Politische Fehlentscheidungen auch der CDU/CSU-geführten Bundesregierung unter Angela Merkel sind nicht zu übersehen.
Im internationalen Wettbewerb drohen wichtige Industriezweige wie die Eisen- und Stahlindustrie und die Autoindustrie in Deutschland ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. 2023 produzierte die Stahlindustrie mit 29 Millionen Tonnen so viel wie 15 Jahre zuvor. 2020 sind es noch 35,7 Tonnen gewesen. Viele Straßen, Brücken, Schulen usw. sind marode. Allein für die Erneuerung der Infrastruktur im Straßenbau werden in den Jahren 2025 bis 2028 57 Milliarden Euro benötigt, für den Investitionsbedarf bei der Bahn 63 Milliarden Euro.
Als angeblich „politische Macher“, die das alles wieder „in Ordnung bringen“, treten neben der FDP vor allem die Unionsparteien unter ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz an. Mit ihrer „Agenda 2030“ machen sie sich zum Sprecher der Unternehmerverbände für ein großes Konjunkturprogramm und für eine erneute Kapitaloffensive gegen den Sozialstaat, vermutlich mit Erfolg.
Politikwende gegen Friedenspolitik
Am Ende des Bundestagswahlkampfes 2025 stehen Wahlen, die nicht zuletzt darüber entscheiden, ob der seit 2022 unter Olaf Scholz eingeschlagene Kurs der Kriegsertüchtigung und Hochrüstung im Bundestag erneut eine Mehrheit erhält und womöglich sogar von allen Parteien des 21. Bundestages unterstützt wird. CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und auch AfD sind sich zumindest darin einig, dass mehr Waffen auch mehr Sicherheit bringen. Statt über Wege zu einer neuen Entspannungspolitik nachzudenken und zu diskutieren wird darüber gestritten, ob die Militärausgaben nun auf 3 Prozent, 3,5 oder gar 5 Prozent des BIP erhöht werden sollen.
Daran hat sich auch dadurch nichts geändert, dass mitten im Wahlkampf, am 20. Januar 2025, mit dem Amtsantritt von Donald Trump als neuer US-Präsident sich die geopolitischen Rahmenbedingungen des Wahlkampfes änderten. Denn Donald Trump fordert selbst auch von Deutschland 5 Prozent. Er hat auch signalisiert, dass er dabei die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation beachten wird, aber er steht zugleich voll hinter dem Kurs der Hochrüstung.
Groß ist die Gefahr, dass sowohl Die Linke, die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen Hochrüstung und gegen die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ausspricht, als auch die Friedenspartei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) den Einzug in den Bundestag verpassen. Und diese Gefahr ist beängstigend. Es drohen politische Zustände ähnlich wie nach 1953, als die für eine Remilitarisierung eintretenden Parteien der Bundesrepublik CDU/CSU, SPD und FDP (zusammen für noch zwei Wahlperioden mit dem BHE und der DP 1) für mehr als drei Jahrzehnte im Bundestag unter sich waren und die Friedenskräfte keine parlamentarische Stimme mehr hatten.
2014 belief sich der deutsche Verteidigungshaushalt auf 32,4 Milliarden Euro. 2022, schon unter Olaf Scholz, waren es 50,3 Milliarden Euro, 7,3 Prozent mehr als 2021. Im Juni 2022 beschloss der Bundestag ein „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro für 2024 und 2025. 2024 waren es (so die FAZ vom 19. Juni) schon gut 40 Milliarden Euro mehr: 90,6 Milliarden Euro oder 2,12 Prozent des BIP. Gegenüber 2023 hatten sich die Militärausgaben damit im dritten Jahr der Ampel um 25 Prozent erhöht. Eine weitere Erhöhung der Rüstungsausgaben auf drei oder gar fünf Prozent des BIP würde jährliche Rüstungsausgaben von mehr als 130 bzw. mehr als 220 Milliarden Euro bedeuten. Das wären (im letzten Fall) etwa 40 Prozent des jährlichen Bundeshaushalts.
Zwischen Emanzipation und Prellerei
Der mittlerweile mehr als 200 Jahre währende Kampf um das allgemeine Wahlrecht und für politische und soziale Verbesserungen mittels Wahlen war reich an politischen Erkenntnissen. James B. O’Brien, einer der geistigen Führer der englischen Chartistenbewegung, meinte im Poor Man’s Guardian vom 30. November 1833 voller Hoffnung, das allgemeine Wahlrecht werde unweigerlich die Herrschaft des Volkes bringen: „Wenn das Volk Macht hat über das Gesetz, so kann es alles, was nicht von Natur aus unmöglich ist. Ohne diese Macht wird es nie etwas erreichen können.“ Etwa 100 Jahre später (1931) soll Kurt Tucholsky genau das Gegenteil gesagt haben: „Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten.“ 2
Marx und Engels sahen das in ihrer Zeit ähnlich kritisch wie Tucholsky, aber doch mit mehr Dialektik. 1880 in seiner „Einleitung“ zum Programm der französischen Arbeiterpartei forderte Karl Marx, das allgemeine Wahlrecht „aus einem Instrument des Betrugs, dass es bisher gewesen ist, in ein Instrument der Emanzipation“ umzuwandeln. 3 Friedrich Engels sah das allgemeine Wahlrecht in seinem Vorwort zu den „Klassenkämpfen in Frankreich“ von 1895 ähnlich ambivalent: als „Mittel der Prellerei“, das zu einem „Werkzeug der Befreiung“ werden müsse. 4
Heute wissen wir mehr. Mit der Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts wandelten sich auch die kapitalistischen Klassengesellschaften, deren parlamentarische bzw. präsidiale Staatsformen, die Medienlandschaft und die politischen Systeme. Einige Monarchien blieben, andere änderten ihren Charakter.
In den Nationalstaaten (und international) entstanden immer größere Konzerne und Banken, deren ökonomische Macht sich politisch organisierte: in Stiftungen, Denkfabriken und Unternehmerverbänden, aber ebenfalls im Lobbyismus und in politischen Parteien bzw. Parteifraktionen. Auch Parteien, die die Interessen der arbeitenden Klassen vertraten, nahmen an Wahlen teil, zogen in die Parlamente ein und nutzten beides, um über die gesellschaftlichen Zustände aufzuklären und soziale Verbesserungen durchzusetzen. Auch in Deutschland wurde ein „sozialstaatlicher Klassenkompromiss“ erkämpft. Eine reale Souveränität des Volkes auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts war das alles nicht, aber doch so etwas wie eine „Herrschaft mit Zustimmung des Volkes“ 5.
Entstanden ist mit der Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts in den entwickelten kapitalistischen Ländern die Herrschaft einer eng mit der ökonomisch herrschenden Klasse verbundenen politischen Elite. Deren Bildung wie auch deren Handeln geschehen auf der Grundlage „eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen des Volkes“ 6. Politiker der Parlamentsparteien entscheiden je nach den Mehrheitsverhältnissen über die Regierungsbildung und die Staatspolitik. Der Staat wurde zum Parteienstaat.
Im Grundgesetz, Art. 21 Abs. 1 Satz 1, wird den „politischen Parteien“ die Rolle zugewiesen, „bei der politischen Willensbildung des Volkes“ mitzuwirken. In Wirklichkeit geht es um mehr. Die Politiker der etablierten Parteien kontrollieren nicht nur den Parlamentsbetrieb. Aus ihren Reihen kommen mittlerweile alle Minister und die politischen Beamten an der Staatsspitze (in den Ministerien, in den Bundesbehörden, im Bereich des „Auswärtigen“), die Politiker und zahlreiche Beamte in den Ländern und Kommunen, zahlreiche Richter der Obersten Gerichte, die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Hörfunks und Fernsehens, viele der etwa 2.000 Mitarbeiter von sechs parteinahen Stiftungen mit einem Etat von 697 Millionen Euro im Jahre 2023 (2017: 581,4 Millionen Euro).
Der so entstandene Politikbetrieb ist eng mit einer Politik- und Parteienfinanzierung verbunden, die sich jährlich (einschließlich der Gehälter und Ruhestandsbezüge) auf viele Milliarden Euro summiert. Dieser „Betrieb“ führt ein Eigenleben und verändert sich nicht zuletzt unter dem Einfluss der Wahlen. Mit ihm entstand in den Parlamentsparteien je eine eigene „Sozialschicht“ mit mehreren Tausend Mitgliedern, die weniger für und mehr von der jeweiligen Partei leben. In den Arbeiterparteien entwickelte diese „Sozialschicht“ gegenüber der werktätigen Bevölkerung eigene pekuniäre und machtpolitische Interessen 7, die sich mit den Interessen der ökonomisch herrschenden Klasse koppelten. Politik wurde zum Geschäft, zu einem Unternehmen, das mit der Teilnahme an der Regierung besonders floriert, in dem nach wie vor viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, in dessen oberen Etagen aber auch eine Menge Geld verdient werden kann.
Der Politikbetrieb ist mehrfach abgesichert, und er ist wirkungsvoll. Er schottet sich mit der Fünf-Prozent-Sperre gegen neue Parteien ab. Über Anträge beim Bundesverfassungsgericht ist sogar ein Verbot von Parteien möglich (Verbotsurteile ergingen bisher 1953 gegen die neonazistische SRP und 1956 gegen die kommunistische KPD). Die regierenden Parteien verbreiten in den Wahlkämpfen die gängigen ideologischen Leitbilder in der Form von zum Teil kontroversen „Wahlschlachten“. Sie organisieren als „Mitgliederparteien“ die Wählerinnen und Wähler. Deutlich war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Über „reaktionäre“ Parteien „müssen die Kapitalisten in den Massen Rückhalt suchen“. 8
Das parlamentarische Regierungssystem verfügt so über eine enorme Integrationskraft. Es vermag sogar politischen Widerstand in Zustimmung zu verwandeln. Es dauerte 51 Jahre (im deutschen Kaiserreich gab es weder eine Abgeordneten- noch eine Parteienfinanzierung), bis die deutsche Sozialdemokratie, 1863 als „Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein“ (ADAV) gegründet, 1914 mit der Befürwortung der Kriegskredite im Deutschen Reichstag ihre systemoppositionelle Rolle aufgab. Die PDS und die Partei Die Linke brauchten dafür jeweils nicht einmal zehn Jahre.
Im Übrigen macht die mehr als hundertjährige Politik- und Parteiengeschichte in Deutschland unter den Bedingungen eines auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhenden parlamentarischen Regierungssystems deutlich, dass Wahlen und Wahlkämpfe auch Zeiten der politischen Aufklärung und der Weichenstellung für progressive politische Veränderungen sein können. Es hängt von der Verbindung des parlamentarischen Kampfes mit außerparlamentarischen Kämpfen ab, ob und wie das „Volk“ so auf die Staatpolitik real Einfluss nehmen kann.
In einem außerordentlichen Maße geschah das in den Jahren 1918 ff. in Deutschland nach der Novemberrevolution. Die damals erkämpften Fortschritte bei der Demokratisierung des Verfassungsrechts und in der Sozial- und Betriebsrätegesetzgebung waren möglich, weil die Arbeiterparteien SPD, USPD und KPD ihre politische Kraft infolge ihrer Allianz mit außerparlamentarischen Kämpfen für politische und soziale Verbesserungen deutlich steigern konnten.
Die Auflösung der 1923 nach den Wahlen gebildeten Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen durch die Reichsexekutive offenbarten dann die Begrenztheit der „Macht von Wahlen“. Und nur dem oberflächlichen Betrachter scheint es so, als ob die „Machtergreifung“ der NSDAP 1933 vor allem mittels der Reichstagswahlen vom 3. März 1933 erfolgte. Real aber geschah die Übertragung der Staatsmacht durch das Großkapital auf die NSDAP schon vorher, mit der Bildung der Regierung Hitler-Hugenberg-Papen am 30. Januar 1933. Flankiert durch Naziterror auf den Straßen und Notverordnungen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, fanden die letzten Wahlen der Weimarer Republik statt, vollzog sich dann die Komplettierung der offenen Diktatur.
Den vollständigen Text lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 3/4 2025 unseres Magazins, das im Bahnhofsbuchhandel, im gut sortierten Zeitungschriftenhandel und in ausgewählten Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. Sie können das Heft auch auf dieser Website (Abo oder Einzelheft) bestellen.
EKKEHARD LIEBERAM (Jg. 1937) entzog sich 1957 nach dem Abitur in Braunschweig der Einberufung zur Bundeswehr durch den Übertritt in die DDR. Er studierte in Leipzig an der Karl-Marx-Universität Jura und arbeitete als Professor für Staatstheorie und Verfassungsrecht an der Akademie der Wissenschaften in Berlin und am Institut für Internationale Studien in Leipzig. Von 1991 bis 1999 war er Mitarbeiter bzw. Referent für Rechtspolitik der PDS im Bundestag.
1 Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und Deutsche Partei
2 https//tucholsky-gesellschaft.de>angeblichezitate
3 (MEW, Band 19, Berlin 1962, S. 238
4 MEW, Band 22, Berlin 1972, S. 518f.
5 Peter Graf von Kielmansegg, Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft, auf der Jahrestagung 1984
6 Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (1940), München 1950, S. 416
7 vgl. Wolfgang Abendroth, Aufstieg und Krise der deutschen Sozialdemokratie, Köln 1964, S. 42
8 W. I. Lenin, Die Organisierung der Massen durch die deutschen Katholiken, LW, Band 36, Berlin 1962, S. 218