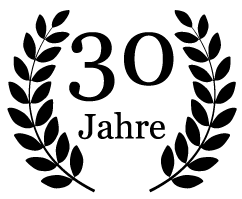Trotz alledem
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Parteitag der LINKEN in Göttingen –
Von WOLFGANG BITTNER, 6. Juni 2012 –
Die Partei DIE LINKE ist inzwischen dort angekommen, wo die Vertreter der bürgerlichen Parteien schon lange mehr oder weniger warm und gefeit vor den Fährnissen kapitalistischer Unwägbarkeiten sitzen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es in den Auseinandersetzungen der vergangenen Monate nicht allein um die Strategie, um Ost und West und noch weniger um die Programmatik, sondern eher noch um den Drang nach den Fleischtöpfen ging. Das wurde besonders deutlich in der Person des umstrittenen, angeblich reformorientierten Bewerbers um den Parteivorsitz, Dietmar Bartsch, und einiger seiner Unterstützer.
Bartsch, dem Peter Rath-Sangkhakorn schon im Ossietzky Nr. 9 vom Mai 2010 intrigante Quertreiberei nachgewiesen hat (so auch Albrecht Müller in www.nachdenkseiten.de am 30. Mai 2012) scheute sich nicht, seine Kandidatur bereits neun Monate vor dem Parteitag anzukündigen – ein peinliches Vorpreschen, das in der Folgezeit zunehmend für Auseinandersetzungen und Zerwürfnisse sorgte. In den Medien wurde er als Realpolitiker begrüßt, der einen koalitionsbereiten Flügel der Partei anführt, während der von ihm bekämpfte Oskar Lafontaine als Extremist und Vertreter der „regierungsunwilligen“ West-Linken angefeindet wurde.
| Parteitag in Göttingen: Aufgabe der Partei DIE LINKE sei es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen deutlich zu verbessern und sich der Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells entgegenzustellen, so Klaus Ernst. |
Lafontaine hat in diesem Zusammenhang von Verleumdungen und Hetzkampagnen in den Medien gesprochen. Er widersprach in seiner Parteitagsrede auch der Auffassung von Gregor Gysi, die Ost-Linke sei eine Volkspartei im Gegensatz zur West-Linken als einer Interessenpartei, und er wies auf das gemeinsam mit 95 Prozent beschlossene Parteiprogramm und auf das beeindruckende Ergebnis im Saarland mit 16 Prozent Wählerstimmen hin. Den rapiden Rückgang in der Wählergunst führten er wie auch der scheidende Parteivorsitzende Klaus Ernst und die vor Kurzem aus familiären Gründen zurückgetretene Gesine Lötzsch auf die zum Teil öffentlich ausgetragenen innerparteilichen Querelen zurück, die kaum noch Raum für substanzielle Arbeit gelassen haben. Dass Bartsch mit seinen Intrigen, Indiskretionen und parteischädigenden Aktionen wesentlich zu den Auseinandersetzungen beigetragen hat, blieb auf dem Parteitag unerwähnt.
Zustand und Herausforderung der Partei
Klaus Ernst sagte in seiner Rede gleich zu Anfang, dass ihn der Zustand seiner Partei schmerze. Aber dieser Zustand – so Ernst – „steht im diametralen Gegensatz zu unserer Notwendigkeit“. Wer die eigene Partei öffentlich schlechtrede, trage zu den Problemen bei, indem er „auf das eigene Tor“ spiele. Die Zukunft der Partei liege weder im Osten noch im Westen, sondern im Zusammenbleiben und in einem gemeinsamen Vorgehen. Der Sinn der LINKEN sei nicht „ihre Eigenexistenz oder Mandate für Funktionäre“ zu erreichen, vielmehr müsse es darum gehen, „für die Mehrheit der Menschen in unserem Land die Lebens- und Arbeitsbedingungen deutlich zu verbessern“ und sich der „Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells“ entgegenzustellen.
Des Weiteren ging Ernst auf die globale Banken- und Wirtschaftskrise ein, die nach seiner Ansicht „mittelfristig für die Weltgemeinschaft keinen geringeren Veränderungsdruck als die Atomkatastrophe von Fukushima“ entfalte. „Sie führt uns“ – so Ernst – „in demselben Maße die Folgen einer falschen Form des Wirtschaftens, Arbeitens und Verteilens vor Augen.“ Die Krise münde in Europa in einen fundamentalen Angriff auf Demokratie und Sozialstaat. Insofern stehe Europa vor einer Richtungsentscheidung, und in dieser Situation behalte die LINKE ihre Existenzberechtigung nur als das, was sie von Anfang an war, als antineoliberale Sammlungsbewegung, die sich als Motor und Multiplikator der sozialen Interessen und Kämpfe der Mehrheit begreife. Dabei dürfe keine Rolle spielen, ob die Kernforderungen der Partei koalitionsfähig sind. Wenn ein führendes Mitglied der Bundestagsfraktion (und damit ist offensichtlich Dietmar Bartsch gemeint) in der Financial Times Deutschland sage, Abgrenzung sei der falsche Weg im Umgang mit der SPD, dann sei dem entgegenzuhalten, dass sich das Programm der LINKEN nicht durch die Abgrenzung von der SPD definiere, sondern sich an der realen Lage der Bevölkerung orientiere, die es zu verbessern gelte.
Darauf ging auch Oskar Lafontaine ein. Er machte noch einmal deutlich, dass die West-Linke keineswegs regierungsunwillig sei, wie immer wieder behauptet werde. In Hessen wie auch im Saarland sei der SPD eine Koalition angeboten worden und in Nordrhein-Westfalen habe man seinerzeit die Regierung Kraft erst ermöglicht. Dass es nicht zu Koalitionen gekommen ist, sei der SPD anzulasten.
Realistische Politik und Kooperation
Lafontaine plädierte eindringlich für ein Zusammengehen der Parteiflügel, für innerparteiliche Solidarität. Er wies wiederholt auf das Grundsatzprogramm, auf das er stolz sei, als Basis für die politische Arbeit hin und betonte, dass die Forderungen der als regierungsunfähig diskreditierten LINKEN durchaus nicht unrealistisch seien, was ein Blick nach Frankreich beweise. Dort habe mit Jean-Luc Mélenchon eine relativ kleine linke Partei bei den letzten Wahlen mit einem klaren Programm 11,1 Prozent erreicht und damit die französische Politik maßgeblich verändert. Präsident Hollande habe jetzt einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent für Einkommen über eine Million Euro vorgeschlagen, er habe die Höchstgrenze für Manager-Einkommen, die Einführung von Euro-Bonds zur Dämpfung der Zinslasten in den ärmeren Ländern sowie eine direkte Kreditvergabe an die notleidenden Staaten durch die Zentralbank übernommen; außerdem habe er den Abzug der französischen Armee aus Afghanistan angekündigt. Das alles – so Lafontaine – habe die LINKE in Deutschland bereits seit Jahren propagiert, aber bei dem „Krach und Theater“ in der Fraktion würden viele der guten Vorschläge gar nicht mehr durchdringen, das müsse endlich aufhören.
Mit Vehemenz wandte sich Lafontaine gegen die Auslassung Gysis, dass es im Extremfall besser wäre, wenn sich die verfeindeten Lager trennen würden, als unfair mit Hass und Denunziation „eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe zu führen“. Es gebe keinen Grund, das Wort Spaltung in den Mund zu nehmen, sagte er. Eine Spaltung sei nur dann erforderlich, wenn gravierende programmatische Unterschiede festgestellt würden, aber nicht, „weil man da oder dort Befindlichkeiten hat“. Das sei kein Grund, ein politisches Projekt infrage zu stellen. Und in der Tat wäre eine Spaltung der Partei wohl der Todesstoß für die LINKE.
Allerdings scheinen die Fronten verhärtet. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn ein Ost-Delegierter in kleinerer Runde behauptet, Oskar Lafontaine sei „auf einen fahrenden Zug aufgesprungen“ – eine völlige Verkennung der Tatsachen und der Bedeutung Lafontaines als Zugpferd für diese Partei. Der Beinahe-Bundeskanzler von 1980, inzwischen Persona non grata für die bürgerliche Presse, steht nach wie vor an maßgeblicher Stelle für die Durchsetzung linker Politik in der Bundesrepublik; das scheint merkwürdigerweise manchem der Ost-Delegierten nicht bewusst zu sein. Es gibt also nicht nur Arroganz und Unverständnis im Westen, wie Gysi kritisierte, sondern ebenso im Osten.
Darüber hinaus hielt sich Gysi mit eindeutiger Kritik sowohl an Lafontaine als auch an Bartsch zurück. Zwar beklagte er den Hass, der zwischen einzelnen Mitgliedern der Bundestagsfraktion herrsche (was von einigen Medien sofort aufgegriffen und zu einer Kernaussage stilisiert wurde); zugleich warb er aber für gegenseitige Anerkennung und warnte davor, die Akzeptanz der LINKEN in der Gesellschaft zu verspielen.
Offenbar war das ein Versuch, zwischen den zerstrittenen Parteiflügeln aus Ost und West zu vermitteln, womit sich Gysi wieder einmal als Routinier auf dem politischen Parkett erwies, der sich immer noch eine Option offenhält. Aber seine Unterscheidung zwischen der erfolgreichen Volkspartei im Osten und der schwachen Interessenpartei im Westen wirkte dann doch zu opportunistisch und anbiedernd an die Ost-Linke. Er wünsche sich für die Zukunft eine kooperative Parteiführung, sagte er am Ende seiner Rede, in der die unterschiedlichen Teile der Partei vertreten seien. Man müsse sie zusammenführen, um sie dann allerdings als Flügel zu entmachten. Ein frommer Wunsch.
Wahlen und Perspektive
Oskar Lafontaine hatte seine Kandidatur für den Parteivorsitz zurückgezogen; Sahra Wagenknecht war gar nicht erst angetreten, sie hielt sich zurück, rief nur einmal in einer „persönlichen Erklärung“ zur Geschlossenheit auf. Aber es ist fraglich, ob diese aufgezwungene Enthaltsamkeit der Sache der LINKEN guttut. Nicht nur der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier und Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann beschworen bereits den Untergang der LINKEN.
Gewählt wurden schließlich in Göttingen für die Doppelspitze Katja Kipping aus Sachsen und Bernd Riexinger aus Baden-Württemberg; Sahra Wagenknecht wurde immerhin stellvertretende Parteivorsitzende. Zum Bundesgeschäftsführer wurde Matthias Höhn aus Sachsen-Anhalt gewählt, der dem „Forum demokratischer Sozialisten“ angehört, das dem Flügel der „Reformer“ zuzurechnen ist.
Katja Kipping (Jahrgang 1978), die als unangepasst gilt, zog 1999 als jüngste Abgeordnete in den sächsischen Landtag ein; 2005 wurde sie in den Bundestag gewählt. Seit 2007 war sie dann stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören Ökologie und Soziales. Sie tritt für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und gehört zusammen mit Andrea Ypsilanti (SPD) und Sven Giegold (Grüne, Attac) zum Vorstand des parteiübergreifenden „Instituts Solidarische Moderne“.
Bernd Riexinger (Jahrgang 1955) ist Geschäftsführer des Bezirks Stuttgart der Gewerkschaft ver.di und Mitglied des Landesvorstands der LINKEN in Baden-Württemberg. Der gelernte Bankkaufmann verfügt über langjährige Erfahrungen als Betriebsrat, ist in der Sozialforumsbewegung aktiv und Mitglied der „Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken“. Er wird der Fraktion um Oskar Lafontaine zugerechnet.
Jetzt bleibt abzuwarten, ob die neue Parteispitze wirklich in der Lage sein wird, die zerstrittenen Fronten wieder zusammenzuführen. Es scheint, dass Gysi und Teile der Ost-Linken der Meinung sind, die Partei könne in Ostdeutschland an die Stelle der SPD treten und gegebenenfalls auch ohne die West-Linken auskommen. Doch das dürfte sich im Falle eines Falles als eine destruierende Illusion erweisen. Eine reine Ostpartei dürfte sich – ebenso wenig wie eine auf den Westen beschränkte LINKE – auf die Dauer wohl kaum durchsetzen können.
Der niedersächsische Landtagsabgeordnete und Mitorganisator des Göttinger Parteitages, Patrick Humke, äußerte gegen Ende des Parteitages die auch von anderen Delegierten geteilte Auffassung: „Wir sind eine linkspluralistische Partei, in der sowohl das Forum demokratischer Sozialisten als auch die Kommunistische Plattform vertreten ist. Wir müssen gemeinsam auf dem mit großer Mehrheit beschlossenen Parteiprogramm aufbauen. Mit der neuen Führung sind wir wieder handlungsfähiger geworden.“
Tatsächlich hat sich auf dem Parteitag in Göttingen bewiesen, dass die LINKE trotz der selbstzerstörerischen Querelen und der Ablehnung in den bürgerlichen Medien erstmal als eine wichtige politische Kraft weiterexistieren wird – es fragt sich nur, mit welcher Akzeptanz bei den Wählern. Eines ist jedenfalls sicher: Eine zweite SPD, die dann bereit wäre, unter Aufgabe ihrer programmatischen Forderungen mit ihrer großen „Schwesterpartei“ Koalitionen einzugehen, wäre überflüssig.