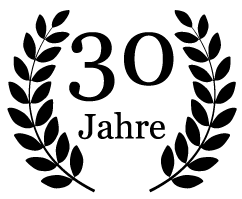Einer muss den Bluthund machen!
Die deutschen Sozialdemokraten haben nichts gelernt – nichts aus der Zeit der Berliner Republik und schon gar nichts aus ihrer eigenen Geschichte.
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Bloß keine Neuwahlen“, war der mehrheitliche Tenor der Genossen nach den verheerenden Verlusten bei der Bundestagswahl im vergangenen September und dem anschließenden Scheitern der Jamaika-Verhandlungen. Auf Biegen und Brechen musste eine Große Koalition her – und wichtiger noch: Es galt, gut eine Viertelmillion Parteimitglieder dafür zu gewinnen, der Vereinbarung mit CDU und CSU zuzustimmen. Für diese Überzeugungsarbeit meldeten sich sogar Stimmen aus dem Off: Altvordere wie Rudolf Scharping, unehrenhaft aus dem Kabinett Schröder entlassen und längst in der politischen Versenkung verschwunden, kamen lautstark zu Wort. Eine Neuwahl wäre „ein lebensgefährliches Risiko für die SPD und schlecht für Deutschland“, warb er bei den Parteimitgliedern um ihr Pro-GroKo-Votum. Franz Müntefering, ein weiterer Ex-Parteivorsitzender, drückte sich etwas zurückhaltender aus: „Wird die GroKo abgelehnt, werden wir bei der nächsten Wahl sehr leiden.“
Europaweiter Trend
Das Bangen der Parteispitze gilt offenbar mehr den Stimmenverhältnissen als dem eigenen Programm und den Bedürfnissen ihrer eigentlichen „Zielgruppe“. Was die Genossen dabei nicht wahrhaben wollen: Ihnen ist nicht ihr Wählerpotenzial abhandengekommen, sondern den eigentlichen Stammwählern ist eine Partei abhandengekommen, die ihre Interessen nachhaltig vertritt.
Doch die SPD ist mit diesem Problem nicht alleine. Europaweit zeichnet sich derselbe Trend ab. Nie zuvor in ihrer über hundert Jahre währenden Geschichte haben sozialdemokratische Parteien in solch hohem Maße ihre Klientel verloren wie in den vergangenen Jahren. Das zeigt sich sowohl an der Wahlurne als auch in der Zahl der Mitglieder. Einst angetreten, um Rechte und Gerechtigkeit für die arbeitenden Menschen zu erkämpfen, wenden sich genau diese nun von „ihrer“ Partei ab.
Die Parlamentswahlen in zwei bedeutenden europäischen Industrienationen – Deutschland wählte im September 2017 und Italien im März 2018 – machen diese Entwicklung einmal mehr deutlich. In Deutschland verloren die Sozialdemokraten im Vergleich zu den vorausgegangenen Wahlen gut 5 Prozent ihrer Stimmen und damit vierzig Sitze im Parlament. Nur noch ein Fünftel der Wähler goutierte im vergangenen Herbst die Politik der SPD und wollte sie weiter im Bundestag sehen. Noch schlimmer erging es der italienischen Partito Democratico unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Die von ihm geführte Mitte-links-Koalition büßte fast 7 Prozentpunkte der Wählergunst ein, der Anteil ihrer Abgeordneten im Parlament wird künftig deutlich unter 20 Prozent liegen. An der nächsten Regierung werden die italienischen Sozialdemokraten voraussichtlich nicht beteiligt sein. Genauso wie die SPD in Deutschland bietet die PD in Italien schon lange keine gesellschaftliche Alternative mehr an.
Man mag – vor allem aus linker Sicht – berechtigte Kritik an dem verwaschenen Antikapitalismuskonzept üben, mit dem die einstigen Arbeiterparteien spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts Politik machen. Egal ob und wie essenziell sozialdemokratische Positionen und Parteien für den Einzelnen sind: Für die westeuropäischen Demokratien erweist sich deren Marginalisierung als verheerend.
Die Aufteilung in zwei politische Lager – symbolisiert durch jeweils einflussreiche Volksparteien – prägte die westeuropäischen Parlamente der Nachkriegszeit. Bis zum Ende des „real existierenden Sozialismus“ in DDR, UdSSR und deren Bündnisstaaten erwies sich dieses Parteiengefüge als beständig und aus bürgerlicher Sicht nützlich. Auf der einen Seite sorgten das konservative Lager, auf der anderen die sozialistischen oder sozialliberalen Kräfte für eine mehr oder weniger soziale Marktwirtschaft und gesellschaftliche Gerechtigkeit. Ein Lager regierte, während das andere Opposition machte – die Rollen konnten schnell getauscht werden. Als Korrektiv gegen eine unkontrollierte Entfesselung des Kapitalismus und für ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Gerechtigkeit diente allein die pure Existenz des Sozialismus sowjetischer Prägung. Als Leitlinie für die beiden Lager der Volksparteien reichte mitunter dessen bloßes Narrativ.
Der Fall des Eisernen Vorhangs ließ nicht nur die politischen Systeme des Ostens zusammenbrechen, vielmehr brachen für den Kapitalismus nun tatsächlich sämtliche Dämme. Mit der „gewissen Zurückhaltung“, also allzu dreister kapitalistischer Gier, war Anfang der 1990er Jahre Schluss. Die lästigen Schranken waren beseitigt und der Weg für die totale Globalisierung der Märkte frei.
Gesinnungsgenossen
Eigentlich hätten damals bei der Sozialdemokratie, deren Mitglieder zu großen Teilen auch gewerkschaftlich aktiv waren und sind, die Alarmglocken läuten müssen. Doch statt gegen diese Neuausrichtung des Wirtschaftssystems mobilzumachen, fanden sich ausgerechnet unter sozialdemokratischen Parteiführern die vehementesten Anhänger einer unregulierten Entfesselung der Märkte: Gerhard Schröder und Tony Blair – sie stehen beispielhaft für diesen radikalen parteipolitischen Richtungswechsel. Zwei Parteivorsitzende, die eigentlich die Interessen abhängig beschäftigter Menschen vertreten sollten, gerierten sich als Kumpane der Großindustrie und des Finanzkapitals.
Ende des vergangenen Jahrtausends spülte es die beiden Gesinnungsgenossen relativ zeitgleich an die Macht, als sozialdemokratische Regierungschefs beendeten sie in ihren Ländern lange Phasen konservativer Politik. Ein Neuanfang im Sinne ihrer Wähler war das nicht, denn beide öffneten dem Neoliberalismus Tür und Tor. Blair trat mit „New Labour“ die würdige Nachfolge des Thatcherismus an, Schröder mit der „Agenda 2010“ zwar in keine Fußstapfen, dafür aber auf relatives Neuland. Dass eine solche Entwicklung ausgerechnet in den beiden reichsten, bevölkerungsstärksten EU-Staaten ihren Anfang nahm, den führenden Wirtschaftsmächten mit einer traditionell gut organisierten Arbeiterschaft, hatte fraglos eine Signalwirkung auf andere sozialdemokratische Parteien in der EU und trug vermutlich zu deren Niedergang bei.
Während sich im Vereinigten Königreich Tony Blair immerhin zehn Jahre lang an der Spitze halten konnte, war in Deutschland Gerhard Schröders Amtszeit kürzer und vor allem von keinem rühmlichen Abgang gekrönt. Seitdem dümpelt seine Partei allenfalls als Juniorpartner an der Seite der Christdemokraten in großen Koalitionen vor sich hin – sie regiert ein bisschen mit, scheint aber jegliches politische Profil verloren zu haben.
Nach Ansicht der belgischen Politologin Chantal Mouffe liegt das zentrale Problem sozialdemokratischer Parteien darin, dass sie nicht das System herausfordern, sondern sich zum aktiven Teil dieses Systems gemacht haben. Und deshalb, da ist sich Mouffe sicher, „besteht kaum Hoffnung, dass die europäische Sozialdemokratie überlebt. Sie ist nicht mehr zu reparieren.“
Ein wenig Sand in dieses Getriebe streuten kürzlich die Jusos. Die Jugendorganisation der Partei hatte sich von Anfang an konsequent gegen jede Form von GroKo, unabhängig vom Inhalt des Verhandlungsergebnisses, positioniert und plädierte für eine christsoziale Minderheitsregierung. Besonders der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert sorgte mit einer NoGroKo-Kampagne für Furore. „Tritt ein, sag’ nein“ lautete das Motto, das bundesweit zum massenhaften Eintritt in die SPD aufforderte, um bei der Urwahl eine Fortsetzung des alten Bündnisses mit CDU/CSU zu verhindern. Immerhin war in der Folge nur zwei Dritteln der SPD-Mitglieder ihre Zustimmung zu entlocken.
Grundsätzlich wollen die Jusos – das zumindest verkünden sie wortreich – eine entschiedene Neuausrichtung der Partei. Dabei schielen sie nach Großbritannien, ein Teil schwärmt sogar für Jeremy Corbyn und den konsequent linken Kurs der dortigen Labour Party. Aber die deutschen Jungsozialisten bleiben mit ihren Forderungen und ihren programmatischen Erklärungen weit hinter dem zurück, was Labour in den letzten Jahren aufgebaut hat und womit die Partei einen wahren Höhenflug im Königreich erlebt.
Tatsächlich ist seit dem NoGroKo-Marketinggag nicht mehr viel von den Jusos in der Öffentlichkeit zu hören. Sie sind nicht mit eigenen Programmen oder gar Visionen präsent, die eine Wende sozialdemokratischer Politik einleiten könnten – keine radikalen sozialen, ökonomischen oder friedenspolitischen Forderungen wie bei Labour. Das nimmt insofern Wunder, als unmittelbar während der Koalitionsverhandlungen die Zahlen deutscher Waffenexporte des letzten Jahres veröffentlicht wurden. Die sind – unter sozialdemokratischer Verantwortung – erneut gestiegen und haben eine nie dagewesene Höhe erreicht. Chapeau! Eine sozialdemokratische Basisbewegung kann und wird von dieser Jugendorganisation mit ihrer politischen Halbherzigkeit nicht ausgehen.
Im neuen Kabinett Merkel sind sechs Ministerien mit Sozialdemokraten besetzt. Das Personal – wie gehabt: kein einziger charismatischer Vordenker, fast sämtlich Wahlverlierer, dazu noch ein umstrittener ehemaliger Hamburger Oberbürgermeister als Vizekanzler und Finanzminister: Olaf Scholz. Er wurde seit dem G-20-Gipfel im Juli 2017 in der Hafenstadt zum Rücktritt gedrängt, aber dem Peterprinzip folgend ist er mit dem neuen Amt gewaltig nach oben gefallen.
Der konservative Scholz, enger Vertrauter Gerhard Schröders und Unterstützer von dessen „Reformpolitik“, gilt seit Jahren als der scharfe Hund der Partei. Seine politische Biografie liest sich im Grunde wie eine Liste sozialdemokratischer No-Gos, aber offensichtlich wollte die Partei genau damit bei ihren Wählern punkten: Als Hamburger Innensenator führte Scholz die zwangsweise Gabe von Brechmitteln an Drogendealer ein – sie sollte der Beweissicherung dienen. Sogar in das Programm für die Hamburger Bürgerschaftswahl im Jahr 2004 hielt Scholz’ Brechmitteleinsatz Einzug – als „sozialdemokratische Innenpolitik“. Und das, obwohl es zuvor einen Todesfall gegeben hatte. Dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Praktiken wenig später als menschenrechtswidrig verurteilte, schadete dem strammen Spitzenpolitiker nicht. Ganz im Gegenteil katapultierte es ihn auf die nächste Stufe der Karriereleiter – er wurde Arbeitsminister in Angela Merkels erster GroKo. Dort war er maßgeblich an der „Rentenreform“ beteiligt, jenem unbarmherzigen Sozialabbau, der alte Menschen schon heute – und in Zukunft noch weitaus drastischer – in die Armut treibt.
Beförderung statt Rücktritt
Seine Tauglichkeitsprüfung als Scharfmacher konnte Scholz schließlich im Amt des Hamburger Oberbürgermeisters vor und während des G-20-Gipfels ablegen. Straftaten wild um sich prügelnder Polizisten – die offenbar einen hanseatischen Freibrief für ihr Treiben hatten – gab es laut Scholz nicht. Alles Anderslautende sei eine Denunziation. Immerhin haben die Übergriffe zu 115 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten geführt, 92 davon wurden wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet. Teile der Hamburger Öffentlichkeit forderten daraufhin Scholz’ Rücktritt, der – so der Stadtoberste – für ihn nur infrage gekommen wäre, wenn es Tote gegeben hätte. Hatte er das zuvor einkalkuliert?
Gerade in Bezug auf Olaf Scholz als neuen SPD-Spitzenmann bleibt ein Geschmäckle. In gewisser Weise setzt gerade er – wenn auch nicht in letzter Konsequenz und mit der gleichen Gewalt – eine alte SPD-Tradition fort. „Einer muss den Bluthund machen“, antwortete der SPD-Mann Gustav Noske, Volksbeauftragter für Heer und Marine, als es im Januar 1919 darum ging, den Spartakusaufstand in Berlin niederzuschlagen. Dazu verbündete sich Noske mit den reaktionären, nationalistischen Freikorps, die in der Folge des Spartakusaufstandes auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordeten. Für Noske war das politisch Einende mit den rechten Mörderbanden deren strikter Antikommunismus – und auch das erinnert, neben dem Freifahrtschein für die Polizei in Hamburg, an Olaf Scholz: Für ihn sind die programmatischen Unterschiede zwischen SPD und der Partei Die Linke „größer als zu allen anderen Parteien“.
Eigenes Grab geschaufelt
Und da wundert sich die SPD, dass ihre einstigen Mitglieder und Unterstützer ihr das Wahlkreuz verweigern? Während Merkels vierter Amtszeit wird sich möglicherweise auch die Zukunft der deutschen Sozialdemokratie entscheiden. Wobei es ein Irrglaube ist, anzunehmen, Merkel sei schuld am Niedergang der SPD.
Die hat sich längst ihr eigenes Grab geschaufelt. Zum Schulterschluss mit Industrie und Banken waren die westdeutschen Genossen bereits vor der „Wende“ bereit – damals allerdings unter dem Mäntelchen der Sozialpartnerschaft. Den von Gerhard Schröder eingeleiteten und exekutierten Sozialabbau auf ganzer Linie werden einstige Stammwähler nicht so schnell vergessen können, spüren sie doch die Auswirkungen Tag für Tag. Ein wirklich mitreißendes, zukunftsorientiertes Gesellschaftskonzept verbirgt sich hinter der roten Nelke – dem Parteisymbol – schon lange nicht mehr.
Dieser Artikel erschien in Heft 1/2018