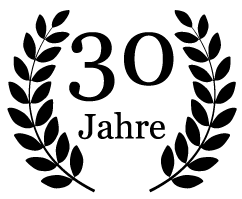Das Geschäft mit Großprojekten
Ausufernde Kosten sind keine „Pannen“, sondern haben System und sind Ausdruck der aktuellen kapitalistischen Krise
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Fragwürdige Infrastrukturprojekte gigantischen Ausmaßes, die mit Stadtzerstörung oder der Bebauung ehemaligen Bahngeländes einhergehen, schaffen Investitionsmöglichkeiten. Ausufernde Kosten sind keine „Pannen“, sondern haben System und sind Ausdruck der aktuellen kapitalistischen Krise
Die Hartnäckigkeit, mit der derzeit große Städte umgegraben und gigantische, absurde Infrastrukturprojekte durchgezogen werden, mit der Bestehendes zerstört und Zerstörerisches, in Beton Gegossenes neu gebaut wird, kann in vollem Umfang nur vor dem Hintergrund des aktuellen Stadiums der kapitalistischen Ökonomie verstanden werden. Das wird besonders deutlich, wenn der Ausverkauf von Bahngelände im Allgemeinen und die Bahngroßprojekte im Besonderen in den Blick geraten. Auf der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bahn AG am 23. März 2017 brachte dies der neue Bahnchef Richard Lutz gut auf den Punkt. Auf die Frage eines kritischen Journalisten, wie denn der Bahnkonzern auf die neuen kritischen Berichte und Gutachten zu Stuttgart 21, die eine krasse Kostenexplosion (auf 10 Milliarden Euro) und nicht beherrschbare Risiken bei den Tunnelbauten im Anhydrit-Untergrund dokumentieren, zu reagieren gedenke, antwortete Richard Lutz: „Ich bin finster entschlossen, Stuttgart 21 zu Ende zu bauen.“
So ist es. Es herrscht eine finstere Entschlossenheit zur Zerstörung und Selbstzerstörung – bei diesem Projekt und bei vergleichbaren. Und es herrscht eine völlige Losgelöstheit in Bezug auf Kosten und Wirtschaftlichkeit. Die Großprojekte Elbphilharmonie und der Großflughafen Berlin wären nie in Angriff genommen worden, hätte man der Öffentlichkeit bei Baubeginn die tatsächliche Bausumme, die jeweils beim Fünffachen des ursprünglich Kommunizierten liegt, genannt. Die neue Hamburger Kulturstätte kann angesichts vorhandener Kapazitäten zumindest als gesellschaftlich unnötig gelten. Der Berliner Großflughafen muss vor dem Hintergrund der Umwelt- und Klimabilanz und der Lärmemissionen des Flugverkehrs als zerstörerisch bezeichnet werden. Die Hochgeschwindigkeitsneubaustrecke München–Ingolstadt–Nürnberg–Erfurt–Berlin ist verkehrspolitisch kontraproduktiv, weil sie die große Region Leipzig in den schienenpolitischen Schatten stellt und im Vergleich zu Alternativen, die es – bei Einbindung von Leipzig – gegeben hätte, krass überteuert ist. Als weitere in diesem Sinne grandi opere inutili, als „große unnütze Werke“, wie diese Projekte in Italien bezeichnet werden, seien aufgeführt: der geplante Fehmarnbelt-Tunnel (mit dem die Insel Fehmarn mit Dänemark verbunden werden soll), die zwei gigantischen Vorhaben in den Alpen, der Brennerbasistunnel und der Mont-Cenis-Basistunnel (mit dem östlichen Ausgangspunkt im Val di Susa), der TAV Tunnel Firenze, ein Hochgeschwindigkeitstunnel unter der Stadt Florenz (mit einem weiteren Untergrundbahnhof und der Aufhebung des Kopfbahnhofes Santa Maria Novella als florentinischer Hauptbahnhof) und in Österreich der Koralm-Tunnel (auf der Verbindung Graz–Klagenfurt). Zu nennen ist hier auch der Ausbau des Panama-Kanals. Selbst die 3 144 Kilometer lange Mauer, die US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko bauen lassen will, sollte in diesem Kontext gesehen werden. Sie wird die illegale Einwanderung nicht verhindern. Die Kosten des Mauerbaus stehen in keinem Verhältnis zu dem minimalen „Nutzen“. Dennoch macht der Mauerbau Sinn. So wie eben auch Stuttgart 21 und alle anderen genannten grandi opere inutili „sinnvolle“, weil privaten Profit generierende Projekte sind.
Wir leben in Zeiten, in denen es immer weniger gewinnbringende Anlagen im produktiven Bereich gibt. Die Reichen haben höchst praktische Probleme und jammern – wenn auch, wie dem folgenden Bericht zu entnehmen ist, auf hohem Niveau: „Kürzlich bat ihn ein Bankier um einen Wink, sobald etwas auf der Insel Sylt zum Verkauf stehe, erzählt Dahler (ein Hamburger Immobilienmakler, Anm. W. W.). ‚Aber Sie haben doch schon ein schönes Haus auf Sylt?‘, meinte der Makler verblüfft. Das stimme, erwiderte der Manager, doch er wisse einfach nicht, was er mit seinem Kapital anstellen solle. ‚Der Mann war fast ein bisschen verzweifelt‘, sagt Dahler. Es herrscht Anlagenotstand.“
Seit Mitte der 1970er Jahre sind in den kapitalistischen Ökonomien die Wachstumsraten rückläufig – auf globaler und nationalstaatlicher Ebene. Gleichzeitig gibt es immer schärfere Wirtschaftskrisen (1974/75, 1980/82, 1990/91, 2001/2002, 2008/2009). Schließlich kam es ab Mitte der 1970er Jahre zu einem explosionsartigen Wachstum des Finanzsektors und der Spekulation, verbunden mit einer in der Menschheitsgeschichte einmaligen „Reichtumsproduktion“. Pünktlich zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos, im Januar 2017, veröffentlichte die Entwicklungsorganisation Oxfam die aktuelle Statistik zur Konzentration des weltweiten Reichtums. Danach besaßen im Jahr 2016 acht Personen, „alles Männer“, mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das Abheben des Finanzsektors und der Spekulation von der materiellen Produktion – die immer größere Kluft zwischen diesen beiden Sphären – wird auch als „Finanzialisierung“ des kapitalistischen Systems bezeichnet.
Modernes Raubrittertum
Im Grunde wiederholt sich ein Prozess, den es bereits in den 1920er Jahren gab, der dann in die große Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 mündete, worauf eine lange Phase von Depression und Krisen und schließlich der Zweite Weltkrieg folgte. Wobei vieles dafür spricht, dass sich dieser Prozess der zeitweiligen Trennung der beiden Sphären heute zwar wiederholt, dies jedoch auf einem deutlich höheren Niveau.
Auf diese Wiederholung und zugleich auf die neue Situation verweist auch der marxistische Ökonom David Harvey: „In der Geschichte des Kapitals hat es mehrere Finanzialisierungsphasen gegeben. (…) Die Besonderheit des gegenwärtigen Abschnitts erklärt sich aus dem Umstand, dass sich die Zirkulation des Geldkapitals ungeheuer beschleunigt hat und dass die Kosten für Finanztransaktionen im gleichen Maß gesunken sind. Die Mobilität von Geldkapital hat sich im Vergleich zur Zirkulationsgeschwindigkeit anderer Kapitalformen (insbesondere von Waren und Produktion) extrem erhöht. Die Tendenz des Kapitals zur ‚Vernichtung des Raumes durch die Zeit‘ hat hierbei eine große Rolle gespielt.“
Die neue finanzielle Kaste ist einerseits Fleisch vom Fleische und Teil des gesamten kapitalistischen Systems. Sie setzt sich andererseits zunehmend an die Spitze dieses Systems und agiert ausschließlich entsprechend der Gesetzmäßigkeit der Akkumulation des Finanzkapitals und der Vermehrung des individuellen Reichtums. Dabei wirkt sie wie ein modernes Raubrittertum in einem System globaler Wegelagerei. Der eigenwillige, kreative David Harvey stellt hier einen interessanten historischen Bezug her, wenn er schreibt: „All dem wohnt eine tiefe Ironie bei. Einst führte das Industriekapital einen erbitterten Kampf, um sich aus den Fesseln der Grundbesitzer zu befreien, die exorbitante Pachten verlangten, der Geldgeber, die Wucherzinsen erhoben, und der Kaufleute, die versuchten, in einem ungleich beschaffenen Markt möglichst billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts scheint eifrig daran zu arbeiten, die Rentiers, Kaufleute, Medien- und Kommunikationsmogule und vor allem die Spekulanten, die das produktive Industriekapital (und die dort beschäftigten Arbeiter) bis auf den letzten Tropfen auspressen, wieder zu stärken. Das soll nicht heißen, dass das Industriekapital verschwindet. Es ist aber dem Kapital in seinen anderen phantastischeren und aggressiveren Formen untergeordnet.“
Das wurde zwei Jahre vor der Etablierung einer neuen US-Regierung geschrieben, in der Top-Leute aus dem spekulativen Finanzsektor Ministerposten innehaben: Der Exboss von Exxon spielt den US-Außenminister (und lässt sich wenige Tage vor der Amtseinführung 150 Millionen US-Dollar vom Mutterkonzern als Wegzehrung überweisen), der US-Präsident ist Immobilien- Tycoon, Betonzar, Hotelmilliardär. Wenn er „America first!“ twittert, meint er „Trump [Tower] first!“.
Doppelter Angriff
All dies ist Ausdruck einer tiefen kapitalistischen Krise. Die Profitmargen im klassischen produktiven Sektor sind zu gering, auch weil – als Resultat der Orientierung auf den schlanken Staat – die notwendigen öffentlichen Investitionen in den elementaren zivilen Bereichen wie Ausbildung, alternative Energien, Wohnungsbau und Integration von Geflüchteten ausbleiben. Die kaufkräftige Massennachfrage bleibt zurück, vor allem weil es hohe Arbeitslosenquoten (Deutschland bildet hier aus höchst spezifischen und nachvollziehbaren Gründen die absolute Ausnahme!) und den fatalen neoliberalen Angriff auf den Lebensstandard gibt. Die Schuldenquoten sind hoch und bieten (in der kapitalistischen Logik) nur noch wenig Spielraum für ein weiteres, auf Schuldenexpansion aufgebautes Wachstum. Die großen Konzerne, Banken und Geldsammelstellen suchen fieberhaft nach neuen Geldanlagen. Und sie bekommen sie geboten – in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Florenz, Venedig (Mose-Projekt) und anderswo mit den grandi opere inutili.
„Tiefe Krise“ heißt leider nicht, dass sich das zerstörerische kapitalistische Wirtschaftsmodell verabschieden, dass es kollabieren würde. Diese Krise ist vielmehr mit einem doppelten Angriff auf Urbanität und Lebensqualität verbunden: Erstens mit einer Privatisierungsoffensive, die einen Schwerpunkt auf die Zerschlagung und die Privatisierung ehemals öffentlicher Unternehmen (Post, Telekommunikation, Eisenbahnen) und im produktiven Sektor auf die Durchsetzung der kapitalstärksten Fraktion des industriellen Kapitals, den Öl- Auto-Luftfahrt-Komplex, legt. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Intensivierung des zerstörerischen American Way of Life & Mobility, der längst zu einem Global Way of Life & Mobility geworden ist. Er hat im Übrigen ausgerechnet in China besonders aggressive und zerstörerische Auswüchse – befeuert von den westlichen Autokonzernen (VW verkauft in China weit mehr Pkw als in ganz Europa!).
Zweitens mit einer Spekulationsoffensive auf allen denkbaren Gebieten der Anlagesphären, wobei hier ein Schwerpunkt auf der „Entwicklung“ ehemals öffentlichen Geländes, insbesondere von Eisenbahngelände, und auf der Realisierung von Großprojekten auf solchem Gelände liegt.
Das Magazin Focus veröffentlichte 1993 – also ein knappes Jahr vor Gründung der Deutschen Bahn AG – einen umfassenden Artikel über „Das Mega-Milliarden-Ding“. In dem Artikel wird ein Blick auf die Eisenbahnentwicklung in den USA und speziell in New York geworfen. „Blick“ ist hier im Wortsinn gemeint: Da gab es zwei Fotos der City von New York. Das erste Foto zeigte ein breit aufgefächertes Gleisnetz mit einem beeindruckenden Bahnhofsgebäude. Zeitpunkt der Aufnahme: Anfang des 20. Jahrhunderts. Daneben platziert war ein Foto mit demselben Stadtausschnitt, nunmehr aufgenommen Anfang der 1990er Jahre. Auf diesem Foto sind nur noch Hochhäuser und Straßenzüge zu sehen. Der Text zu den Darstellungen lautet: „Wolkenkratzer über dem Bahndamm: Weil der Nutzwert breiter Schienenstränge in keinem Verhältnis mehr zu den Bodenpreisen in der City stand, überbauten die New Yorker kurzerhand diese hässliche Gleisschneise samt einigen Bahnhöfen mit Hochhäusern und Straßen.“
Das ist so neu nicht, ist dem Kapital inhärent. 120 Jahre zuvor hatte Friedrich Engels dieses Paradox bereits beschrieben: „Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen dem Grund und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert; die darauf errichteten Gebäude“ – und Anlagen, füge ich hinzu – „statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere.“
Pures Gold
Die Frage im Jahr 1872 lautete wie in den Jahren 1993 und 2017: Wer definiert, was Wert hat oder was wertvoll ist? Und für wen hat es Wert? Gleisanlagen können als Freifläche, mit freiem Blick in Teile der Stadt, gesehen werden – oder als „Opportunität“, als Möglichkeit, das entsprechende Gelände „zu entwickeln“ und gewinnbringend zu verwerten. Gleisanlagen müssen, so im Fall Stuttgart, als Frischluftschneise begriffen werden. Sie können, so im Fall von Altona, als Teil der Urbanität in diesem Hamburger Stadtteil verstanden werden. Sie sind, so im Fall Lindau im Bodensee, eine urbane Attraktion mit immensem touristischem Potenzial als Knotenpunkt für eine Bodensee-S-Bahn.
Der „Nutzwert breiter Schienenstränge“ und die Wertschätzung für „Bahnhofs-Kathedralen“ ist natürlich dann gering, wenn der Schienenverkehr gering geschätzt wird – oder wenn dieser, wie in New York im beschriebenen Zeitraum erfolgt, erheblich reduziert wurde und erst dadurch „vertunnelt werden“ konnte.
Die Bilanz im zitierten Focus-Artikel lautete jedoch knallhart: „Das 41 000 Kilometer lange Schienennetz ist als Immobilie pures Gold.“ Wie sang Väterchen Franz, F. J. Degenhardt, damals bezogen auf „das goldene Prag“? „Wenn die ‚Gold‘ sagen, dann meinen die Gold!“
Die Eisenbahnen waren in allen Industrieländern – noch vor der Post, die ja weltweit ein ähnliches Privatisierungsschicksal wie die Eisenbahn erlebt beziehungsweise erleidet – die größten Immobilienbesitzer. Konkretisiert für Deutschland: Zum Zeitpunkt der Bahnreform im Jahr 1993 zählten zum Bahneigentum aus Bundesbahn-Besitz (ohne die Bahngelände der Reichsbahn) rund 160 000 Hektar Fläche. Schätzungen gehen davon aus, dass das Immobilienvermögen der Bahn zu diesem Zeitpunkt mehr als 400 Milliarden Mark oder umgerechnet 220 Milliarden Euro wert war.9 Es handelt sich dabei überwiegend um Flächen, auf denen Bahnverkehr stattfindet, die also nicht oder in absehbarer Zeit nicht veräußerbar sind. Wobei es natürlich im Sinne des Focus-Zitats beziehungsweise der zitierten Analyse von Friedrich Engels allein aus dieser „Wertschätzung“ heraus immer einen massiven Druck geben muss, Bahngelände, auch solches mit Eisenbahnverkehr, zu entwidmen, zu „entwickeln“, es zu „veredeln“ und wie im Märchen daraus Gold zu spinnen.
Bereits zu Bundesbahnzeiten betätigte sich die damalige Staatsbahn als Immobilienspekulantin. Im Geschäftsbericht der (westdeutschen) Bundesbahn aus dem Jahr 1991 heißt es beispielsweise, dass „die Bahn 1991 Erlöse von über einer Milliarde DM aus der Verwertung ihres nicht unmittelbar benötigten Grundbesitzes (erzielte)“ 10. Damals, so ließ sich argumentieren, war die Bahn ein direktes Bundesvermögen. Da galt „linke Tasche, rechte Tasche“. Nicht so im Fall einer auf den Privatisierungsweg gebrachten Deutschen Bahn AG. Die DB AG hat seit 1994 nach unterschiedlichen Schätzungen Bahngelände im Wert von 15 bis 20 Milliarden Euro verkauft und diese Einnahmen in die eigene Tasche gewirtschaftet. In „Gebrauchswerten“: Seit 1994 wurden von der DB AG 8 100 Kilometer des Streckennetzes, 30 000 Kilometer Gleise (vor allem Ausweichgleise), 11 000 Gleisanschlüsse und mehr als 3 500 Bahnhöfe aufgegeben, verkauft und verhökert. Die DB finanziert auf diese Weise im Übrigen auch ihren aggressiven Kurs als Global Player.
Vor allem aber betätigt sie sich stadt- und schienenverkehrszerstörerisch. Von den 6 500 Bahnhöfen, die die DB im Jahr 1994 noch im eigenen Bestand hatte, verfügen heute nur noch wenige Hundert über das, was klassischerweise einen Bahnhof ausmachte: Personal mit Schalter für die Weitergabe von Information und den Fahrkartenverkauf – und damit auch eine persönlich sichtbare Präsenz, die für Service, Sauberkeit und Sicherheit zuständig ist.
Wissen die Top-Leute bei der Bahn denn nicht, was sie tun und wie zerstörerisch ihr Wirken ist? Sie wissen es. Ihr Tun erfolgt bewusst, nicht nur in Stuttgart oder Altona. Dokumentiert sei dies am bereits kurz angeführten – im Übrigen eher unbekannten – Beispiel Lindau: Im Jahr 1996 ergab ein Gutachten, das im Auftrag der Deutschen Bahn AG erstellt worden war, dass „das Hauptbahnhofsgebäude in Lindau das Potential (hat), Bench-Mark-Funktion (Leitbild-Charakter) für die touristischen Bahnhöfe in Süddeutschland und eine bedeutende Rolle als Imageträger für die DB AB zu übernehmen“.
Die DB hielt diese Studie unter Verschluss. Sie trieb sogar just ab dem Jahr 1996 massiv das Projekt zur Aufgabe des Jugendstilbahnhofes auf der Bodenseeinsel, die Aufgabe jeglichen Bahnverkehrs zur Insel und die Errichtung eines neuen Bahnhofes am Rande der Stadt voran.