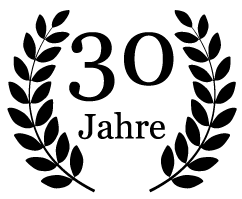60 Jahre Grundgesetz
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Eine kritische Analyse –
Von Jörg Becker, 27. Mai 2009 –
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland feierte am 23. Mai 2009 seinen sechzigsten Geburtstag. Das ist Grund genug, inne zu halten und nachzudenken, und zwar kritisch: Denn nur diese Position des autonomen, des aktiven, des nachdenklichen, des kritischen und des notfalls gegen Unrecht auch Widerstand leistenden Bürgers (20.IV.) entspricht Buchstabe und Geist des Grundgesetzes. In diesem Sinne steht das deutsche Grundgesetz eben nicht einem Nachtwächterstaat vor, der sich ausschließlich für die äußere und innere Sicherheit zuständig fühlt, noch steht es für einen Obrigkeitsstaat, in dem der Bürger „vor denen da oben“ zu kuschen und zu buckeln hat. Ganz im Gegenteil: Im Spannungsfeld zwischen der „Würde des Menschen“ in Art. 1 und einem „demokratischen und sozialen Bundesstaat“, der auf einer Staatsgewalt ruht, die nach Art. 20 „vom Volke ausgeht“, gibt es eine in Art. 79 festgeschriebene Ewigkeitsgarantie für alle in Artikel 1 und 20 verbürgten Grundsätze. Die hier aufgeführten Forderungen nach Menschenwürde, Menschenrechten, Frieden, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, einer staatlichen Organisation mit demokratischem, sozialem und föderalen Aufbau und mit einem Volkssouverän, der seinen Willen über „Wahlen und Abstimmungen“ (20.II.) kundtut, entziehen sich jeglicher Veränderung.
Dass bei dieser Ewigkeitsgarantie der beiden Artikel 1 und 20 der Begriff der Freiheit an keiner Stelle auftaucht, wohl aber die Begriffe Menschenwürde und Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit, Demokratie und Rechts- und Sozialstaat, ist kein Zufall. Das Freiheitsverständnis des deutschen Grundgesetzes ist eben das einer dienenden, einer funktionalen Freiheit, also einer Freiheit zur Verwirklichung von etwas Anderem, sei es Gerechtigkeit oder Frieden, und nicht das einer Freiheit aus sich und für sich. Daher kennt das Grundgesetz weder die unbeschränkte Freiheit des Einzelnen in Form eines hedonistischen Ich-Lings, die anarchistische Freiheit ohne überhaupt irgendeine soziale Ordnung noch die ungebremste Freiheit des Kapitals, zu tun und zu lassen, was es will. Und genau deswegen ist auch jedes reine Marktmodell verfassungswidrig – zumal es mit Art. 14. GG eine Sozialbindung des Eigentums gibt – und genau deswegen unterscheidet sich übrigens das deutsche Freiheitsverständnis drastisch vom dem der US-amerikanischen Verfassung. Während der Erste Zusatzartikel zur Verfassung der USA die Grundrechte über den Freiheitsgedanken definiert, definiert der Erste Artikel des deutschen Grundgesetzes nicht den Freiheits-, sondern den Würdegedanken. Sind aus amerikanischer Sicht Grundrechte eine Folge von gewährter Freiheit, so sind sie aus der Perspektive des Grundgesetzes eine Folge von gewährter Würde. Anders formuliert: Es dürfte kaum ein anderes Staatsrecht wie das der USA geben, in dem der Freiheitsgedanke derartig radikal und ohne Rückbindung an andere Normen an der höchsten Stelle aller politischen Prioritäten steht.
I. Die Grundzüge des Grundgesetzes
1.1. Sozialordnung
Die Anordnung der US-amerikanischen Militärverwaltung eines Sonderplebiszits über die Muss-Vorschrift von Art. 41 der Hessischen Landesverfassung nach einer Überführung von Großindustrie und Banken in Gemeineigentum, dem die hessische Bevölkerung mit 72 Prozent am 1. Dezember 1946, also mit überwältigender Mehrheit, zustimmte, verweist auf die realen und verfassungshistorischen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegssituation. Einen Gegensatz Staat oder Markt gab es eher zwischen der US-Regierung und ihrem Militärgouverneur Lucius D. Clay und deutschen Parteivertretern als zwischen den verschiedenen deutschen Parteien. Zwar hatten sozial-konservative Kräfte der CDU und sozialistische Kräfte auf Seiten der SPD durchaus divergierende Vorstellungen über die Rolle von Ökonomie und Sozialstruktur in einem neuen Deutschland, doch betrafen diese eher das „wie“ des staatlichen Einflusses auf die Ökonomie und weniger das „ob“. Und so ist es gerade nicht verwunderlich, sondern vielmehr zeittypisch, wenn führende CDU-Politiker damals von „christlichem Sozialismus“ sprachen und das Ahlener Programm der CDU vom 3. Februar 1947 eine Sozialisierung der Schlüsselindustrien, ein umfassendes Mitbestimmungsrecht und eine staatliche Planung und Lenkung der Gesamtwirtschaft forderte. Und im Gegensatz zu heutigen Wahrnehmungen ist der für deutsches Recht so wichtige Gedanke der Mitbestimmung – das Mitbestimmungsgesetz von 1951 und das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 – sehr viel weniger das Kind einer „roten“ Sozialdemokratie, sondern das der CDU, insbesondere von Alfred Müller-Armack, dem Leiter der Grundsatzabteilung im CDU-Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard und „Erfinder“ eines Konzepts der „sozialen Marktwirtschaft“. Mitbestimmung in der Ökonomie war also das Abwehrgefecht der nordrhein-westfälischen CDU gegen weiter gehende Vergesellschaftungsmodelle der Sozialdemokratie – also das kleinere Übel, wenn Sie so wollen, aus Sicht der CDU.
Vor diesem hier nur skizzierten Hintergrund kommt Art. 15 GG eine eminent wichtige Bedeutung zu. Er besagt: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch Gesetz […] in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“
Wie stark sich gerade die nordrhein-westfälische CDU der Idee eines Gemeineigentums verpflichtet fühlte, zeigte sich auch in der Landesverfassung von NRW von 1950, also noch ein Jahr nach der Verkündung des Grundgesetzes. Dort fordern Art. 26 und 27 die Überführung der Grundstoffindustrien und aller monopolartigen Unternehmungen in Gemeineigentum – sie machen aus der Kann-Bestimmung des Grundgesetzes sogar eine Soll-Bestimmung – und außerdem eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht nur in sozialen, sondern auch in wirtschaftlichen Fragen. Und genau diese Artikel 26 und 27 gehen auf die absolute Mehrheit der CDU im damals verfassungsgebenden Landtag zurück.
Vergesellschaftungsartikel 15 GG ist Ausdruck eines Kompromisses zwischen CDU und SPD. Weder setzten sich die Teile der CDU durch, die eine kapitalistische Wirtschaftsweise verfassungsrechtlich garantieren wollten, noch die Teile der SPD, die in der sozialen und wirtschaftlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer, der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und in der Wirtschaftsplanung durch einen demokratischen Staat eine sozialistische Umgestaltung angestrebt hatten. Überdacht wird Art. 15 GG durch die Formel eines „demokratischen und sozialen Bundesstaates“ in Art. 20.
Es bleibt ein spannender Sachverhalt, gerade in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, festzuhalten: Zwar lässt das Grundgesetz das kapitalistische Wirtschaftssystem mit seinen zahlreichen gesellschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Brüchen und Gefahren bestehen, lässt aber gleichzeitig die Möglichkeit für eine ökonomische Umgestaltung zu. Über den Weg demokratischer Wahlen steht des dem Mehrheitswillen des Parlamentes offen, sich für eine andere als die gegenwärtige Ökonomie zu entscheiden. Vergesellschaftung, Gemeineigentum, eine sozialistische Ökonomie, eine Genossenschafts- oder eine Mitbestimmungsökonomie sind deswegen alle grundgesetzkonform. Sie wären es möglicherweise dann nicht mehr, wenn der Lissabon-Vertrag rechtsgültig wird, da dieser Vertrag in seinem Art. 119 alle Mitgliedstaaten auf eine „offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ verpflichtet. (Notabene: Dies ist eine der vielfältigen und rechtswidrigen Verfassungseingriffe des Lissabonner Vertrages in deutsches Verfassungsrecht.)
Die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes ist eine der tragenden Säulen unserer Verfassung. Sie ist der Sieg der Zivilgesellschaft über das Kapital und sie zeigt das Primat der Politik vor der Ökonomie. Es gilt sie deutlich zu sehen, sie positiv zu würdigen und für ihre Zukunft zu kämpfen.
1.2. Grundrechte
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Dieser Satz eröffnet unser Grundgesetz und wird somit zu dessen A und O. Also nicht: „die Würde des deutschen Menschen“ oder „die Würde der Erwachsenen“ oder „die Würde der Männer“. Der Würde-Begriff des deutschen Grundgesetzes ist universalistisch, er meint gleichermaßen und gleichwertig die Würde aller Menschen, auch die von Kindern, Frauen, Behinderten, Homosexuellen oder Muslimen, sogar die von ungeborenem Leben, berührt außerdem die Reichweite und Qualität gentechnologischer Forschung. Maßstab der Würde kann nicht nur die Freiwilligkeit des Einzelnen sein, es muss auch ein Urteil Dritter geben, da man ansonsten die Menschenwürde als Kategorie abschaffte, an der man Verletzungen beobachten und ahnen könnte.
Definiert die politisch Linke ihren Begriff der Würde über das Marxsche Konzept von Entfremdung, wurde dieser Begriff im 19. Jh. sogar zu einem Kampfbegriff der Arbeiterbewegung, so verankert die politisch Rechte ihren Begriff der Würde nicht nur naturrechtlich, sondern verknüpft ihn völkerrechtlich mit dem Selbstbestimmungsrecht und einem Recht auf Heimat – dies gilt in Deutschland besonders für die Vertriebenenverbände nach 1945. Es ist also durchaus spannend zu sehen, dass es über diesen für das Grundgesetz so zentralen Begriff keinen nennenswerten Dissens zwischen Links und Rechts gibt, dass es bei der Entstehung des Grundgesetzes über diesen Begriff in den Debatten im Parlamentarischen Rat keine Kontroversen gab.
Vielleicht liegt die gewisse Pathetik dieses Satzes in seiner Differenz zwischen nur ganz wenigen und kleinen Wörtern und deren großer Bedeutung. Nun endlich, vier Jahre nach dem Ende des Faschismus, bedeuteten diese Wörter den radikalen und endgültigen Bruch mit Rechtsvorstellungen, die zwischen rechtlich privilegierten Herrenmenschen und reinen Zweckmäßigkeitserwägungen gegenüber Rechtssubjekten wie Juden, Farbigen, „Zigeunern“ und Russen unterschied.
Das Grundgesetz kennt sowohl Grundrechte als Menschenrechte, zu erinnern ist an den Gleichheitssatz (3.I.), die Glaubensfreiheit (4.I.), die Meinungsfreiheit (5.I.) oder das Koalitionsrecht der Arbeitnehmer mit Drittwirkung (9.3.), als auch Grundrechte als Bürgerrechte, beispielhaft stehen dafür die Versammlungsfreiheit (8.I.), die Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet (11.I.) oder die freie Berufswahl (12.I.).
Dieses Grundrechtssystem ist einerseits Voraussetzung für Demokratie, andererseits ist in der gegenwärtigen sozialen Organisation von Menschen in industriellen und informationellen Großgesellschaften nur die Demokratie in der Lage, individuelle Grundrechte universalistisch für jedermann und jedefrau zu schützen. Doch genau an dieser Stelle hapert es und zwar zweifach. Sieht man sich einerseits die Qualität der Verfassungsänderungen nach 1949 an, dann wurde noch stets staatlich-institutionalisierte Gewalt gestärkt, sei es in der neuen Wehrverfassung von 1956 oder in der Notstandsverfassung von 1968 und verfassungslogisch hieß das noch jedes mal eine Schwächung der individuellen Grundrechte bei einer ursprünglichen Balance zwischen Individuum und Staat. Sieht man sich andererseits die Entwicklung der Verfassungswirklichkeit bei den Menschenrechten an, so ist das Ergebnis kaum positiver. Den verschiedenen Berichten über die Situation der Menschenrechte in Deutschland, sei es die der Humanistischen Union, der Gustav Heinemann-Initiative, des Komitees für Grundrechte und Demokratie, von Pro Asyl, der Internationalen Liga für Menschrechte oder die von Amnesty International, ist jährlich nicht viel Gutes zu entnehmen. Besonders der Bereich der Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit wird von Jahr zu Jahr durch immer größere Skandale erschüttert, so dass die in Art. 5 GG gewährten Garantien das Papier kaum noch wert sind, auf dem sie gedruckt stehen.
Die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 hat im innerdeutschen Recht übrigens keinen Verfassungsrang und die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte stehen nicht über dem Grundgesetz. Menschenrechtskonflikte zeigen sich auch zwischen der EU-Kommission und dem Grundgesetz. Wenn zahlreiche Richtlinien der EU-Kommission zu innerdeutschem Recht werden, dann ist eine solche Übernahme verfassungsrechtlich immer dann höchst problematisch, wenn diese Richtlinien menschenrechtsrelevant sind. Europäisches Recht droht also zentrale Bereiche des Grundgesetzes zu verändern, obwohl weder die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 noch erst recht die EU-Kommission jemals von einem demokratisch gewähltem Souverän legitimiert wurden.
1.3.Volkssouveränität
Im alltäglichen Geschäft mit der Politik, sei es in Presse, Parlament, Schule oder Alltag, genügt so manchem Zeitgenossen eine schnell hingeworfene Definition von Demokratie mit einem Hinweis auf die Gewaltenteilung von Legislative, Exekutive und Judikative. Doch dieses Verständnis greift zu kurz, übersieht es doch den alles entscheidenden Satz 1, Absatz 2 in Artikel 20 GG, der da heißt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. Erst danach folgt mit Satz 2 der folgende Gedanke: „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“
So findet sich also im Grundgesetz zwar das traditionelle Gewaltenteilungsschema des liberalen Verfassungsstaates wieder, erscheint aber nicht als eigenständiges Prinzip für und aus sich selbst heraus. Das Gegenteil ist der Fall: Die Gewaltenteilung ordnet sich funktional der Volkssouveränität unter und erhält die Aufgabe, Distanz und Entfremdung zwischen dem Volk und der politischen Elite in Legislative, Exekutive und Judikative zu verhindern. So soll die politische Willensbildung des Volkes wach bleiben und in Gang gehalten werden halten. Artikel 20 enthält also nicht das Prinzip einer reinen, sondern das einer funktionalen Gewaltenteilung und zwar mit dem Volk als Souverän.
Für das Demokratieverständnis des Grundgesetzes ist Satz 2 Artikel 20 auch insofern wichtig, als hier neben dem Wort „Wahlen“ gleichberechtigt das Wort „Abstimmungen“ auftaucht. Allen deutschen Sozialkundelehrern sei deswegen ins Stammbuch geschrieben, dass das Grundgesetz zwar eine parlamentarisch-repräsentative Demokratie vorsieht, aber außerdem plebiszitäre Elemente kennt, auch wenn es diese kaum näher beschreibt, sieht man von den in Art. 29 erwähnten Volksbegehren zur Länderneugliederung und einer in Art. 146 vorgesehenen neuen Verfassung vom „deutschen Volke in freier Entscheidung“ ab. Darüber hinaus könnten Plebiszite auf Bundesebene über Art. 79 GG jederzeit mit Zweidrittelmehrheit eingeführt werden. Allen deutschen Sozialkundelehrern sei außerdem ins Stammbuch geschrieben, dass es eine Mär ist, zu behaupten, das Grundgesetz kenne deswegen das Instrument des Volksbegehrens nicht, weil man damit in der Weimarer Republik so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Gut kann dagegen die Forschung inzwischen dokumentieren, dass das Plebiszit im Grundgesetz deswegen nicht vorkommt, weil im Parlamentarischen Rat sowohl SPD als auch CDU das Interesse gehabt hatten, dieses Instrument nicht kommunistischen Politikern zu überlassen, da diese in der Nachkriegszeit gut Chancen gehabt hätten, mit diesem demokratischen Instrument erfolgreiche Politik zu betreiben. Und um sich die Lernprozesse der deutschen Bevölkerung aus den undemokratischen Strukturen des Faschismus zu verdeutlichen, muss in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf verwiesen werden, dass das Instrument des Volksbegehrens in so manchen Länderverfassungen vorkommt, also vor der Restaurationsperiode, die mit dem Grundgesetz von 1949 beginnt, das gilt besonders für die Verfassungen der Bundesländer Hessen und Hamburg von 1946 und Bremen von 1947.
Von Demokratie kann ganz offensichtlich dann nicht die Rede sein, wenn das Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, darauf reduziert würde, einmal gewählten „Repräsentanten“ nach dem Wahlakt die Willensbildung völlig passiv zu überlasen. Artikel 20 ist so zu interpretieren, dass sich die Willensbildung der „Repräsentanten“ an die Stelle der „Repräsentierten“ setzt, dass unsere Republik also ein ständiger Demokratisierungsprozess von unten sein muss.
Gegenwärtig gilt in Deutschland das merkwürdige Demokratieparadox, dass die Einwirkungsmöglichkeiten des Volkssouveräns um so größer sind, je weniger gewichtig die Entscheidungsebene ist. Eine plebiszitäre Mitsprache besteht auf Ebenen mit geringer Entscheidungsbefugnis, also auf kommunaler, auf Kreis- und manchmal auf Länderebene, nicht dagegen auf Bundes- und erst recht nicht auf europäischer Ebene. Ganz zu schweigen davon, dass das Volk weder bei der Schaffung des Grundgesetzes noch bei der Verfassungsänderung mit dem Beitritt der neuen Bundesländer zum Grundgesetz von 1994 gefragt wurde.
Doch inzwischen gibt es einen seit längerem anhaltenden und spannenden Gärungsprozess: 70 Prozent der Bevölkerung befürworten eine direkte Demokratie auf Bundesebene und Plebiszite in den Kommunen und Ländern steigen jährlich an. Eine Gesetzesinitiative für ein Volksbegehren auf Bundesebene erreichte 2002 im Deutschen Bundestag immerhin eine einfache, wenn auch nicht dafür notwendige Zweidrittelmehrheit. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht wegen der Klagen gegen den Lissabon-Vertrages urteilen wird. Vielleicht schlägt ja das höchste deutsche Gericht eine Volksabstimmung über diesen Vertrag vor.
2.Verfassungsänderungen
Von Verfassungsreformen immer dann zu reden, wenn es um grundlegende Änderungen des Grundgesetzes ging und nicht nur einfach Verfassungsänderungen, hieße von Anfang an dem Willen der Protagonisten dieser Änderungen aufzusitzen. Wer weiß denn schon so genau, ob jede Änderung auch gleichzeitig eine Reform ist und ob nicht viele Änderungen einen Schritt nach hinten bedeutet haben, also nicht Reform, sondern Rückschritt sind und waren.
Insgesamt kann man nach 1949 von vier wichtigen Verfassungsänderungen ausgehen: der Wehrverfassung von 1956, der Notstandsverfassung von 1968, der sogenannten Verfassungsreform nach der deutschen Vereinigung von 1994 und der sogenannten Föderalismusreform von 2004.
Wie wurde bei diesen Änderungen das Grundgesetz verändert, in welcher Richtung und wie sind diese Änderungen im einzelnen zu bewerten?
In seiner Ursprungsfassung von 1949 enthielt das Grundgesetz keinerlei Bestimmungen über den Einsatz deutscher Streitkräfte. Freilich regelte Art. 26 als Staatszielbestimmung sehr deutlich das „friedliche Zusammenleben der Völker“ und legte das Verbot eines „Angriffskrieges“ fest. Wäre es nach dem SPD-Abgeordneten Carlo Schmid gegangen, dann hätte Art. 26 nicht nur den Angriffskrieg, sondern Kriege insgesamt geächtet. In Kombination mit der Sozialstaatsklausel von Art. 20 GG kennen beide Artikel zusammengenommen die positive Friedenspflicht des Grundgesetzes. Der Angriffskrieg ist also nicht nur geächtet, vielmehr gilt es aktiv gegen Ungerechtigkeit, Armut, Ungleichheit, Ausbeutung usw. anzugehen. Die Wehrverfassung von 1956 rückte von dieser anti-militaristischen Stoßrichtung des ursprünglichen Grundgesetzes insofern ab, als sie nun in Art. 87 GG vom Bund „zur Verteidigung aufgestellte Streitkräfte“ rückgekoppelt an das Budgetrecht des Parlamentes zuließ. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass diese Wehrverfassung mit Art. 17a GG erhebliche Grundrechtseinschränkungen für die Angehörigen der Streitkräfte mit sich brachte.
Genauso schwerwiegend wie die Wehrverfassung änderte die Notstandsverfassung von 1968 den radikaldemokratischen Charakter des alten Grundgesetzes. Wie bei der Wehrverfassung setzt auch die Notstandsverfassung den schon vorgegeben Trend von 1956 fort: Der Staat wird gestärkt und individuelle Grundrechte werden radikal beschnitten. Im Verteidigungs-, Spannungs- und Katastrophenfall und bei einem inneren Notstand treten zahlreiche Grundrechte außer Kraft. So gibt es beispielsweise keinerlei Rechtsmittel mehr gegen die Aufhebung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist insbesondere der neue Artikel 12a alles andere als eine ärgerliche Kleinigkeit, da bei einem Notstand Arbeitskämpfe und Streiks ihren verfassungsrechtlichen Schutz verlieren, die freie Wahl des Arbeitsplatzes nicht mehr gegeben ist und die Freiheitsrechte des Einzelnen so reduziert werden, dass das gesamte deutsche Volk – eigentlich doch der Souverän! – in eine jeden Bürger erfassende Arbeits- und Dienstpflicht genommen werden kann.
Mit genauso heftigen Mängeln war dann die dritte große Verfassungsänderung behaftet, nämlich die Änderung anlässlich des Einigungsprozesses zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Sie brachte gerade das nicht, was sich viele Menschen erhofft hatten, nämlich eine grundsätzliche Verfassungsreform. Die DDR trat der BRD am 3. Oktober 1990 nach Art. 23 GG „einfach“ bei. Und bereits mit diesem Weg und nicht dem über Art. 146 GG war die Chance vertan, dass „Deutschland als Ganzes“ die Chance einer souveränen Verfassungsgebung erhalten hätte. Die politischen Parteien im Deutschen Bundestag verhinderten ein über Art. 146 GG mögliches Plebiszit, nach dem das alte Grundgesetz an dem Tag seine Gültigkeit verliert, „an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen ist“. Zwar hob diese Verfassungsänderung von 1994 nun endlich sämtliche alliierten Vorbehaltsrechte auf und stellte eine staatliche Einheit her, doch blieb die Chance auf eine Erweiterung unmittelbarer demokratischer Elemente im Grundgesetz ungenutzt. Weder hielten soziale Grundrechte wie die auf Arbeit und Wohnung ihren Einzug ins Grundgesetz, noch wurden Elemente einer direkten Demokratie gestärkt. Genau das aber wäre der historischen Situation der deutschen Vereinigung adäquat gewesen, war es doch der friedliche, zivilgesellschaftliche, basisdemokratische und plebiszitäre Druck der widerständigen Bürger in der DDR gewesen, der den Zusammenbruch dieses Landes und damit die Vereinigung Deutschlands ermöglicht hatte. Der Bürgerprotest in der DDR hatte zwar zum Zusammenbruch des Systems geführt, doch hinter Tempo und Art und Weise der „Wiedervereinigung“ hatten jedoch andere Kräfte und Interessen als die der DDR-Oppositionellen und der Mehrzahl der Bürger gestanden. Im Gegensatz zu vielen Verfassungsvorschlägen des Runden Tisches aus der DDR wurde das Grundgesetz inklusive des kapitalistischen Wirtschaftsmodells der anderen Seite einfach und ungefragt „übergestülpt“.
Die vierte Änderung des Grundgesetzes, nämlich die im Sommer 2006 beschlossene sogenannte Föderalismusreform, ist die umfangreichste Änderung der deutschen Verfassung seit 1949. Doch hat sie eine der wesentlichsten Aufgaben ausgeklammert, nämlich eine Reform der finanziellen Arbeitsteilung zwischen Kommunen, Ländern und Bund, obwohl das für eine wirkliche Neugestaltung von herausragende Bedeutung gewesen wäre und obwohl seit langem sichtbar ist, dass die neuen Bundesländer auf absehbare Zeit das arme Mezzogiorno Deutschlands bleiben werden und damit von den verfassungsrechtlich gewährleisteten „gleichwertigen Lebensbedingungen“ nach der Rahmengesetzgebung von Art. 75 GG keine Rede mehr sein kann.
Die Ergebnisse dieser vierten Verfassungsänderung sind ausgesprochen ambivalenter Natur. Auf der einen Seite stärken sie die Autonomie der Bundesländer, auf der anderen Seite laufen die Veränderungen unter den real gegebenen Bedingungen einer neoliberalen Ökonomie darauf hinaus, dass finanziell starke Bundesländer von den Veränderungen eher profitieren als finanziell schwache. Ferner besteht die Gefahr, dass bei der Übertragung vieler Kompetenzen vom Bund auf die Länder, sei es in der Bildungspolitik, beim Ladenschluss-, Strafvollzugs- und Umweltrecht, ein Wettlauf um den jeweils niedrigsten juristischen Standard einsetzt. Dieser „race to the bottom“ träfe sich dann mit ganz anderen Tendenzen, nämlich einer Privatisierung von Recht, wie sie in vielen Bereichen zu beobachten ist. Das aber wäre dann der sprichwörtlich darwinistische Zustand eines Recht des Stärkeren als Konsequenz auf die Abwesenheit eines starken Rechts.
Was bleibt von den vier wichtigen Verfassungsänderungen?
Gemessen am Demokratiegehalt des Grundgesetzes von 1949 stehen alle vier Änderungen für den kontinuierlichen Abbau der individuellen Grundrechte, die kontinuierliche Vernachlässigung von Formen einer direkten Demokratie – und das sogar bei der deutschen Vereinigung – und für die kontinuierliche Stärkung des Staates. Und mit diesen Tendenzen wurden viele Balancen des alten Grundgesetzes völlig außer Kraft gesetzt.
3. Verfassungswidrige Tendenzen der Gegenwart
Das deutsche Grundgesetz steht gegenwärtig von vielen Seiten unter erheblichem Druck.
Und selbstverständlich ist der Druck da am stärksten, wo sich die Diskrepanz zwischen dem Wohlfahrtsverspechen der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit ins Unermessliche steigert. Innerhalb der EU hat Deutschland den höchsten Anteil an Langzeitarbeitslosen, die schlechteste Entwicklung im Einzelhandel, die geringste Entwicklung von Löhnen und Gehältern, die höchste Lohndiskriminierung der Frauen, die zweitschlechteste Entwicklung bei der Nachfrage privater Haushalte und das drittschlechteste Rentenniveau (gemessen am letzten Einkommen). Kein Wunder, dass Armutsforscher die Armutsquote für Deutschland auf 18 Prozent ansetzen, für Kinder sogar auf 26 Prozent.
Wie richtig und dringend auch immer solche Debatten über den Unterschied zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit auch sind, so richtig und dringend sind gleichzeitig Debatten über den Unterschied zwischen Verfassungsrecht und Verfassungsunrecht und zwar deswegen, weil Recht die Wirklichkeit nicht nur nachträglich bewertet, sondern sie auch und außerdem vorausschauend mitgestaltet.
Gegenwärtig gestalten erstens das Kriegsrecht, zweitens ein eigenes Feindstrafrecht und drittens der ungestörte Ausbau von Überwachungsrechten die gegenwärtige und zukünftige Wirklichkeit ausgesprochen negativ.
3.1. Kriegsrecht
Die Beteiligung der Deutschen Bundeswehr am NATO-Krieg gegen Jugoslawien 1999 stellt innerstaatlich wie völkerrechtlich einen außerordentlichen Wendepunkt in der gesamten bisherigen deutschen Rechtskultur nach 1945 dar. Dieses festzustellen, ist weder polemisch, noch schwierig zu begründen. Die Sprache des Grundgesetzes ist gerade in diesem Fall besonders klar und eindeutig. Die Bundeswehr ist nur zur Verteidigung dar, sie darf zur Verteidigung nur dann eingesetzt werden, wenn es einen Angriff mit Waffengewalt auf das Bundesgebiet gibt und ein Angriffskrieg ist verfassungswidrig und wird unter Strafe gestellt. Lässt sich denn eine andere Feststellung treffen als die, dass im März 1999 niemand Deutschland oder einen ihrer Verbündeten angegriffen hat? Nicht nur war dieser Kriegseinsatz verfassungswidrig, er war außerdem weder vom Sicherheitsrat der UN genehmigt worden, noch entsprach er den Rechtsverpflichtungen des Washingtoner NATO-Vertrages von 1949.
Diesem dreifachen Rechtsbruch folgt der Lissabon-Vertrag durchaus konsequent, denn er erlaubt nach Art. 43 einen Krieg zur Bekämpfung von Terrorismus in der ganzen Welt, auch einen Krieg zur „Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen“, also beispielsweise dann, wenn es gilt, Rohstoffe zu sichern. Ist der Kriegseinsatz in Deutschland (zur Zeit noch) an den Parlamentsvorbehalt geknüpft, so soll in Zukunft der EU-Ministerrat bei einer militärischen Mission genauso hinter verschlossenen Türen entscheiden wie bei der nach Art. 42 vorgesehenen Verpflichtung für alle Mitgliedsstaaten, jährlich militärisch aufzurüsten. Weder ist der EU-Ministerrat ein demokratisch gewähltes Gremium, noch gibt es bei einem Kriegseinsatz europäischer Truppen eine regelmäßige Berichtspflicht gegenüber dem Europäischen Parlament.
3.2. Feindstrafrecht
Innerhalb der letzten zwanzig Jahre haben einige Strafrechtler, besonders Günther Jakobs von der Universität Bonn, mit großem Erfolg ein sogenanntes Feindstrafrecht entwickelt und passend dazu hält sich ein Verfassungsrechtler wie Horst Dreier von der Universität Würzburg für Extremsituationen eine Folteroption offen. Eine spezielles Strafrecht für Feinde steht selbstverständlich in der Nachfolge des nationalsozialistischen Staatsrechtlers Carl Schmitt mit dessen absoluten und totalitären Feindbegriff, es sieht ernsthaft ungleiche Rechtsmittel für „Freund“ und „Feind“ vor und setzt als Präventivrecht wesentliche Bestandteile von Rechtsstaatlichkeit außer Kraft. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zeichnet sich unter anderem darin aus, dass jedem Angeklagten die Unschuldsvermutung solange zusteht, bis er von einem ordentlichen Gericht rechtskräftig verurteilt wurde. Während ein Präventivrecht diese Zeit- und Kausalachse umdrehen würde, bedeutet ein Feindstrafrecht die Rückkehr zu einem vordemokratischen Faustrecht, da demokratisch legitimiertes Strafrecht gar nicht Rache ausüben oder strafen, sondern resozialisieren will. In den USA äußerten sich solche Auseinandersetzungen um eine Vorverlagerung von Recht in einen vorrechtlichen Raum mit umstrittenen juristischen Begriffen wie „Präemption“ versus „Prävention“ oder „feindliche Kämpfer“ versus „ungesetzliche feindliche Kämpfer“ und in menschenrechts- und völkerrechtswidriger Folter von Gefangenen auf Guantanamo. Zwar erklärte der neue US-amerikanische Präsident Barack Obama Folter vor kurzem für rechtswidrig, thematisierte aber das gleichermaßen heiße Problem eines Präventivrechts, zumal eines oft extraterritorialen Präventivrechts der USA, in keiner Form. Wehe einem rechtsstaatlichen Justizsystem dann, wenn ein „Schläfer“ deswegen strafrechtlich belangt werden kann, weil er die Tat vor deren Ausführung schon gedacht hat, möglicherweise nur im Schlaf und gleichermaßen wehe einem rechtsstaatlichen Justizsystem, wenn „heimliches Grinsen“, wie moralisch auch immer verwerflich, strafbar wird.
Solche Denkspiele sind besonders brandgefährlich, wenn sie von Juristen kommen. Um es klar und eindeutig zu sagen: Mit dem im Grundgesetz an vielen Stellen verbürgten Gleichheitsgebot, dem Rechtsstaatsgebot, dem Demokratiegebot, der Justizgewährungspflicht und dem Grundsatz der Gewaltenteilung ist weder ein spezielles Feindstrafrecht noch ein Präventivrecht vereinbar. Schlimmer: Rechtsfiguren wie Feindstrafrecht und Präventivrecht sind Ausdruck politischer Willkür und Gesinnungsjustiz und bedeuten das Ende von Demokratie. Sie sind mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
3.3. Überwachungsrechte
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Diese unglaubliche, diese noch nie zuvor gehörte Botschaft aus dem Bonner Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig, in dem der
Parlamentarische Rat 1948/49 das Grundgesetz entworfen hatte, wird gegenwärtig zu Grabe getragen. Wegen des 11. September 2001 und/oder in bewusster politischer Instrumentalisierung dieses Datums ist Art. 1 gegenwärtig nur noch durch das Verfassungsgericht in Karlsruhe zu retten, kaum noch durch deutsche Parlamente. Ob die Bekämpfung von Terroristen, seien es die der Rote Armee Fraktion oder die von Al Qaida, die Sicherheit erhöht, ist eine empirisch offene Frage, dass sie die Menschenwürdegarantie immer wieder und stets aufs Neue verletzen, ist dagegen eindeutig belegbar.
Der sogenannte Große Lauschangriff, die bundesweit koordinierte Rasterfahndung, die Online-Durchsuchung im Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen, die hessischen und schleswig-holsteinischen Regelungen zur automatischen Erfassung von Kfz-Kennzeichen, das Luftsicherheitsgesetz, das dem Staat den Abschuss eines von Terroristen entführten, möglicherweise zur Waffe eines Selbstmordattentats umfunktionierten Zivilflugzeugs erlaubte – alle diese Gesetze wurden einerseits von Parlamentariern in Landtagen oder im Deutschen Bundestag beraten, eingebracht und mehrheitlich verabschiedet. Es waren und sind aber unverantwortliche und grundgesetzwidrig handelnde Parlamentarier, denn andererseits wurden alle die eben genannten Gesetze nach ihrer Verkündung vom Karlsruher Bundesverfassungsgericht ganz oder teilweise für nichtig erklärt. Richtigerweise erklärte sie das höchste deutsche Gericht unter anderem wegen Verletzung der Menschenwürdegarantie für ungültig. Es ist zu hoffen, dass das Verfassungsgericht auch das vom Deutschen Bundestag am 2. Mai 2009 verabschiedete BKA-Gesetz zurückweist, da es dem Bundeskriminalamt eine Vielzahl heimlicher und vorbeugender Ermittlungsverfahren ohne konkreten Verdacht erlaubt, also Telefonüberwachung, Lausch- und Spähangriffe und Computerdurchsuchungen, und außerdem das Zeugnisverweigerungsrecht von Journalisten, Ärzten und Rechtsanwälten abschafft. Es ist ferner zu hoffen, dass höchste deutsche Gericht auch das zur Zeit in der Beratung befindliche Gesetz zur „Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen“ stoppen wird, da auch hier ein verfassungsrechtlicher Missbrauch mit einem Missbrauch vorliegt.
In seiner Begründung zum Luftsicherheitsgesetz vom Januar 2005 betonte das Verfassungsgericht, das Gesetz sei deswegen verfassungswidrig, weil es die in einem Flugzeug sitzenden unschuldigen Passagiere und Besatzungsmitglieder als „Objekte behandele“ und sie damit „verdingliche und zugleich entrechtliche“, der Schutz des Lebens gelte auch für „Todgeweihte“. Der Schutz des Lebens gelte ungeachtet der vermuteten Dauer der „physischen Existenz des einzelnen Menschen“ für alle gleichermaßen.
Dieses Urteil ist nicht nur grundgesetzkonform und deswegen richtig, es ist auch spannend, weil das Gericht den Staat sogar mit Terroristen für den Fall gleich gesetzt hat, hätte dieses Gesetz Gültigkeit erlangt. In der Karlsruher Entscheidung hieß es, nicht nur Terroristen machten ihre Opfer zu Objekten, „auch [!] der Staat […] behandelt sie als bloße Objekte seiner Rettungsaktion“. Mit diesem Vergleich geht das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung also soweit, dem deutschen Staat eine potentielle staatsterroristische Qualität zu attestieren.
Der grundgesetzwidrige staatliche Überwachungswahn, der die Grundgesetztrias von Würde, Freiheit und Sozialstaat in Richtung eines einzigen verbliebenen Fluchtpunkts, nämlich dem der Sicherheit, aufgelöst hat, bleibt nicht ohne Folgen für die Privatwirtschaft und das Rechtsempfinden des einzelnen Bürgers. Während 1983 die Bewegung gegen die Volkszählung eine der größten und erfolgreichsten sozialen Bewegungen nach 1945 waren, vertraut der gegenwärtige Internetnutzer seine intimsten persönlichen Daten freiwillig einem scheinbar anonymen elektronischen Netz an und während der gesetzlich vorgeschriebene staatliche Datenschutz zu einer Rechtsfigur von Vorgestern verkommen ist, produzieren private Unternehmen wie Lidl, die Drogeriekette Müller, die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Telekom, die Landesbank Berlin oder der Kabelnetzbetreiber KabelDeutschland einen Datenskandal nach dem anderen.
Schmerzlich zeigt sich übrigens bei dem seit vielen Jahren kontinuierlich betriebenen Ausbau von Überwachungsrechten durch den Staat, dass das Ende einer liberalen politischen Intelligenz (z. B. Theodor Eschenburg, Burkhard Hirsch, Hildegard Hamm-Brücher, Gerhart Rudolf Baum), die sich viele Jahre mit Erfolg gegen derartige Gesetze zur Wehr gesetzt hatte, nie von einer anderen sozialen Kraft kompensiert wurde – auch nicht von der Partei der Grünen. Im Deutschen Bundestag knüpften erst PDS und Die Linke an diese Tradition der liberalen politischen Intelligenz wieder aktiv an.
4. Das beschädigte Grundgesetz
Unser Grundgesetz ist grob beschädigt. Unsere Republik ist es gleichermaßen. Wo kommen gleichermaßen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit dann hin, wenn wie gegenwärtig rund 200 von der Großindustrie bezahlte Mitarbeiter an Bundesministerien ausgeliehen werden, um dort an Gesetzesvorlagen mitzuarbeiten?
Selbstverständlich und mit letzter Konsequenz gibt es ein positives Verfassungsrecht auf Widerstand. Dies ergibt sich nicht nur sachlogisch zwingend aus dem Gedanken der Volkssouveränität, sondern wird seit der Notstandsverfassung von 1968 in Art. 20.IV. auch explizit formuliert. Und verfassungshistorisch muss an dieser Stelle der Hinweis darauf kommen, dass Art. 147 der hessischen Verfassung bei verfassungswidrigen Zuständen nicht nur ein Widerstandsrecht, sondern sogar eine Widerstandspflicht für jedermann postuliert. Ähnliches gilt für Art. 19 der Verfassung Bremens: „Wenn die in der Verfassung festgelegten Menschenrechte durch die öffentliche Gewalt verfassungswidrig angetastet werden, ist Widerstand jedermanns Recht und Pflicht.“
Widerstand, Verweigerung und ziviler Ungehorsam ergeben sich als Handlungskonsequenz genauso wie der aktive politische Kampf für wirkliche Neuerungen und Reformen. Verfassungslogisch steht auf der politischen Tagesordnung für die nahe Zukunft eine Verankerung der sozialen Grundrechte im Grundgesetz. Verfassungslogisch deswegen, weil ein solcher Schritt die schief gewordene Balance zwischen Staat und Menschenrechten nach den vier großen Verfassungsänderungen wieder zurecht rücken würde. Und sage bitte niemand, dass soziale Menschenrechte nicht in die Systematik des deutschen Verfassungsrechts passen würden. Erstens kennt das Grundgesetz mit dem menschenrechtlichen Schutz der Familie in Art. 6.I. ein soziales Menschenrecht, zweitens kennen einzelne Landesverfassungen wie die des Landes Bremen in ihren Artikeln 8 und 14 ein Recht auf Arbeit und Wohnung und schließlich hat Deutschland die UN-Menschenrechtsdeklaration von 1948 unterzeichnet, die das Recht auf soziale Sicherheit, Arbeit und Wohnung festschreibt (im übrigen auch ein Recht auf Freizeit, Erholung und sogar Urlaub).
Zu kämpfen ist ganz allgemein gegen einen weit verbreiteten Rechtsnihilismus, insbesondere gegen den vieler Parlamentarier bei deren völliger Verkennung von Art. 38 GG: Abgeordnete sind nicht opportunistische Knechte ihrer Partei oder der von ihnen selbst erhofften Pensionshöhe, sondern „Vertreter des ganzen [!] Volkes […] und nur ihrem Gewissen unterworfen“. Es war eine einsame und mutig positive Sternstunde des deutschen Parlamentarismus, als sich 1982 die FDP-Abgeordnete Hildegard Hamm-Brücher beim Sturz von Bundeskanzler Helmut Schmidt unter Berufung auf Art. 38 GG auf ihr eigenes Gewissen berief und sich dem Fraktionszwang ihrer Partei widersetzte. Das Grundgesetz kennt sehr wohl den Begriff des Gewissens, nicht aber den des Fraktionszwangs!
Wo Parlamentarier selbst das Grundgesetz beschädigen und einer seit langem ansteigenden Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit dauernden Vorschub leisten, da kehrt die Vernunft auf die Strasse zurück, da findet sich die verlorene Vernunft des Grundgesetzes von 1949 auf der Straße wieder: Prekarier aller Länder, vereinigt Euch!
Ein Blick zurück kann zu einem Blick nach vorne führen. In der Präambel der Verfassung des Landes Bremen vom 21. Oktober 1947 heißt es:
„Erschüttert von der Vernichtung, die die autoritäre Regierung der Nationalsozialisten unter Missachtung der persönlichen Freiheit und der Würde des Menschen in der jahrhundertealten Freien Hansestadt Bremen verursacht hat, sind die Bürger dieses Landes willens, eine Ordnung des gesellschaftlichen Lebens zu schaffen, in der die soziale Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und der Friede gepflegt werden, in der der wirtschaftlich Schwache vor Ausbeutung geschützt und allen Arbeitswilligen ein menschenwürdiges Dasein gesichert wird.“
Der Autor: Prof. Dr. Jörg Becker, geb. 1946 in Bielefeld, ist Hochschullehrer an den Instituten für Politikwissenschaft der Universität Marburg und der Universität Innsbruck.
*Prof. Dr. Wolfgang Abendroth lehrte von 1950 bis 1972 Politikwissenschaft an der Universität Marburg. Er war einer der wesentlichen intellektuellen Köpfe hinter der studentischen Rebellion von 1968. In rechtsstaatlichen Grundrechten sah Abendroth die Voraussetzung für eine von ihm angestrebte sozialistische Gesellschaft – Sozialismus konnte nach seinen Vorstellungen nur in Verbindung mit einer Weiterentwicklung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten gedacht werden. Während meines politikwissenschaftlichen Studiums in Marburg von 1966 bis 1971 führte mich Wolfgang Abendroth in das deutsche Grundgesetz ein. Ich habe ihm und seiner Grundgesetzinterpretation viel zu verdanken.
Literatur:
Abendroth, Wolfgang: Das Grundgesetz. Eine Einführung in seine Probleme, Pfullingen: Neske 1966.
ders.: Das Grundgesetz. Zum demokratischen und sozialen Gehalt, in: antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Main/Juni 2009, S. 12 [Erstveröffentlichung 1974].
Bommarius, Christian: Bedrohte Grundlage. Verfassung. Werte des Grundgesetzes dürfen nicht vergessen werden. Ein Appell, in: Das Parlament, 6.-14. April 2009, S. 5.
Eidenmüller, Horst: Kampf um die Ware Recht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. März 2009, S. 8.
Frank, Götz: Art. 87, Sonderabschnitt: Einrichtung und Kontrolle von Streitkräften, in: Denninger/Hoffmann-Riem/Schneider/Stein (Hrsg.): Kommentar zum Grundgesetz für die Bundes¬republik Deutschland. 3. Aufl., Neuwied: Luchterhand 2001, S. 1-28.
Frank, Götz und Meyerholt, Ulrich: Das Umweltrecht nach der Föderalismusreform, in: Heilmann, Joachim u. a. (Hrsg.): Europa-Ver¬fassung, Arbeit, Umwelt. Liber amicorum Hartwig Donner, Baden-Baden: Nomos 2007, S. 53-63.
dies.: Die gescheiterte Verfassungsreform, in: Mut. Forum für Kultur, Politik und Geschichte, Mai 2009 [im Erscheinen].
Gössner, Rolf: Menschenrechte in Zeiten des Terrors: Kollateralschäden an der „Heimatfront“, Hamburg: Konkret 2007.
Hahnfeld, Bernd: Gericht und Krieg. Das Bundesverfassungsgericht verspielt seine Glaubwürdigkeit, in: Wissenschaft & Frieden, Nr. 4/2007, S. 5.
Jahnke, Joachim: Nicht Deutschland, Deutschlands Wirtschaftspolitik ist ein Sanierungsfall, in: Frankfurter Rundschau, 9. Mai 2008, S. 21.
Jung, Otmar: Grundgesetz und Volksentscheid. Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rates gegen Formen direkter Demokratie, Opladen: Westdeutscher Verlag 1994.
Kutscha, Martin: „Verteidigung“ – Vom Wandel eines Verfassungsbegriffs, in: Kritische Justiz, Nr. 3/2004, S. 228-240.
Müller-Heidelberg, Till u. a. (Hrsg.): Grundrechte-Report 2008. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, Frankfurt: Fischer Taschenbuch 2008.
Neskovic, Wolfgang: Das Grundgesetz und das Sozialstaatsgebot. Vortrag auf der Konferenz „Das Grundgesetz: Offen für eine neue soziale Idee“, Leipzig 6./7. März 2009, in: http://die-linke.de/politik/aktionen/das_grundgesetz_offen_fuer_eine_neue_soziale_idee/die_konferenz/ das_grundgesetz_und_das_sozialstaatsgebot
Prantl, Heribert: Ihr Wort wird Gesetz. Der lange Arm der Lobbyisten: Wie man sich in Deutschland sein Recht selber schreiben kann, in: Süddeutsche Zeitung, 21./22. Februar 2009, S. 7.
Rogner, Klaus Michael: Der Verfassungsentwurf des zentralen Runden Tisches der DDR, Berlin: Duncker & Humblot 1993.
Schachtschneider, Karl Albrecht: Der Vertrag von Lissabon ist ein Grundgesetz des ungebremsten Kapitalismus, in: Zeit-Fragen, 6. April 2009, S. 3-4.
Sack, Fritz: Juristen im Feindstaat. Wer den Rechtsstaat verteidigen will, muss die Gründe seines Niedergangs in den Blick nehmen, in: Vorgänge, Nr. 2/2007, S. 5-26.
Sterzel, Dieter (Hrsg.): Kritik der Notstandsgesetze, Frankfurt: Suhrkamp 1968.
Wallraff, Günter: In Mehdorns Dickicht. Mitarbeiter der Bahn berichten, wie der Sicherheitsapparat ihres Konzerns sie ausspioniert und drangsaliert habe, in. Die Zeit, 25. April 2009, S. 21-22.