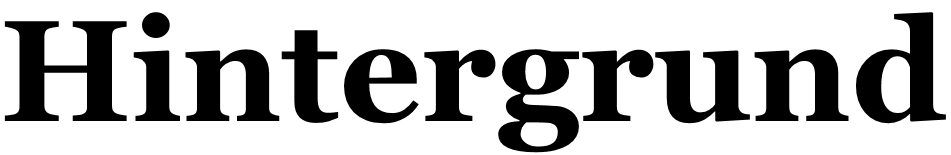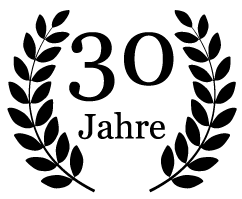„Wahl-O-Mat“: Nutzerrekord trotz Kritik
Bundeszentrale für politische Bildung meldet mehr als 21 Millionen Zugriffe auf „Wahl-O-Mat“ / Kritik: Aufrüstung und Kriegsbeteiligung nur Randthemen, Corona-Aufarbeitung kommt nicht vor / Politikwissenschaftler: Reales Abstimmungsverhalten der Parteien spielt keine Rolle
(Diese Meldung ist eine Übernahme von multipolar.)
Trotz Kritik von Wissenschaftlern und unabhängigen Journalisten verzeichnet der aktuelle „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) einen Nutzerrekord. Bereits in den ersten 24 Stunden nach Freischaltung am 6. Februar wurden mehr als neun Millionen Zugriffe auf die Online-Anwendung registriert, berichtete die „Tagesschau“. Bis Montagabend (17. Februar) sei die „Entscheidungshilfe“ für Wahlen schon mehr als 21,5 Millionen mal genutzt worden, heißt es in einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Dieser Wert übertreffe bereits jetzt die insgesamt 21,3 Millionen Zugriffe vor der Bundestagswahl 2021. Ob es sich dabei um absolute Nutzerzahlen handelt und Mehrfachzugriffe einzelner Anwender herausgerechnet wurden, geht aus den Medienberichten nicht hervor.
Der Journalist Norbert Häring kritisierte, der „Wahl-O-Mat“ stelle „manipulationsanfällige Detailfragen in willkürlich anmutender Auswahl“. Durch das Ausblenden wichtiger Themen würden Wähler zusätzlich manipuliert. Beispielsweise fehle wie bereits im Jahr 2021, das Thema „Corona-Aufarbeitung“. Weitere Probleme seien Häring zufolge die „unnötige“ Zuspitzung bei den Fragen und die geringe Differenzierung bei den Antwortmöglichkeiten. Der „Wahl-O-Mat“ ermöglicht lediglich die Antworten „stimme zu“, „stimme nicht zu“ und „neutral“. Zudem können Nutzer Thesen auch vollständig überspringen. Ein „Ja mit Einschränkungen“ sei als Antwortmöglichkeit hingegen nicht vorgesehen, bemängelt der Wirtschaftsjournalist. „Wenn sie ‚Nein‘ ankreuzen, ist unerheblich, ob sie das tun, weil ihnen der Vorschlag nicht weit genug oder zu weit geht.“
Das „Overton-Magazin“ schreibt, beim „Wahl-O-Mat“ handele es sich um „die brutalstmögliche Vereinfachung von politischen Debatten“. Das Magazin „Cicero“ kritisiert, das Online-Werkzeug werde „der Komplexität vieler Fragen oft nicht gerecht“. Die „Nachdenkseiten“ bezeichnen den Wahl-O-Mat als „Manipulationsmaschine”. Fragen zu Aufrüstung, Krieg und Frieden seien unterbewertet. Lediglich zwei der 38 zu bewertenden Thesen befassten sich mit den Themen Krieg und Aufrüstung. Dabei hatte das ZDF im „Politbarometer“ das Thema „Frieden/Sicherheit“ als das wichtigste für die Bürger identifiziert.
Zudem würden Nutzer des „Wahl-O-Mats“ durch zugespitzte Fragen zu falschen Parteipräferenzen geführt, heißt es bei den „Nachdenkseiten“ weiter. In These 22 werde beispielsweise gefragt, ob die Schuldenbremse im Grundgesetz beibehalten werden soll. Obwohl das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) „die Schuldenbremse in der derzeitigen Form eindeutig“ ablehne, schreibe der „Wahl-O-Mat“ dem BSW hier die Position „neutral“ zu. Grund sei, dass die Partei nicht explizit „eine Grundgesetzänderung“ fordert. Der Politikwissenschaftler Christian Stecker von der Technischen Universität Darmstadt, formulierte eine ähnliche Kritik. Die „zugespitzten“ Aussagen können das Ergebnis „verzerren“, sagte er der Tagesschau.
Auch der Politikwissenschaftler Norbert Kersting von der Universität Münster kritisiert die Online-Anwendung: „Der Wahl-O-Mat orientiert sich ausschließlich an den Positionen der Parteien, die diese zu den vorgegebenen Thesen abgeben.” Häufig stellten sich die Parteien in ihren Antworten an die zuständige bpb-Redaktion neutraler dar, als es ihre Wahlprogramme oder parlamentarischen Anträge seien, sagte Kersting in einem Bericht der Berliner Morgenpost. Problematisch sei weiter, dass die Thesen von Erstwählern ausgewählt wurden. Die ältere Generation habe nicht mitreden dürfen.
Der Wahl-O-Mat ging im Zuge der Bundestagswahl 2002 aus einem Projekt von Studenten der Freien Universität Berlin hervor. Seitdem wird er von der Bundeszentrale für politische Bildung betrieben. Die bpb ist eine Behörde und dem Bundesinnenministerium unterstellt. Vorbild und Lizenzgeber ist das 1989 in den Niederlanden eingeführte Format Stem Wijzer („Stimmen-Wegweiser“). Die „Entscheidungshilfe“, die sich vornehmlich an Jung- und Erstwähler richtet, wird seit 2002 auch für Landtags- und Europawahlen angeboten. Die Thesen im Wahl-O-Mat werden laut bpb von einem 38-köpfigen Redaktionsteam zusammengestellt, das sich aus 24 Jungwähler-Bewerbern, „Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung sowie den Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung“ zusammensetzt. Für die Bundestagswahl 2025 formuliere dieses Redaktionsteam aus den Wahlprogrammen aller Parteien 80 Thesen und bitte diese um eine Stellungnahme. Anschließend bestimme das Team 38 Thesen, die die jeweiligen Schwerpunkte trennscharf abbilden sollen.