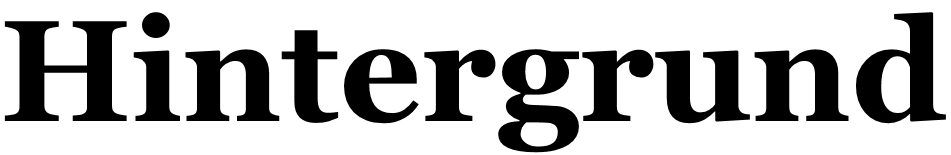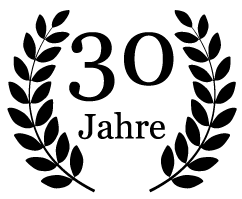Kommission des Europarats kritisiert Wahl-Annullierung in Rumänien
Venedig-Kommission: Annullierung von Wahlen darf nicht auf geheim gehaltenen Indizien beruhen / Antragssteller Hunko (BSW): „Verhindern, dass das rumänische Beispiel Schule macht“ / Wahlsieger: Rumänisches Gericht soll Entscheidung zurücknehmen
(Diese Meldung ist eine Übernahme von multipolar.)
Die Venedig-Kommission, eine verfassungsrechtlich beratende Einrichtung des Europarats, hat sich kritisch zur Annullierung der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien geäußert. Das rumänische Verfassungsgericht hatte in der Begründung seiner Entscheidung von Anfang Dezember 2024 auf eine mögliche Beeinflussung der Wahl durch Russland hingewiesen. Da die Behauptungen über ausländische Einflussnahme inzwischen größtenteils widerlegt sind, werten insbesondere die erst- und zweitplazierten Kandidaten der für nichtig erklärten Wahlrunde die Empfehlungen der Kommission als Bestätigung für eine Fehlentscheidung des Gerichts.
Die Fachleute für Verfassungs- und Völkerrecht der Venedig-Kommission hatten verschiedene Aspekte der Entscheidung des rumänischen Verfassungsgerichts untersucht. Um das Vertrauen der Wähler in die Legitimität der Wahlen zu erhalten, sollte der Kommission zufolge eine Ungültigerklärung von Wahlen „auf Ausnahmefälle beschränkt und klar geregelt“ sein. In jedem Fall sollten bei derartigen Entscheidungen die Personen sowie die Parteien, denen das Mandat verweigert wird, das Recht haben, „in Form einer Anhörung oder Konsultation“ ihre Argumente vorzubringen. Des Weiteren sollte die Entscheidung „auf eindeutig festgestellten Tatsachen“ und nicht ausschließlich auf unter Verschluss gehaltenen Geheimdienstinformationen beruhen. In jedem Fall sollte die Annullierung einer Wahl nur möglich sein, „wenn die Unregelmäßigkeiten echte und objektive Zweifel an der Richtigkeit des Wahlergebnisses aufkommen lassen“.
Die Kommission erklärte, die Einflussnahme von Nichtregierungsorganisationen, Medien, sozialen Online-Netzwerken (Social Media) sowie von ausländischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren kann bei der Entscheidung über die Ungültigkeit von Wahlen relevant sein. Allerdings sei es in Anbetracht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte „derzeit schwer vorstellbar“, „dass Form und Inhalt der Wahlkampfbotschaften von Kandidaten einen Verstoß gegen das Wahlrecht darstellen, der zur Annullierung der Wahlen führen kann“. Die einfache Tatsache, dass „ein Kandidat im Online-Wahlkampf erfolgreich“ sei und dass „die Nutzung von Social-Media-Plattformen die Botschaft eines Kandidaten über das hinaus verstärken“ könne, was „mit Print- und Rundfunkmedien möglich“ sei, bedeute nicht, „dass der Kandidat gegen die Regeln für Wahlkampfausgaben und Transparenz verstoßen und damit einen unlauteren Vorteil erlangt“ habe.
Darüber hinaus sollte es Dritten frei stehen, Spenden zu sammeln und sich zu politischen Themen zu äußern. Die Kommission empfiehlt die Einführung von Regelungen, dass Online-Wahlwerbung als solche gekennzeichnet und deren Finanzierung transparent sein muss. Parteien sollten dazu verpflichtet werden, „Daten über politische Werbung und ihre Sponsoren konsequent offenzulegen“. Der Antrag in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der zur Untersuchung durch die Venedig-Kommission geführt hat, wurde von Andrej Hunko (BSW), Bundestagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Unified European Left Group (UEL) im Europarat, eingebracht.
Hunko sagte gegenüber Multipolar, er habe die Initiative zur Anrufung der Venedig-Kommission ergriffen, „um zu verhindern, dass das rumänische Beispiel Schule macht“. Dabei verwies er auf die Äußerungen des ehemaligen EU-Kommissars Thierry Breton. Dieser hatte im französischen Fernsehen im Kontext von möglichen Wahlbeeinflussungen durch Elon Musk angedeutet, dass man ähnlich wie in Rumänien auch die Wahlen in Deutschland annullieren könnte. Hunko befürchtet, dass in Europa mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie „ausländische Einmischung“, „Terrorismus“, „Antisemitismus“, „Hate Speech“ oder „Verschwörungstheorie“ weitreichende rechtliche Entscheidungen getroffen werden. Die Verwendung von diffusen Rechtsbegriffen widerspreche „dem Prinzip von Rechtsstaatlichkeit“ und sei „ein Kennzeichen von autoritären Systemen“.
Der weiterhin amtierende rumänische Präsident Klaus Johannis erklärte in Reaktion auf den Bericht der Venedig-Kommission, dass nun das Parlament entscheiden müsse, „wo bestimmte Gesetzesänderungen angemessen sind“. Calin Georgescu wertet den Bericht hingegen als Beleg dafür, dass es keine Rechtfertigung für die Absage der Stichwahl gab. Er forderte das Verfassungsgericht auf, seine Entscheidung zu überdenken. Die in der annullierten Wahl zweitplatzierte Elena Lasconi sieht in der Stellungnahme eine Bestätigung, dass das rumänische Verfassungsgericht „eine missbräuchliche Entscheidung getroffen hat“.
Der als Außenseiter geltende Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu hatte Ende November die erste Runde der rumänischen Präsidentschaftswahl gewonnen. Das Verfassungsgericht bestätigte nach einer Neuauszählung der Stimmen am 2. Dezember zunächst seinen Sieg. Die entscheidende Stichwahl zwischen ihm und der zweitplatzierten Kandidatin Elena Lasconi sollte planmäßig am 8. Dezember stattfinden. Am 6. Dezember erklärte das Gericht jedoch auf Basis bis dahin geheim gehaltener Informationen und offenbar ohne Anhörung der Kandidaten die erste Runde der Wahl als nichtig und ordnete Neuwahlen an. In dem zugehörigen Geheimdienstbericht, der seit dem 6. Dezember mit geschwärzten Passagen öffentlich zugänglich ist, wurde eine gezielte breite Wahlkampagne über soziale Medien für Georgescu festgestellt sowie angedeutet, das deren Finanzierung aus Russland erfolgte. Das rumänische Investigativ-Magazin „Snoop“ hatte anschließend jedoch recherchiert, dass die skandalisierten TikTok-Kampagnen von der Nationalliberalen Partei des amtierenden Präsidenten Klaus Johannis mit öffentlichen Geldern finanziert worden waren.