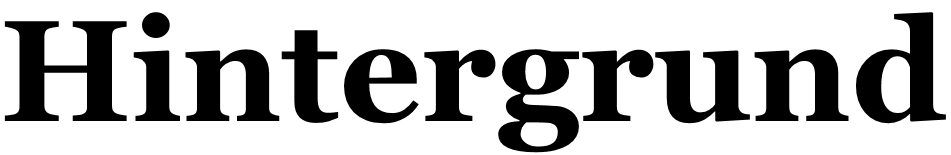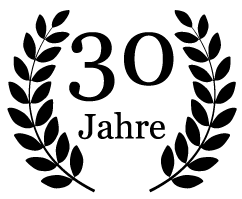Interview: Lothar Wieler „traute sich nicht immer“ der Regierung zu widersprechen
Laut früherem Leiter muss das Robert Koch-Institut politisch unabhängiger werden / Wieler: Die meisten Corona-Maßnahmen waren richtig / „Pandemie der Ungeimpften“ nur ein verzeihlicher „Spruch“
(Diese Meldung ist eine Übernahme von multipolar.)
Der ehemalige Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler hat erstmals öffentlich eingeräumt, sich während der Corona-Krise der Politik untergeordnet zu haben. In einem Interview auf der Plattform „Table.Media“ antwortete Wieler auf die Frage, ob er sich „nicht immer getraut“ habe, „öffentlich das zu sagen zur Politik, was Sie gerne sagen würden“, antwortete Wieler: „Das ist korrekt, ja“. Zugleich verteidigte er sowohl die Arbeitsweise und die Empfehlungen des RKI als auch in weiten Teilen die von der Politik durchgesetzten Maßnahmen. Allerdings müsste die öffentliche Kommunikation verbessert werden. Wieler sagte außerdem, das RKI habe sich zwar nicht intensiv mit dem Virusursprung befasst, er persönlich halte aber „nach dem jetzigen Kenntnisstand“ den Laborursprung des Virus für die „wahrscheinlichere“ These.
Um dem RKI eine größere Unabhängigkeit zu verschaffen, schlug Wieler vor, das Institut in eine Anstalt öffentlichen Rechts umzuwandeln, analog zum Bundesinstitut für Risikobewertung. Gleichzeitig betonte er, im RKI habe eine „offene Kultur“ geherrscht, man habe um die „beste Lösung“ und das „bessere Argument“ gerungen und es sei „auch gestritten worden“. Die RKI-Protokolle, die „irgendwann freigegeben wurden“, belegten dies. Den Rechtsstreit mit Multipolar um die Herausgabe der Dokumente ließ er unerwähnt, ebenso das spätere Leak. Zudem sei den Protokollen zu entnehmen, dass das RKI um eine angemessene Kommunikation und eine sachliche Einordnung der Bedrohungslage bemüht gewesen sei. „Für uns war immer wichtig, dass man sachliche Argumente findet für Maßnahmen, die wir selber dann schriftlich als Ratgeber herausgegeben haben“, sagte Wieler. Er sei überzeugt davon, dass das RKI „sehr transparent“ gearbeitet habe, alle Daten seien online gegangen.
Wieler erwähnte auch die COSMO-Befragungen, die von der Professorin für Gesundheitskommunikation und Nudging-Expertin Cornelia Betsch durchgeführt wurden, um die Stimmung in der Bevölkerung zu erfassen. Die Ergebnisse hätten „natürlich“ einen Einfluss auf die öffentlichen Aussagen des RKI gehabt. Mit diesem Wissen habe man sicherstellen können, „dass unsere Kommunikation auch wirklich trifft“. Bereits im Juli 2020 hatte Wieler Betschs Studie als wichtigen Parameter bezeichnet, „um immer die entsprechenden Messages anzupassen“. Im Gespräch mit „Table.Media“ wurde deutlich, dass das für Wieler nicht im Widerspruch zu einer sachlichen Aufklärung der Bevölkerung steht.
Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit habe er als „eine Pflicht“ erachtet, die ihm „keine Freude bereitet“ habe, die er aber „nach bestem Wissen und Gewissen“ versucht habe zu erfüllen. Wieler betont, er sei „kein Medienprofi gewesen“ vor der Corona-Krise. Im Nachhinein würde er insgesamt die „Öffentlichkeitsarbeit intensivieren“ und „jeden Tag ins Radio“ gehen. Zudem würde er „definitiv mehr Hintergrundgespräche“ mit Journalisten führen, um die Strategie der Pandemiebekämpfung zu erklären. Er würde „mehr Einblicke in die Arbeitsweise“ des RKI gewähren und Journalisten „mal an Sitzungen teilhaben“ lassen. Diese Überlegungen seien auch der „betrüblichen Erkenntnis“ geschuldet, dass andernfalls „irgendwie unterstellt“ werde, „man würde etwas verheimlichen“. Das Vertrauen in das RKI habe gelitten. Er finde es „schade“, dass man einer Institution wie dem RKI „nicht einfach mal Vertrauen entgegenbringt“ und ihr glaube, „bevor man kleinste Dinge kritisiert“.
Auf die Beschimpfungen und Attacken auf Ungeimpfte angesprochen, antwortete Wieler nicht direkt. Stattdessen verwies er darauf, dass „am Anfang ein wahnsinniger Run auf diese Impfungen“ zu beobachten gewesen sei. In dieser „Hysterie“ sei die Impfung auch „überhöht“ worden. Die Rede von der „Pandemie der Ungeimpften“ sei zwar „sachlich einfach nicht richtig“, man sollte aber „nicht jede Begrifflichkeit auf die Goldwaage legen“. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sei „zwei Jahre lang jeden Tag in der Presse“ gewesen – man könne ihm „auch mal einen Spruch verzeihen, der vielleicht nicht gerade perfekt war“.
Wieler betonte, er kenne keinen einzigen Politiker, der die Freiheit habe einschränken wollen: „Niemand hat das mit Freude gemacht“. Die Abwägung zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und gesundheitlichen Aspekten sei für die Politik schwierig gewesen. Gerade bei drastischen Maßnahmen wie einer Ausgangssperre müssten die Gründe offen und ehrlich erklärt werden. Zugleich betonte Wieler: „Wenn es dann im Nachhinein die falsche Überlegung war, das passiert halt in so einer Krise. Das ist okay.“ Dass die Maske für viele Menschen ein „Symbol der Unfreiheit“ sei, könne er nicht nachvollziehen. Das Masketragen sei ein „extrem geringer Eingriff“ in die persönliche Freiheit. Wieler begrüßte es, dass einige Menschen bis heute freiwillig eine Maske tragen. Es sei eine „Lehre“, dass man im Krankheitsfall „zumindest die Möglichkeit reduziert, andere anzustecken“. Sollte in einer künftigen Pandemie der Erreger über die Atemwege übertragen werden, seien „Masken selbstverständlich ein sehr probates Mittel, um die Ausbreitung zu reduzieren“.
Wieler sagte, es sei die „richtige Strategie“ gewesen, zu versuchen, „die Virusausbreitung so stark einzuschränken, dass das Krankensystem nicht überlastet“ werde und möglichst wenig Menschen schwer krank werden oder sterben. Dass die im Vergleich zu Deutschland deutlich liberalere Krisenbewältigung in Schweden bessere Ergebnisse zeitigte, wollte Wieler nicht gelten lassen. Die beiden Länder könne man wegen ihrer Unterschiede hinsichtlich Altersstruktur, Digitalisierungsgrad, Bevölkerungsdichte und Außengrenzen „nicht unbedingt miteinander vergleichen“. Dennoch glaube er, man könne auch hierzulande den Menschen ein „bisschen mehr Eigenverantwortung zumuten“. Allerdings gebe es Bevölkerungsschichten, die in prekären und beengten Verhältnissen leben würden und „die nicht auf sich selber aufpassen können“, weil sie die Möglichkeiten dazu gar nicht hätten. „Das heißt, wir müssen diese Gruppierungen natürlich mit schützen“, sagte Wieler – wie genau, ließ er offen.
Wieler verwies auch auf die Analyse eines möglichen Pandemieszenarios, das das RKI im Jahr 2012 im Auftrag des Bundesinnenministeriums erarbeitet hat. Ebenso erwähnte er den Nationalen Pandemieplan, der zuletzt 2016 und 2017 überarbeitet wurde. Dass in diesen Dokumenten weder von Ausgangssperren noch von Lockdowns die Rede ist, kam nicht zur Sprache. Wieler sagte, der Pandemieplan sei „ausgezeichnet“. Gleichzeitig räumte er ein, dass die einflussreiche Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) laut Pandemieplan „nicht vorgesehen“ gewesen sei und diesen „quasi ausgehebelt“ habe. Er halte die MPK dennoch für die „richtige Ebene“, man müsste aber sicherstellen, dass sie über eine „einheitliche Informationsstruktur“ verfüge. Alle Entscheider müssten „dieselben Informationen haben“. Während der Coronakrise hätten die Ministerpräsidenten hingegen eigene Beratergruppen zu Rate gezogen, deren „Spielregeln“ und „Auswahlkriterien“ ihm zumindest „nicht bekannt“ gewesen seien.