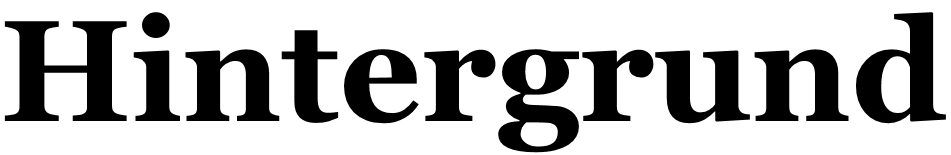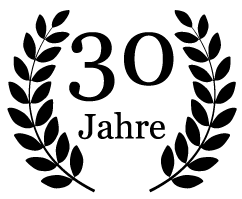Deutsche Presseagentur wehrt sich gegen Vorwurf staatlicher Einflussnahme
Journalist kritisiert dpa-Angaben zur Finanzierung durch Bundesregierung / Kommunikationswissenschaftler: staatliche Gelder für dpa-Faktenchecker „mindern Glaubwürdigkeit“ / Bundesbeauftragte für Kultur und Medien: „Unabhängigkeit der Presse gewährleistet“
(Diese Meldung ist eine Übernahme von multipolar.)
Der Journalist Norbert Häring wirft der „Deutschen Presse-Agentur“ (dpa) in mehreren Texten vor, die Öffentlichkeit nicht korrekt über ihre Finanzierung zu informieren. Die dpa habe wiederholt erklärt, keine staatlichen Zuwendungen zu erhalten. Das sei eine „Falschbehauptung“. Häring kritisiert insbesondere die Finanzierung und inhaltliche Ausrichtung der Faktenchecks. Diese würden im Zusammenhang mit der europäischen Gesetzgebung Zensur Vorschub leisten. Die dpa versucht die Vorwürfe in einer aktuellen Stellungnahme zu entkräften.
Darin heißt es, die dpa sei weder „regierungsfinanziert“ noch „staatsfinanziert“. Die Agentur lehne „finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen“ ab. „Lediglich projektgebundene Förderungen“ nehme man „in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nur nach sorgfältiger Prüfung an.“ Häring hält die bemühte Trennung zwischen „Zuwendung“ und „projektgebundener Förderung“ für unsinnig, selbst der Bundestag definiere beides als gleichbedeutend. Bereits in einer früheren Recherche hatte Häring die dpa für ihre Ausführungen zur Finanzierung kritisiert. So gab die Agentur gegenüber der Faktenchecker-Zertifizierungsstelle „International Fact Checking Network“ an, „keine Finanzierung oder Unterstützung von Staat, Politikern oder Parteien zu erhalten“. Auch auf der Homepage versichern die dpa-Faktenchecker der Öffentlichkeit, dass sie „keine staatlichen Subventionen oder sonstige finanziellen Zuwendungen“ erhalten würden. „Sämtliche Einnahmen werden auf dem freien Markt erwirtschaftet“, heißt es dort. Laut Häring ist das „nachweislich gelogen“.
Ihrer aktuellen Stellungnahme fügt die dpa eine Liste „projektgebundener Förderungen in der dpa-Gruppe“ bei. Zu den Geldgebern in der Liste gehören die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Bundesministerium des Innern (BMI) sowie die Bundeszentrale für politische Bildung. Das mit rund einer Million Euro vom BMI geförderte Anti-Desinformations-Großprojekt der dpa „Jahr der Nachricht“ bezeichnete dpa-Geschäftsführer Stefan Kropsch 2024 gegenüber dem Branchenmagazin „Medium“ als „Public-Private-Partnership, die für jeden einsichtig und transparent“ sei. Wie „Medium“ festhielt, wurde der Auftrag an die dpa jedoch ohne Ausschreibung vergeben. Angesprochen auf den zuweilen undurchsichtigen Umfang staatlicher Förderung hielt Kropsch fest: „Bei uns gilt das Prinzip, dass wir über Kundenbeziehungen nicht reden“.
In der aktuellen Stellungnahme schreibt die dpa, die „projektgebundene Förderung“ habe von 2021 bis Ende 2024 rund 2,3 Millionen Euro betragen – bei einem Umsatz der dpa-Gruppe in Höhe von rund 650 Millionen. Die dpa betont, der Anteil der Förderungen betrage damit nur 0,35 Prozent am Geschäftsvolumen. Diese Rechnung hält Häring für irreführend. Gemessen am Umsatz der gesamten dpa-Gruppe möge die Förderung klein sein, sie mache aber „mutmaßlich einen sehr großen Anteil des Budgets der Faktenchecker aus“, schreibt Häring. Zudem kritisiert er, dass die dpa in ihrer Stellungnahme die EU-Zahlungen „in unbekannter Höhe“ für die Faktencheck-Vereinigung German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) gänzlich unerwähnt lässt. An dieser Vereinigung seien „die dpa-Faktenchecker maßgeblich“ beteiligt. Das Volumen der öffentlichen Zuwendungen sei mit 2,3 Millionen somit zu niedrig angegeben.
Eine weitere Irreführung sieht Häring in der Erklärung der dpa, ihre Faktenchecks fungierten lediglich als Dienstleistungsangebot gegenüber den Betreibern von Internetplattformen. In ihrer Stellungnahme betont die dpa, Faktenchecken habe „nichts mit Zensur zu tun.“ Die dpa kooperiere lediglich mit mehreren sozialen Netzwerken, dazu gehöre auch das „Monitoring, also das Identifizieren und Prüfen möglicher Falschbehauptungen, ebenso wie das Abgeben von Bewertungen“. Ziel sei es, Falschbehauptungen transparent mit Fakten zu kontern. Häring hingegen wirft Faktencheckern vor, einseitig und unseriös zu arbeiten. Sie würden „bevorzugt“ jene Nachrichten prüfen und „diskreditieren“, „die ein Narrativ der Regierenden konterkarieren“.
Die dpa wiederum betont ihre Unabhängigkeit – auch gegenüber den Plattformen. Diese hätten „keinerlei Einfluss auf die Themenauswahl und Inhalte“ der Faktenchecks. Wie sie mit den Ergebnissen der Prüfungen verfahren würden (Labeln, Drosseln oder Löschen der Inhalte), würden die Plattformen selbst entscheiden. Tatsächlich drohen den Betreibern allerdings gemäß den Bestimmungen des europäischen „Digital Service Acts“ empfindliche Strafen, wo sie nicht den Empfehlungen der betreffenden Organisationen Folge leisten oder andere Mechanismen zur Faktenprüfung etablieren. Häring weist darauf hin, dass die dpa „wichtiger Teil“ der Beobachtungsstelle „European Digital Media Observatory“ (EDMO) sei. Diese werde von der EU bezahlt und habe den Auftrag, zu bewerten, wie gut die Plattformen der Verpflichtung zur Moderation von Inhalten nachkämen. Häring hält im Kontext dieser „Inhaltemoderation“ am Vorwurf der Zensur fest.
Michael Haller, wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung (EIJK) in Leipzig, bezeichnet auf Nachfrage von Multipolar die „nachrichtliche Tagesarbeit“ der dpa als „unabhängig, soweit sie durch die Medienverlage als deren Abnehmer finanziert wird“. Im Falle des „staatlich geförderten Projekts Faktenchecking“ sieht Haller allerdings ein mögliches Problem der „Befangenheit“. Er sagt: „Die Tatsache, dass die dpa-Faktenchecker staatliche Fördermittel bekommen, weckt im Publikum Misstrauen und mindert die Glaubwürdigkeit der dpa – auch dann, wenn sich die Faktenchecker selbst für unabhängig halten.“ In diesem Zusammenhang führe der kürzlich von der SPD geäußerte Vorschlag, „zuverlässige“ Medien zu unterstützen, für Haller „in die Irre“, da es keine objektiven Kriterien für das Merkmal „zuverlässig“ gebe und gegenüber der Politik Abhängigkeiten geschaffen würden.
Ein Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien hält auf Nachfrage von Multipolar fest, dass Projektförderungen „lediglich die Strukturen von journalistischer Arbeit“ beträfen. Eine „Förderung von investigativen Recherchen, Faktenchecks oder der redaktionellen Arbeit“ finde demnach nicht statt. Im Übrigen müssten Empfänger durch den sogenannten Verwendungsnachweis belegen, dass die Fördermittel allein zur Durchführung des entsprechenden Projekts verwendet worden seien. Eine Quersubventionierung journalistischer Inhalte sei „somit ausgeschlossen“ und die „Unabhängigkeit der Presse“ sowie ein fairer publizistischer Wettbewerb „gewährleistet“.