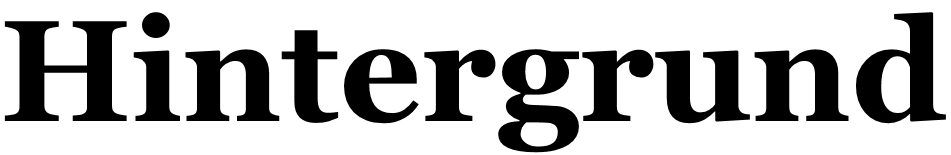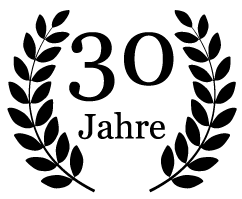Bayern startet Kampagne für digitalen Identitätsnachweis
Elektonischer Ausweis als Voraussetzung für Einführung der „Europäischen Digitalen Identität“ / Kritiker fürchten schleichenden Aufbau eines digitalen Überwachungsstaats / Zugang zu sozialen Medien teilweise bereits von digitaler Identitätsprüfung abhängig
(Diese Meldung ist eine Übernahme von Multipolar)
Nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung soll der elektronische Identitätsnachweis (eID) so selbstverständlich genutzt weden wie eine EC-Karte. Das ist Ziel der am 4. April vorgestellten Initiative „eID-Turbo Bayern“. Kritiker werten den Vorstoß zur massiven Ausweitung der eID-Nutzung als Paradebeispiel für den schleichenden Aufbau eines digitalen Überwachungsstaats.
Laut dem bayerischen Innenministerium werden von den aktuell rund 70 Millionen Ausweisdokumenten mit eID-Funktion nur 22 Prozent für online angebotene Verwaltungsleistungen genutzt. „Viele Bürgerinnen und Bürger schrecken noch vor der Nutzung zurück oder haben ihre persönliche PIN nicht gesetzt oder vergessen“, heißt es in der Pressemitteilung zur Vorstellung des „eID-Turbo“. Dabei sei die eID eine „wichtige Voraussetzung“ für die Einführung der „Europäischen Digitalen Identität“ (EUDI-Brieftasche), durch die sich Europas Bürger ab 2027 digital ausweisen sollen. „Wir wollen mit einfachen Unterstützungsangeboten vor Ort das volle Potential der eID ausschöpfen“, wird Innenstaatssekretär Sandro Kirchner zitiert. Die Initiative sieht mobile Werbeteams für die eID-Nutzung in Kommunen, Einkaufszentren, auf Messen oder in Universitäten vor.
Kritiker warnen seit einiger Zeit vor den Gefahren des digitalen Identitätsnachweises. Der Wirtschaftsjournalist Norbert Haering verwies etwa im November 2023 darauf, dass Hacker die Identitätsdaten zahlreicher Inder zum Kauf angeboten hatten. Anfang Januar diesen Jahres berichtete er, dass die Schweizer Regierung die digitale Identität gegen den Willen der Bürger durchdrücken wolle. Er erinnerte daran, dass die Schweizer 2021 das „Gesetz über digitale Identifizierungsdienste” mit Zweidrittelmehrheit gekippt hatten. Ende 2024 hätten Stände- und Nationalrat erneut „eine ganz ähnliche Version beschlossen“. Auch Multipolar hatte bereits über die Gefahren der digitalen Identifizierung berichtet: Die EUDI-Brieftasche könnte die Basis für Konzepte wie „Social Credit Scores“ oder CO2-Budgets bilden. Per Mausklick könnten Strafen bei Gesetzesüberschreitungen verhängt werden. Denkbar sei die Deaktivierung von Zugtickets, Hotelbuchungen oder des digitalen Führerscheins.
Im Nachbarland Österreich sieht man den Vorstoß Bayerns ebenfalls kritisch. Joachim Aigner, Landessprecher der österreichischen Partei „Menschen, Freiheit, Grundrechte“ (MFG) sagt auf Anfrage von Multipolar: „Unter dem Deckmantel einer Serviceoffensive wird ein System etabliert, das die staatliche Kontrolle über die Bürger drastisch ausweitet.“ Mit der eID werde die Grundlage für eine digitale Totalerfassung geschaffen: „Zentral verknüpft, manipulierbar und jederzeit auslesbar.“ Das Ziel, bis 2027 eine europaweite „EUDI-Brieftasche“ einzuführen, sei ein massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. „Wer glaubt, dass eine zentral verwaltete digitale Identität nicht früher oder später für Social Scoring, Zugangskontrollen oder politische Disziplinierung missbraucht werden könnte, verkennt die Gefahren dieser Technologie”, erklärt Aigner. Die in Bayern geplanten mobilen Teams zur PIN-Setzung sind in seinen Augen „Nudging“. Damit werde psychologischer Druck ausgeübt. Die Bürger sollten sich dadurch freiwillig einem System untwerfen, „das immer weniger mit Freiheit, aber sehr viel mit Kontrolle zu tun hat“.
In Deutschland wurde der elektronische Personalausweis am 1. November 2010 eingeführt. Bis 2017 war für das Online-Ausweisen ein Kartenlesegerät nötig. Seither reicht ein Smartphone. Die Anwendungsmöglichkeiten nahmen sei 2010 rasant zu, da immer mehr Behördenleistungen online genutzt werden können. „Daran arbeiten Bund und Länder gemeinsam auf Basis des Onlinezugangsgesetzes“, hieß es in einer Pressemitteilung zum zehnjährigen Bestehen des elektronischen Personalausweises. Im Juni 2023 machte Brüssel den Weg frei für den elektronischen Handy-Ausweis. Einer damals durchgeführten Umfrage im Auftrag des Digitalverbands „Bitkom“ zufolge würden 58 Prozent der Befragten Personalausweis, Führerschein, Gesundheitskarte oder Zeugnisse gern auf ihrem Smartphone speichern. Zwei Drittel der befragten Smartphone-Nutzer würden gerne alle Dokumente in einer digitalen Brieftasche ablegen können. 16 Prozent gaben an, das Angebot, Dokumente wie den Personalausweis auf dem Smartphone zu speichern, eher nicht nutzen zu wollen. 23 Prozent wollten dies auf keinen Fall.
Innenstaatssekretär Johann Saathoff (SPD) erklärte am 22. März im Bundesrat in einer Rede zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes: „Wir schaffen die Schriftform ab. Keine händischen Unterschriften mehr, alles digital!“ In Belgien gibt es seit 2003 elektronische Ausweise. Bisher waren diese freiwillig. Mitte März berichtete die belgische Zeitung „HLN“, dass Digitalministerin Vanessa Matz den Zugang zu sozialen Medien von einer Identitätsprüfung abhängig machen wolle. Auch andere europäische Länder erwägen derzeit, eine digitale Identifizierung für die Nutzung sozialer Medien verpflichtend zu machen, berichtete das Online-Medium „TKP“. Im Februar habe der französische Justizminister Gérald Darmanin angekündigt, dass er ein solches System für Internetnutzer prüfen werde.
Wie aus den Papieren der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD hevorgeht, soll in der kommenden Legislaturperiode eine zwischen den Ländern kompatible, mit der Bürger-ID verknüpfte Schüler-lD eingeführt werden. Im Jahr 2006 hatte die Kultusministerkonferenz den „Big Brother Award“ für das Vorhaben erhalten, lebenslange Schüler-IDs zu installieren.