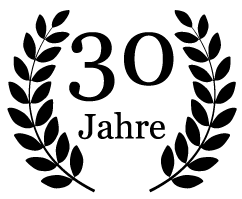„Radio ist unsere stärkste Waffe“
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Über Propaganda im Krieg, Stress und Depressionen nach dem Einsatz –
Interview mit DANIEL LÜCKING, 11. Dezember 2014 –
Daniel Lücking ist Reservist der Bundeswehr. Er war als Presseoffizier auf dem Balkan und in Afghanistan im Einsatz. Aus anfänglicher Überzeugung wurden Zweifel und schließlich ein Verzweifeln an der Situation und den Aufgaben. Heute arbeitet Lücking seinen Einsatz auf und die Folgen für ihn und seine Familie: PTBS – Post-traumatisches Belastungssyndrom. Das Interview führte Sabine Schiffer.
Sie waren Soldat in Afghanistan. Wie kamen Sie dazu?
Es war Teil meines damaligen Berufes als Offizier. Ich trat 1998 als Wehrpflichtiger in die Bundeswehr ein, entschied mich nach sechs Monaten zunächst für die Laufbahn im einfachen Dienst und wechselte 2002 in die Offizierlaufbahn.
Ich hatte zuvor von November 2000 bis Mai 2001 einen Auslandseinsatz in Mazedonien und im Kosovo erlebt und empfand es – aus meiner damaligen Position – als sehr sinnvolles Engagement. Zwei verfeindete Parteien, die sich das Messer an die Kehle setzen. Die Bundeswehr tritt dazwischen und hält die beiden Parteien unter Kontrolle – das sah einfach sinnvoll aus. Doch die Einblicke in andere politische und rechtliche Ebenen hatte ich damals nicht. Heute würde ich vieles sicher deutlich anders wahrnehmen.
Welche Einblicke hatten Sie damals noch nicht?
Heute ist mir bewusst, dass die politischen Dimensionen dieser Einsätze auf der untersten Ebene der militärischen Hierarchie nicht oder kaum wahrgenommen werden können. Wie viel fehlgeschlagene Politik hat letztlich zur Intervention geführt? Wie viele Lügen waren notwendig, um das Eingreifen in den Konflikt zu ermöglichen? Was hat es langfristig wirklich genutzt? Diese Liste an Fragen ist für Afghanistan noch viel länger, als für den Kosovo.
Was genau waren Ihre Aufgaben in Afghanistan?
Mein Flugzeug startete im November 2005 nach Kunduz in Afghanistan. Meine Aufgabe dort war es, einen lokalen Radiosender zu leiten. Die afghanischen Redakteure sendeten mit Material und Budget von Bundeswehr und NATO ein tägliches Radioprogramm in den Sprachen Dari und Pashtu – den häufigsten Sprachen im Norden Afghanistans. Meine Aufgabe bestand in der Leitung des Senders. Das schloss betriebswirtschaftliche wie auch programmliche Aspekte mit ein.
Ein Netz aus Korrespondenten berichtete aus den Nord-Provinzen Afghanistans. Zusätzlich haben wir Programminhalte auf CDs an kleinere lokale Radiosender verteilt. Wir gingen damals von rund 900.000 potentiellen Hörern aus. Die NATO hat mittels eines satellitengestützten Systems versucht, die gesamte Region mit UKW-Radio zu versorgen.
Ich hatte täglich die Umsetzung der Themenlinien Wiederaufbau der Infrastruktur und der politischen Strukturen, wie das Einsammeln der Waffen von Taliban und die aktuelle Berichterstattung zu kontrollieren. Hin und wieder wurden Kontrollübersetzungen in Deutschland angefertigt – Gründe zur Beanstandung gab es nicht.
Kritik an Korruption und Vetternwirtschaft – die wahren Probleme im Land – durften wir leider nicht üben. Das sei Aufgabe der afghanischen Regierung, hieß es bei der Festlegung der Themen. Wir blieben soweit wie möglich objektiv. Wir lobten zum Beispiel nicht zu sehr, wenn ein bekannter, stark bewaffneter Warlord mal wieder eine Waffenübergabe inszenierte, um seinen Schrott loszuwerden.
Mich erinnert die mediale Erschließung stark an das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Westdeutschland nach dem Krieg, der zunächst auch wesentlich von den Alliierten mitgestaltet und beobachtet wurde und ganz bestimmte Zwecke erfüllen sollte, Mit dieser Aufgabe konnte ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt gut identifizieren.
Haben sich die Programme in einem vergleichbaren Maße bei der Bevölkerung durchgesetzt?
Ich denke nicht – aber mein Stand der Beurteilung ist von 2008. Wie das die Afghanen heute empfinden, weiß ich nicht.
Wie lange waren Sie in Afghanistan?
Zwischen 2005 und 2008 habe ich insgesamt elf Monate in Afghanistan als Leiter dieses Radiosenders verbracht. In allen drei Einsätzen war ich als Chef vom Dienst für das Programm und die Inhalte verantwortlich. Im ersten Afghanistaneinsatz zusätzlich in Personalunion Chef vom Dienst und organisatorischer Leiter des Radiobetriebs. Wir hatten damals regelmäßig zwölf bis 16 Stunden lange Arbeitstage, aber auch die entsprechende Motivation.
Was waren Ihre eindrücklichsten Erlebnisse?
Prägend war vor allem die Zeit im ersten Einsatz. Ich erlebte vor Ort, wie die Stimmung von friedlich auf offenkundig ablehnend kippte, als die dänischen Islamkarikaturen veröffentlicht wurden. Für meinen Job als leitender Radioredakteur hatte ich damals nur rund sechs Wochen Ausbildung in Deutschland und drei Wochen „Training on the Job“ vor Ort erhalten. Vorgesehen war rund ein Jahr an Ausbildungsmaßnahmen.
Waren Sie mit der Aufgabe überfordert?
Ich habe erst im Nachhinein begriffen, was diese Situation und die damit verbundenen Aufgaben für Auswirkungen auf mich hatten. Als sich die Stimmung im Rahmen des Karikaturenstreits verschlechterte, gab mir mein kommandierender General eine klare Anweisung: „Radio ist unsere stärkste Waffe.“ Dieser Satz hallt bis heute in mir nach. Die Aufforderung war klar: Machen Sie die Programme so, dass keine Soldaten sterben! Ich bekam sozusagen die Verantwortung für geschädigte Soldaten übertragen. Diese Prägung muss damals stattgefunden haben und sie hat einen wahnsinnigen Stress ausgelöst. Wie konditioniert war ich auch nach dem Einsatz noch. Jedes Mal, wenn Todesmeldungen von Kameraden kamen, empfand ich Versagen und Verantwortung, wurde depressiv ohne wirklicjh zu verstehen, warum. Aus heutiger Sicht würde ich klar sagen, die Forderung war eine Überforderung. Aber damals habe ich das noch nicht begriffen.
Wann und wie haben Sie es begriffen?
Es gab ein Schlüsselerlebnis im Mai 2011, als drei Vorfälle berichtet wurden, die für mich einen persönlichen Bezug hatten. So kam unter anderem unsere Übersetzerin Soraya Alekozai fast ums Leben. Traumatisierte Soldaten beschreiben immer wieder bildreiche Flashbacks. Ich kann nicht behaupten, dass ich konkrete Bilder sehen oder Gerüche wahrnehmen würde. Doch der Stress und die Anspannung sind wieder da. 2011 bedeutete das sechs Wochen Depressionen. Meine bis dahin funktionierenden Methoden zum Stressabbau durch Sport griffen längst nicht mehr. Durch exzessiven Sport konnte ich zumindest vor Erschöpfung schlafen und die Gedanken stoppen. Im April 2013 nach einer erneuten depressiven Phase ging ich endlich zum Arzt. Da ich im Studium steckte wollte ich keine Auszeiten nehmen – ich habe schließlich eine Familie zu versorgen, aber bisher keinen anerkannten, zivilberuflich verwertbaren Abschluss.
Was war das Ergebnis und welche Folgen hatte das für Sie?
Die offizielle Diagnose lautet heute Anpassungsstörung. Tests haben mittlerweile die Depressionen als einsatzbedingt belegt und Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung waren im April 2013 ebenfalls messbar. Mein Hausarzt riet mir, mich auf jeden Fall auf eine Traumatisierung hin behandeln zu lassen.
Auf die Idee, dass meine zunehmenden Kooperationsschwierigkeiten mit Menschen einen Grund außerhalb meiner persönlichen Unzulänglichkeiten hätten, war ich bis dato garnicht gekommen. Zivil ausgedrückt ähnelt all das einer Überlastung, die auch als „Burnout“ bekannt ist. Ich entgegne mittlerweile recht lapidar „Ich habe eine stressbedingte Erkrankung.“ Das klingt deutlich anders, als wenn Worte, wie „Störung“ oder „psychisch“ sofort die falschen Schubladen in den Köpfen der Menschen öffnen.
Die Folgen der Einsätze wurden erst Jahre später spürbar. Sie resultieren – aber das habe ich erst in den letzten 18 Monaten langsam verstanden – aus einem Mix aus zu wenig Ausbildung, mangelnder Erfahrung und gleichzeitig hohen Anforderungen im Rahmen der Krisen-PR, die rund um die Islamkarikaturen notwendig war.
Zwischen den Einsätzen habe ich nicht erkennen können, was diese Ausnahmesituation in mir bewirkt hat. Mein Blick war stets auf den nächsten Einsatz gerichtet. Zwischen 2006 und 2008 lehnte ich insgesamt zwei weitere Einsatzzeiträume ab, um bei meiner Familie sein zu können.
Diese Überlastung widerspricht auch heute noch den Grundsätzen, nach denen die Bundeswehr ihre Soldaten in die Einsätze entsenden will. Zuletzt hörte ich Ende 2013 von Frau von der Leyen, der Einsatzrythmus würde „4 Monate Einsatz – 20 Monate Inlandsdienst“ betragen. Trotz der Ablehnung von zwei Einsätzen kamen in meinem Fall 11 Monate im Zeitraum von 33 Monaten zusammen.
Im Vergleich zu anderen Tätigkeiten erscheint das auf den ersten Blick nicht so viel.
Aus heutiger Sicht erscheint mir die Arbeitszeit auch nicht das primäre Problem, sondern der psychische Druck durch den Auftrag, durch eine bestimmte Sendequalität Anschläge bzw. Opfer zu verhindern. Diese Verknüpfung habe ich zunächst weder erkennen, noch auflösen können.
Erst nach der Einsatzzeit wirkten sich die Depressionen aus. Sehr deutlich spürbar ist das immer, wenn in Afghanistan Soldaten starben. 2011 wurde es so schlimm, dass ich tägliche Gepäckläufe mit 15 Kilogramm im Rucksack brauchte, damit ich nach 10 bis 15 Kilometern in der Abendhitze den Kopf halbwegs frei bekam, um schlafen zu können. 2013 verstand ich, dass aufgrund der PTBS-Aspekte die Erinnerungen an den ersten Einsatz in Afghanistan zurückkamen.
Ich vergleiche die PTBS-Reaktionen heute mit dem Ur-Reflex, den wir alle in Bezug auf Feuer kennen. Wir müssen es nicht sehen, müssen die Hitze nicht spüren – nur die kurze Wahrnehmung des Geruches reicht aus, um uns zu alarmieren. In meinem Fall war es kein Feuer, das die Alarmreflexe auslöste. Es waren Soldaten gestorben und ich fühlte mich verantwortlich.
Seit ich in der Lage bin, das rational zu durchdringen, komme ich besser damit klar. Vorher trieb es mich in Depressionen, Antriebslosigkeit und Traurigkeit. In vielen anderen Situationen, die eine Existenzgefährdung mit sich bringen reagiere ich bis heute mit deutlich erhöhtem Stresspegel. Dann braucht es Kraft, Aufmerksamkeit und Energie, um die Effekte zu bewältigen.
Alles in allem denke ich, „verheizt“ umschreibt all das recht gut – und das ist vielen Soldaten im Rahmen des undurchdachten, überhasteten Afghanistanengagements so passiert.
Waren Sie überzeugt von dem Einsatz?
Zunächst ja. Kurz nach meiner Ankunft im November 2005 konnten wir als Unterhaltungsanteil im Radio noch eine mehrstündige Live-Berichterstattung vom Fußballplatz in der Innenstadt von Kunduz senden. Wir liefen teilweise ohne Schutzwesten durch die Menschenmengen. Ich kaufte beim afghanischen Fast-Food-Händler eine Suppe, schaute das Spiel an und hätte mir nicht vorstellen können, dass das wohl eine der letzten Gelegenheiten für einen Soldaten gewesen ist, sich derartig frei dort zu bewegen.
Nachdem dann im Januar 2006 die zweite Veröffentlichung der Islamkarikaturen ihren Lauf durch die muslimische Welt genommen hatte, war gegen Ende meines Einsatzes an solch eine friedliche Fußballplatzatmosphäre nicht mehr zu denken. Kurze Zeit nach den Veröffentlichungen gab es den ersten Anschlag in der Innenstadt von Kunduz auf ein deutsches Fahrzeug, den einer der Soldaten nur knapp überlebte. Es kam zu mehreren Toten und zahlreichen Verletzten in der afghanischen Bevölkerung. Danach hatten wir ständige Warnungen vor neuen Anschlägen und Handgranaten, die über die Mauer des Innenstadtlagers geworfen werden könnten.
Wie hat sich das auf die tägliche Arbeit und dann wiederum auf ihre Wirkung in der Öffentlichkeit ausgewirkt?
In den beiden späteren Einsätzen in Masar-e-Sharif war das dortige Camp so weit ab vom Schuss, dass Kontakte zur Zivilbevölkerung nur noch wenigen Soldaten möglich waren. Das – so denke ich – ist das Kernproblem. Wir haben uns an einem gewissen Punkt zu sehr von der Zivilgesellschaft abgekoppelt und wurden noch mehr zum Fremdkörper im Land. Ich denke, ich habe 2006 den Wendepunkt erlebt, nachdem die zunehmende Eskalation den Rückhalt in der Zivilbevölkerung Stück für Stück aufgefressen hat.
Hätte es eine andere Strategie geben müssen? Sind vonseiten der Bundeswehr falsche Entscheidungen getroffen worden?
2014 lernte ich den dänischen Whistleblower Anders Kaergaard kennen. Er beschrieb eine Doppelstrategie des dänischen Militärs in enger Verzahnung mit dem Geheimdienst. Versäumnisse vor Ort – in seinem Fall Irak – wurden in der dänischen Presse gezielt geschönt und verdreht dargestellt. Ganze Informationskampagnen wurden durchgeführt und – so beschreibt es Kaergaard – es wurde gezielt falsch informiert.
Ich denke, in Deutschland lief das etwas eleganter. Es wurden schlichtweg Informationen weggelassen oder nicht tiefer diskutiert. Ich stand 2006 ziemlich ratlos vor den Islamkarikaturen. Es gab keine offizielle Haltung der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums. Keine Sprachregelungen, keine Positionen – nichts. Meine Vorgesetzten sagten „Das müssen wir vor Ort regeln.“
Keine Meinung zu diesen Themen zu haben ist mindestens genau so falsch, wie die Schmähungen zu unterstützen. Das habe ich vor Ort sehr deutlich gespürt. Menschen, die außer ihrer Religion in ihrem Leben nur die Angst kannten, ob Sie ihre Familie durch den Winter bringen, traf die Schmähung sehr hart. Ich kann den Griff zur Waffe und Gewalt nicht gutheißen, werde das auch nie tun – aber ich kann verstehen, warum viele in ihrer Verzweiflung dazu in der Lage waren.
Was tun Sie, damit die Öffentlichkeit von Ihren Einsichten erfährt?
Ich bin als Journalist und Blogger aktiv, vernetze mich derzeit in der Friedensbewegung und versuche, Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Meine damaligen afghanischen Mitarbeiter müssen heute um ihr Leben fürchten. Sie sind – und werden es auch in Zukunft sein – ein Ziel derjenigen, die ihre Macht in Afghanistan demonstrieren und die sogenannten Kollaborateure abstrafen wollen.
Mitte September 2014 wurde eine meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen in Masar-e-Sharif getötet. Die Umstände sind nicht ganz klar – aber ich weiß, dass die deutschen Asylversprechen an die Ortskräfte nicht effektiv und mit Nachdruck umgesetzt werden. Zu viele Menschen warten noch auf den Abschluss des Verfahrens.
Hat die deutsche Armee ein Glaubwürdigkeitsproblem in Afghanistan?
Darunter leidet nicht nur die Glaubwürdigkeit des deutschen Engagements. Jede afghanische Ortskraft, die getötet wird, ist ein Zeichen in Richtung all der anderen Einsatzländer, in denen die Bundeswehr mit Einheimischen zusammenarbeitet. „Schaut, was mit den afghanischen Ortskräften passiert ist und überlegt, wie lange ihr mit „den Besatzern“ kooperiert.“ An politischer Kurzsichtigkeit ist das nicht zu überbieten. Die Notsituation der Ortskräfte ist übrigens seit Vietnam und den Irakkriegen in der US-Armee längst bekannt – Deutschland tut so, als gäbe es das Problem erst jetzt und zum allerersten Mal.
Welche Erfahrungen machen Sie bei Ihrer Aufklärungsarbeit?
Zusammengefasst: Diese Sicht ist nicht erwünscht. Sowohl mein offener Umgang mit den Gründen für die Traumatisierung als auch das Bild, das ich vom Afghanistaneinsatz vermittele, stoßen nicht auf Gegenliebe. Ich wurde in sozialen Netzwerken wie Facebook, in Diskussionen diffamiert, als unglaubwürdig dargestellt oder es wurde behauptet „Der Mann ist krank – hört ihm nicht zu.“ Im Dezember 2013 legte ein Reservist mir nahe, ich solle das Bloggen, Facebooken und Twittern einstellen. Er riet mir zudem, wieder einen Truppenausweis und damit das Dienstverhältnis als Soldat anzustreben. Der Mitarbeiter eines Bundesministeriums hielt mir unaufgefordert seinen Truppenausweis unter die Nase.
Wieso? Sind Sie aus der Bundeswehr entlassen worden?
Ich war regulär aus dem Dienst ausgeschieden. Meine Zeit in Uniform endete 2008, danach stand mir als Offizier ohne Studium eine Ausbildungsförderung zu, zunächst bei vollem und dann bei einem Teilgehalt. Da ich jedoch zunehmend auf die Belastungen reagierte und immer öfter depressive Ausfälle hatte, war ich bisher nicht in der Lage das zu beenden. Es ergab sich die verrückte Situation, dass mir Hartz IV nicht zustand, während ich noch studierte und außerdem für den Unterhalt meiner Familie aufzukommen hatte. Aber die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Bewältigung des Alltags sind eine Sache die jetzt einfach dran ist. Und die Aufklärungsarbeit hilft mir dabei.
Was meinen Sie damit? Und was erreichen Sie dadurch?
Vielen Unrechtmäßigkeiten, die im Krieg geschehen, kommen nicht ans Licht, sie werden in der Berichterstattung verschleiert. Damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist unpopulär und wegen der bislang reduzierten, irreführenden Berichtersttattung auch sehr schwer. Für viele Menschen ist es nicht vorstellbar, dass derartig vertuscht, verschwiegen und manipuliert wird. Es sind immer sehr, sehr lange Gespräche, die notwendig sind. Das Bild vom Einsatz und von der afghanischen Bevölkerung wurde über die Jahre so unvollständig wiedergegeben, dass es heute schwerfällt, eine andere Sicht zu vermitteln und diese Wissenslücken zu füllen.
Ein Beispiel: im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es zahlreiche Dokumentationen über den Einsatz in Afghanistan. Gezeigt wird in den letzten Jahren aber hauptsächlich, wie Soldaten in Anschläge und Gefechte verwickelt sind. Ein Eindruck von der Lage der Zivilgesellschaft erhalten wir erst in der letzten Zeit, in der es offenkundig darum geht, ein weiteres Engagement zu rechtfertigen.
Das Standard-Skript der Dokumentationen der letzten Jahre enthielt zu 90 Prozent Bilder von Soldaten bei Gefechten und im Routinedienst. Die obligatorischen Bilder verschleierter Frauen, weißbärtiger Afghanen und dem landestypischen Esel prägten unsere Wahrnehmung einer eher rückständigen Gesellschaft.
Dokumentationen wie „Generation Kunduz“ des deutschen Journalisten Martin Gerner werden indes nur in Programmkinos gezeigt, landen aber nicht zur Hauptsendezeit im Fernsehen. Gerner zeigt zu 95 Prozent das Leben der afghanischen Bevölkerung. Der Film entstand 2009, wurde 2012 dann erstmals in Berlin gezeigt und schildert beeindruckend, wie irrelevant das Wirken der deutschen Soldaten aus dem Blickwinkel der Bevölkerung ist.
Die afghanische Realität dürfte sich irgendwo zwischen diesen beiden Schilderungen und Blickwinkeln abspielen. Vermutlich aber näher an „irrelevanten westlichen Truppen“ liegen.
Wer hat denn Ihrer Einschätzung nach Interesse an der Fortsetzung der Besatzung?
Ein Interesse an der Fortsetzung der Besatzung haben vor allen Dingen die zivilen Firmen, die in Afghanistan aktiv sind, Rohstoffe abbauen oder Produkte und Anlagen liefern. Wie groß ist das Wirtschaftsvolumen rund um den deutschen Einsatz? Ich finde auch dazu keine Berichte oder eine plakative Zahl in der deutschen Presse. Dabei geht es nicht nur um direkte Belieferung der Bundeswehr, sondern auch um die Geschäfte rund um das Land. Wenn China in Afghanistan Straßen bauen und Rohstoffe abbauen darf und im Gegenzug dann wirtschaftlich mit Deutschland kooperiert, ist der direkte Profit aus dem Einsatz weitgehend verschleiert.
Wie groß das Tabu ist, über den wirtschaftlichen Nutzen der Einsätze zu reden, erfuhr zuletzt Ex-Bundespräsident Horst Köhler. Meine Haltung dazu ist klar: keine Kriegswirtschaft! Aber dennoch: das ist es, was in Afghanistan mehr oder weniger offen praktiziert wurde.
Was wäre Ihrer Einschätzung nach anders zu machen gewesen?
Das internationale Engagement für Afghanistan hatte von vornherein nur wenig Chancen. Immer wieder wurde in Konferenzen nachverhandelt, immer wieder wurden Truppenstärken variiert, erhöht, verringert – das wirkte auf mich nicht so, als würde sich Deutschland hier als verlässlicher Partner vorstellen.
Wir haben als Westdeutsche vom Marshallplan profitiert. Ein ähnliches Instrument war für einen Wiederaufbau in Afghanistan nicht vorgesehen. Angeblich sollten wir aber den Wiederaufbau unterstützen. Wie sollte das funktionieren? Für eine ganze Generation hat das Land Afghanistan als Schauplatz eines Stellvertreterkrieges gedient. Es ist das traurige Beispiel für eine nachhaltig gescheiterte Politik, in der ausländische Kräfte lokale Kämpfergruppen unter Waffen halten, die sie später gegen die eigene Bevölkerung richten.
Nach gleichem Muster scheiterte die internationale Intervention im Irak – doch leider halten wir an der NATO-Konzeption fest, die in den letzten zwanzig Jahren zusehends mehr Krisenherde am Leben erhält, als das sie Krisen beendet und zu einer positiven Entwicklung in den Einsatzländern führt. Als einzige Lösung sehe ich eine fair handelnde Wirtschaftsordnung an, die weltweit zur Anwendung kommt.
Doch die Profite im Rahmen der Kriegswirtschaft scheinen den Verantwortlichen vielversprechender zu sein. Die Folgen tragen dann die Menschen in den Ländern und die Soldaten, die das umsetzen, was die NATO-Länder beschließen.