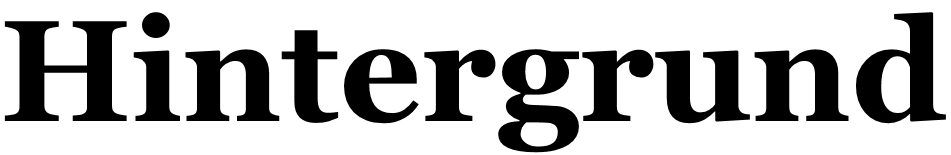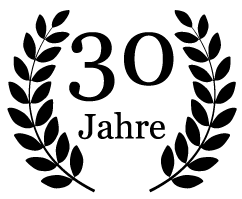Ein Film, der fast nicht gedreht worden wäre
Der Nato-Krieg gegen Serbien 1999, bei dem auch krebserregende Uranmunition zum Einsatz kam, hat verheerende Spuren hinterlassen: Immer mehr Serben entwickeln Tumore und sterben. Der Film "Toxic NATO" beleuchtet dieses Thema und gibt den Opfern eine Stimme. Im Mittelpunkt des Films steht aber der Rechtsanwalt Srdjan Aleksić, der gegen die NATO juristisch vorgehen will.
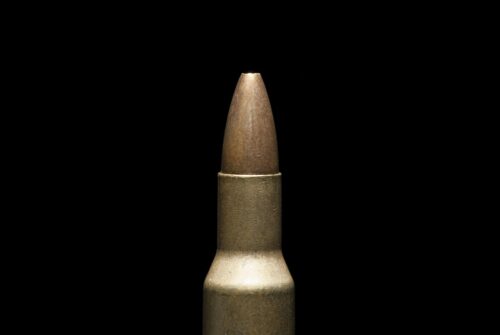 Gefährliche Munition
Gefährliche MunitionFast wäre Toxic NATO, ein Film über den Einsatz von Uranmunition im Kosovo-Krieg, nie gedreht worden. 2019 hatte ich das Thema dem TV-Sender ARTE angeboten, für eine Reihe mit dem Namen „arte:re“. In dieser Reihe, so hatte ich es verstanden, werden Personen in den Mittelpunkt gestellt, die für eine gerechte Sache kämpfen und sich dafür oft mit einer vermeintlichen Übermacht anlegen. Mein Protagonist, der serbische Anwalt Srdjan Aleksić, tut genau dies: Er will die NATO verklagen, weil die sein Land 78 Tage lang bombardiert hat, auch mit Uranmunition. Eine der Folgen dieser Bombardements sind Krebserkrankungen. Sie treffen Alte wie Junge. Inzwischen ist Krebs in Serbien zu einer regelrechten Epidemie geworden.
Auf Spurensuche in Serbien
Um die Hintergründe besser zu verstehen, war ich seinerzeit nach Serbien gereist, nach Belgrad und zu einer Konferenz in Niš, wo ich Srdjan persönlich kennenlernte. Der sanfte Hüne, der eine gut gehende Anwaltskanzlei mit Dependancen in verschiedenen serbischen Städten führt, kämpft für die Rechte zahlreicher Krebsgeschädigter, teilweise unentgeltlich. Er bezeichnet sich selbst als einen „Anwalt der kleinen Leute“. Auch eine seiner Töchter ist Anwältin geworden und arbeitet bei ihm in der Kanzlei.
Neben den zahlreichen Vorträgen auf der Konferenz hatten mich seinerzeit Berichte, die einen anekdotischen Charakter haben, am meisten beeindruckt: So wurde in der Stadt Vranje, im Süden des Landes gelegen, ein Funkverstärker mit Uranmunition beschossen. Von den neun jungen Männern, die man nach dem Bombardement zum Aufräumen dort hingeschickt hatte, waren zwanzig Jahre später, als ich den Vorgang recherchierte, acht verstorben, während einer noch lebte, jedoch ebenfalls an Krebs erkrankt war. In Vranje gibt es auch eine so- genannte „Straße des Todes“, die sich unweit dieses Funkverstärkers befindet. Ihr Name ist der Tatsache geschuldet, dass es hier nicht einen Haushalt gibt, in dem es nicht wenigstens ein Krebsopfer zu beklagen gäbe. Und auch andere Dinge, von denen ich auf meiner ersten Reise nach Serbien erfuhr, sind mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben. So das Gespräch mit einem jungen Mann in Niš, der fast beiläufig erwähnte, dass einer seiner besten Freunde eine vielversprechende Sportkarriere – ich meine, er sei Judoka ge- wesen – aufgrund von Leukämie hatte beenden müssen. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt gewesen.
Das Filmprojekt: Rückschläge und neue Hoffnung
Leider lehnte ARTE dann aber meinen Vorschlag, über den Einsatz von Uranmunition eine Reportage zu drehen, ab. Das Exposé verschwand in der Schublade; ich kümmerte mich um anderes. Bis ich Srdjan im November 2022 – einige Jahre später also – auf dem Weg nach Sofia in einem Belgrader Vorort wiedertraf. Über einem vorzüglichen Gulasch kam uns dann die Idee, mit dem Filmprojekt einen zweiten Anlauf zu wagen. Schließlich ist das, was seinerzeit in Serbien passiert ist, zu wichtig, um in Vergessenheit zu geraten.
Die Dreharbeiten: Winterliche Tristesse zwischen Vranje und Niš
In Berlin fand sich dann auch ein Produzent, der an der Geschichte Interesse zeigte. Die Finanzierung des Films schien gesichert, ich flog Ende Januar 2023 nach Sofia, wo mich der Kameramann Andrey Rachev abholte, um über die nahe gelegene serbische Grenze zu fahren, Srdjan zu interviewen und Aufnahmen von der Landschaft zu machen. Das Wetter war nasskalt, teilweise bedeckte schmutziger Schnee die Straßen. Aus dem warmen Auto zu steigen und mich der unter die Haut kriechenden Kälte auszusetzen, um Kamera- oder Drohnenaufnahmen zu machen, kostete mich Überwindung. Doch genau diese Witterung entpuppte sich für die Dreharbeiten als ideal: Die karge, weiß-graue Landschaft bot mir die ideale Kulisse für meinen Film. Eine blühende Blumenwiese wäre sicherlich weniger passend gewesen. Zudem ist Andrey ein wahrer Virtuose im Umgang mit der Drohne. Mit ihr macht er nicht nur irgendwelche Luftaufnahmen, sondern richtige, grafisch klug komponierte Bilder.
Da wir in Serbien immer von einem Ort zum anderen fuhren – von Niš nach Vranje und von Vranje nach Bustranje –, und das, wo uns nur eineinhalb Drehtage zur Verfügung standen, nehmen Autofahrten einen breiten Raum im Film ein. Zusammen mit der Filmmusik, die aus dem Archiv eines bekannten Filmkomponisten stammt, stellen sie ein tragendes Element von Toxic NATO dar.
Auf unseren Fahrten durch den Süden Serbiens hielten wir auch in der Ortschaft Grdelica. Am 12. April 1999 hatte hier ein NATO-Kampfflugzeug einen Personenzug von einer Eisenbahnbrücke gebombt, zwischen 20 und 60 Zivilisten kamen dabei ums Leben. Aber nicht nur das. Die Brücke und der Zug wurden mit Uranmunition bombardiert, was die Umgebung von Grdelica auf unendlich lange Zeit verseucht hat. Mira Vučković, eine Zeitzeugin, die wir auf der Straße trafen, gab uns darüber Auskunft. Sie hatte auch den Zug noch gesehen, bevor er getroffen wurde, und berichtete von weiteren Bombardierungen der Brücke, die über mehrere Tage andauerten. In Unwissenheit darüber, wann die nächsten Bomben fallen würden, durchzitterte sie die Nächte unter ihrer Bettdecke, unter der sie sich verkrochen hatte wie eine Schildkröte in ihrem Panzer. Sie meint, mit diesen endlosen Bombardements hätte die NATO auch das Ziel verfolgt, die Bevölkerung zu zermürben.
Psychologische Kriegsführung anno 1999
Südlich von Grdelica liegt Vranje, wo Srdjan studiert hat. Er berichtet von einer einst lebensfrohen Stadt. Heute kann sie als ein Zentrum der Krebsepidemie betrachtet werden. Hier treffen wir Slavica Stošic, eine Klientin von Srdjan, die sich seit Jahren mit verschiedenen Krebsarten herumquält. In ihrem Wohnzimmer steht ein Schrank, der vor Medikamenten regelrecht überquillt. Sie ist eine von vielen, die lautlos leiden – und hoffen, dass ihnen Srdjan eine Stimme verleiht.
Hoffnung verheißt hier möglicherweise eine Entwicklung in Italien: Dort hat der Rechtsanwalt Angelo Fiore Tartaglia erreicht, dass der italienische Staat zahlreichen ehemaligen und an Krebs erkrankten KFOR-Soldaten, die in den 1990er Jahren in Bosnien stationiert gewesen und auch dort mit Uranmunition in Berührung gekommen waren, Entschädigung zahlen muss. Für Srdjan ist das eine Argumentationshilfe, sicherlich. Dennoch bleibt es für ihn ein langer steiniger Weg, der ihn durch verschiedene gerichtiche Instanzen führen wird, bis zu einem juristischen Erfolg.
Auf dem Friedhof: Wo der Kampf gegen die NATO begann
Etwa 20 Kilometer von Vranje entfernt liegt der Friedhof von Bustranje. Hier hat ein scharfer Wind die letzten Schneereste an die Sockel der Grabsteine getrieben, wo er feine weiße Linien zwischen Stein und
Erde bildet. Hier ruhen Srdjans Eltern. Sein Vater erkrankte an Hautkrebs, der dazu führte, dass sich seine Haut schmerzhaft von seinem Körper löste. Auch seine Mutter verlor den Kampf gegen den Krebs, ebenso wie zwei seiner Geschwister und zahlreiche Freunde. Als Srdjan seine Mutter sterben und seinen Vater vor dessen Tod noch lange leiden sah, nahm er den juristischen Kampf gegen die NATO auf. Er küsst den Grabstein seiner Eltern, sein Blick nach innen gekehrt. Er hege keinen Groll gegen die NATO, sagt er mir zum Schluss, aber er möchte, dass sie für den Schaden und das Leid, das sie verursacht hat, Wiedergutmachung leistet.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 3/4 2025 unseres Magazins, das im Bahnhofsbuchhandel, im gut sortierten Zeitungschriftenhandel und in ausgewählten Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. Sie können das Heft auch auf dieser Website (Abo oder Einzelheft) bestellen.
MORITZ ENDERS ist freiberuflicher Journalist mit Schwerpunkt Geopolitik sowie Autor und Regisseur von TV- und Filmdokumentationen. Er drehte unter anderem „Schüsse auf dem Petersplatz“ (ZDF /arte) zusammen mit Werner Köhne, „Tod eines Bankers“ (ZDF / arte) zusammen mit Ingolf Gritschneder und zuletzt – frei produziert – „Toxic NATO“ über den Einsatz von Uranmunition im Krieg gegen Serbien 1999.