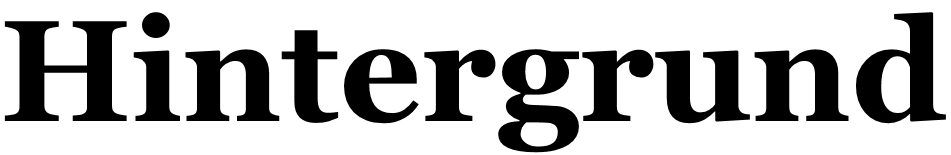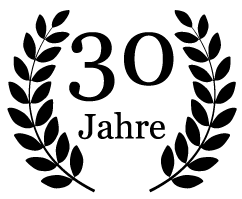Verpasste Gelegenheit
Eine Veranstaltung erinnerte am Dienstag, 11.Februar, an die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR vor 75 Jahren. Zu erfahren waren eine Reihe von interessanten Details, aber wenig über Zusammenhänge und Rahmenbedingungen. Auch ein Vertreter des Bundesnachrichtendienstes (BND) saß mit auf dem Podium.
 Haus 15 des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin
Haus 15 des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in BerlinAm 8. Februar 1950 wurde durch den Beschluss der Provisorischen Volkskammer der jungen DDR das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gegründet. Seitdem gibt es um diese Institution und ihre Arbeit mehr Legenden als Fakten, auch wenn viele ihrer Akten seit etwa 35 Jahren zugänglich sind und sie zum bestuntersuchten Geheimdienst der Welt gemacht haben. Am Dienstag versuchte eine Veranstaltung im privaten Spionagemuseum in Berlin, an die Gründung des MfS vor 75 Jahren zu erinnern.
 Helmut Müller-Enbergs
Helmut Müller-EnbergsDas hätte die Möglichkeit geboten, mit dem zeitlichen Abstand einen nüchternen Blick auf das Ereignis, die Ursachen und Folgen sowie die Rahmenbedingungen zu werfen. Doch es blieb beim Versuch, wofür vor allem der Moderator, der Historiker und Politologe Helmut Müller-Enbergs, verantwortlich war. Er zeigte sein umfangreiches Wissen zu Details der MfS-Geschichte und stellte entsprechende Fragen. Die geschichtlichen und politischen Rahmenbedingungen einschließlich des Kalten Krieges kamen bei ihm aber nicht weiter vor.
 Bodo Hechelhammer
Bodo HechelhammerDafür fragte er seine Gesprächspartner vom MfS, Ex-Generalmajor Heinz Engelhardt und Oberst a.D. Karl Rehbaum, sowie den mit auf dem Podium sitzenden Bodo Hechelhammer vom Bundesnachrichtendienst (BND) nach Details und vor allem danach, was sich einst die Führung der DDR und der MfS-Minister Erich Mielke dachten. Die Fragen zum BND und dessen Verhältnis zu den Gegenspielern auf der DDR-Seite wurden von Hechelhammer größtenteils allgemein oder mit dem Hinweis, dass er zu konkreten Themen nichts sagen könne, beantwortet.
So wollte Enbergs im ersten Teil der Veranstaltung im übervollen Spionagemuseum wissen, wozu der Sozialismus eine „Geheimpolizei“ brauchte, „wenn doch alle den Sozialismus so toll fanden“. Er verlor kein Wort über das Zustandekommen der beiden deutschen Staaten nach dem faschistischen Krieg und der vor allem von den Westmächten betriebenen Teilung Deutschlands sowie der Tatsache, dass sich zwei gegnerische, hochbewaffnete Blöcke gegenüberstanden. Zudem garnierte er seine Moderation immer wieder mit unpassenden flapsigen Sprüchen gegenüber den Gästen, vor allem den ehemaligen MfS-Mitarbeitern.
 Heinz Engelhardt
Heinz EngelhardtHeinz Engelhardt war derjenige, der 1990 gewissermaßen das Licht im MfS ausmachte, das er im Auftrag der letzten DDR-Regierung auflöste. Er wies darauf hin, dass die DDR ein souveräner Staat war, der versuchte, aus Trümmern eine neue Gesellschaft aufzubauen. Dabei wollte sie sich wie alle anderen Staaten auch schützen, da das Umfeld im Westen nicht freundlich gesinnt war. Leider ging Engelhardt nicht konkret mit Beispielen auf die zahlreichen Versuche des US-geführten westlichen Lagers ein, den Aufbau der DDR zu stören und zu behindern. Die Abwehr dieser Versuche war die Aufgabe des jüngsten MfS-Generals in den 1970er und 1980er Jahren.
Er erinnerte zumindest daran, dass die DDR in das sozialistische Lager eingebunden war wie die BRD in das westliche und beide von den jeweiligen Führungsmächten Sowjetunion und USA abhängig waren. Die Entwicklung des MfS könne nicht losgelöst von der der beiden deutschen Staaten und damit auch der Bundesrepublik gesehen werden. Zur Frage des „schlechten Images“ des MfS sagte Engelhardt: „Natürlich haben wir was dazu getan.“
Politische Verfolgung als Fehler
Im Verlauf der Veranstaltung erklärte er mehrmals, dass er die Überwachung und Verfolgung Andersdenkender und vermeintlicher Feinde durch die „Stasi“ als Fehler sehe, der schon damals selbst intern für Unmut gesorgt habe, wogegen sich aber niemand aufgelehnt habe. „Das mit den Mitteln des Strafrechts versucht wurde, politisch auftretende Probleme zu klären und zu lösen, das hat sich als untauglich erwiesen. Das steht außer Zweifel.“ Das gelte zum Beispiel für die strafrechtliche Verfolgung der sogenannten Republikflüchtlinge, für die das MfS zuständig war.
Der Ex-General – der nach dem Ende des MfS 1990 von niemandem formal „außer Dienst“ gestellt wurde – erinnerte im Zusammenhang mit dem Ansehen seines Ministeriums zum einen daran, dass die bundesdeutschen Dienste eine faschistische Vergangenheit hatten, an die sie zum Teil personell anknüpften. Zum anderen verwies er angesichts der Legende vom MfS als „Inkarnation des Bösen“ zum Beispiel auf die bekannt gewordene fragwürdige Rolle des bundesdeutschen Verfassungsschutzes beim Skandal um die neofaschistische Gruppe NSU.
Engelhardt wandte sich auch gegen die „Tonnenideologie“, mit der das MfS bewertet werde, nachdem Ensberg auf Zahlen wie die mehr als 91.000 hauptamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums 1989 sowie etwa 189.000 sogenannten Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) verwiesen hatte. Zu den Beschäftigen des MfS gehörten demnach auch das technische Personal sowie die Soldaten und Offiziere des Wachregiments Feliks Dzierzynski, verantwortlich zuerst für Objektschutz, sowie die Mitarbeiter in den Dienststellen in den Bezirken und Kreisen. Leider ging er nicht weiter darauf ein, dass das Ministerium aufgabenbedingt eine andere Struktur hatte als die drei Hauptdienste der BRD, der BND (nach außen), der Verfassungsschutz (nach innen) und der Militärische Abschirmdienst (MAD). Beides war geschichtlich und durch die Vorgaben der jeweiligen Besatzungs- beziehungsweise Führungsmächte bedingt.
Eine der Aufgaben des MfS war neben der inneren Abwehr die Aufklärung nach außen, wofür die Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) zuständig war. Zu ihr gehörte mehrere Jahrzehnte Karl Rehbaum, dessen Spezialgebiet die NATO war. Der heute 87-Jährige war verantwortlich für eine Reihe von Agenten des MfS, „Kundschafter des Friedens“ im eigenen Sprachgebrauch, die in den Staaten des westlichen Militärbündnisses aktiv waren. Der bekannteste von ihnen war Rainer Rupp, Top-Agent „Topas“ bei der NATO, der mutmaßlich durch Verrat enttarnt wurde und wie eine Reihe anderer in den 1990er Jahren dafür eine Haftstrafe verbüßen musste.
 Karl Rehbaum
Karl RehbaumRehbaum widersprach dem Bild, dass die Aufklärer des MfS nur das „Anhängsel“ des sowjetischen KGB gewesen seien, was bis zuletzt auch die CIA geglaubt habe, während sie später ihren Irrtum bedauerte. Es habe eine „solide und kooperative“ Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Geheimdienst gegeben. Und er verwies darauf, dass es dem MfS gelang, in der BRD zahlreiche „Quellen“ zu platzieren beziehungsweise zu gewinnen, bis hinein in die Parteien und die Regierung. BND-Mann Hechelhammer, Historiker, hatte zuvor erklärt, dass die Akten gezeigt hätten, dass die DDR dabei viel Aufwand betrieben, aber relativ wenig erreicht habe.
Falsche Schlussfolgerungen aus Realitätsverweigerung
Allerdings habe die DDR-Führung nicht immer die richtigen Schlussfolgerungen aus den Informationen ihres Nachrichtendienstes gezogen, bedauerte Rehbaum. Das habe zum einen daran gelegen, dass das MfS zwei „Herren“ hatte, die Regierung und die Staatspartei SED, deren „Schild und Schwert“ es sein sollte. Zum anderen seien dafür drei „Grundübel“ verantwortlich gewesen: „Erstens, die Informationen wurden nicht gelesen. Zweitens, sie wurden nicht verstanden. Und drittens: Es durfte so nicht sein.“ Diese Probleme haben bekanntermaßen alle Nachrichtendienste, da am Ende die Politik in Form der Regierung entscheidet, was mit ihren Informationen geschieht.
Aber die Aufklärer des MfS haben einen Beitrag zum Frieden geleistet, zeigte sich Rehbaum sicher, der auf entsprechende Aussagen anderer Geheimdienste aus der Zeit des Kalten Krieges verwies und dafür auch vom BND-Vertreter neben ihm keinen Widerspruch bekam. Dafür musste sich Ex-MfS-General Engelhardt die „moralische Frage“ von Moderator Ensberg gefallen lassen, was er Menschen sage, die Opfer des MfS-Vorgehens gegen echte und vermeintliche Oppositionelle wurden und ihm sowie den anderen hauptamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums unversöhnlich gegenüber seien.
In seiner Antwort darauf trennte Engelhardt zwischen der juristischen und der moralischen Seite der Fälle, von denen er einige persönlich kennengelernt habe. Er sei überzeugt, „dass mit dem einen oder anderen hätte geredet werden können. Wir haben sie in eine Ecke gestellt, wo sie nicht hingehört hätten.“ Es habe im MfS Mitarbeiter gegeben, die „überzogen“ hätten, dennoch lehne er eine pauschale Entschuldigung ab. Er weigere sich zu erklären, „alle, die bei uns saßen, saßen zu Unrecht, weil sie eine politische Meinung hatten“. Im Einzelfall könne darüber gesprochen werden, wenn es sich um solche gehandelt habe, die anders gelöst hätten werden können. „Aber diese pauschale Erklärung, die Sie vielleicht von mir erwarten, kann ich und will ich auch nicht abgeben“, sagte der Ex-General.
Er berichtete in der Veranstaltung auch über die Vorgänge vom 15. Januar 1990, als die MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg „gestürmt“ wurde. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als längst Vertreter von sogenannten Bürgerkomitees (Gruppen aus der Bürgerbewegung) aus der ganzen DDR die Arbeit des Ministeriums kontrollierten und dort ein und aus gingen. Engelhardt war an dem Tag zum Dienst ins Ministerium kommandiert worden, um die Ereignisse zu beobachten, da die „Erstürmung“ angekündigt worden war. Er wurde damals bekannt, weil ein Spiegel TV-Team an dem Abend an der Tür im Hauptgebäude klopfte und mit ihm sprach und später darüber berichtete.
Es habe sich nicht um einen „Sturm“ gehandelt, was auch Ensberg bestätigte, sondern eher um einen chaotischen Vorgang. Allerdings sei es eine „Frage des Glücks“ gewesen, dass es dabei zu keinerlei Verletzten oder gar Toten infolge von Paniksituationen gegeben habe, so Engelhardt. Bei diesem Ereignis seien aber einige Teilnehmer mit mutmaßlich geheimdienstlichem Auftrag ganz gezielt vorgegangen. Solche hatte auch HV A-Mitarbeiter Rehbaum erlebt, der ebenfalls am 15. Januar 1990 in der MfS-Zentrale war, im Gebäudeteil der Aufklärung. Er berichtete ebenso wie Engelhardt über die Abwicklung des eigenen Dienstes, einschließlich der offiziellen und inoffiziellen Aktenvernichtungen. Die wichtigste Sorge sei dabei gewesen, die eigenen Mitarbeiter sowie vor allem die Quellen im Ausland zu schützen. Die Räume des MfS seien „besenrein“ übergeben worden, allerdings sei gezielt ein Aktenbestand erhalten worden: Der mit den Erkenntnissen der DDR-Aufklärer über den BND, damit dieser erfuhr, was die DDR alles über ihn wusste.
Enttarnungen und Erkenntnisse
Moderator Ensberg erinnerte im Zusammenhang mit dem Ende des MfS an die sogenannten Rosenholz-Dateien, in denen alle „Kundschafter“ für die DDR im Westen registriert waren. Auf welchem Weg diese in die USA gelangten ist bis heute offiziell unbekannt und konnten auch Engelhardt und Rehbaum nicht aufklären. Letzterer widersprach aber den Gerüchten, dass dabei der sowjetische KGB eine Rolle gespielt haben soll. In der Folge wurden mehr als 1.500 Bundesbürger enttarnt, so Ensberg, während es insgesamt rund 3.000 Ermittlungsverfahren sowie 360 Verurteilungen gegeben habe.
Wenn es diese „Rosenholz-Dateien“ nicht gegeben hätte, wären viele der DDR-Agenten im Westen nicht enttarnt worden, so Aufklärungsoffizier Rehbaum. Er beklagte auch die „Nachlässigkeit“ der letzten DDR-Regierung bei den Verhandlungen zum sogenannten Einigungsvertrag. Die Agenten der BRD seien geschont und belohnt worden, während die eigenen der BRD-Justiz ausgeliefert wurden. Deshalb handele es sich für ihn um eine Annexion der DDR, mit Nachteilen für eine Seite, was die vielen ehemaligen Mitarbeiter des MfS im Publikum mit Beifall bedachten.
Aus dem Publikum wurden die ehemaligen MfS-Mitarbeiter gefragt, ob es im Ministerium im Herbst 1989 Pläne gegeben habe, die anwachsenden Proteste mit einer gewaltsamen „chinesischen Lösung“ zu unterdrücken. Die Frage war insofern erstaunlich, weil längst bekannt ist, dass die DDR-Führung damals nicht an einen Einsatz massiver Gewalt dachte, nachdem es Anfang Oktober 1989 in Dresden und Berlin zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen war. Auch das anfangs befürchtete Blutbad bei der „Montagsdemonstration“ am 9. Oktober 1989 in Leipzig blieb aus und es gab auch keinen „Schießbefehl“. Der heute 80-jährige Ex-MfS-General Engelhardt sagte dazu, dass vielleicht Einzelne in der Parteiführung oder im Ministerium an eine solche Variante gedacht haben könnten, aber es habe keinerlei entsprechenden Pläne gegeben. „Wir waren klug und Realisten genug, dass wir wussten, dass spätestens mit der Maueröffnung das Ende der DDR kam. Und vor dem gab es auch nicht solche Überlegungen.“
Es sei auch den meisten im MfS klar gewesen, dass „die Messe gelesen“ war. „Das Ding war vergeigt“ hatte er vor fünf Jahren in einem Interview dazu erklärt. Auf dem Rücktitel seines Buches „Der letzte Mann – Countdown für das MfS“ ist zu lesen: „Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die Staatssicherheit die DDR so wenig retten konnte, wie sie an ihrem Untergang Schuld war.“ Die Frage, ob jene, die für die Sicherheit des zweiten deutschen Staates und seinen Schutz verantwortlich waren, vielleicht bei dieser Aufgabe am Ende versagt haben oder daran scheiterten, wurde an dem Abend im „Spionagemuseum“ nicht gestellt.