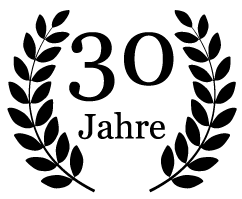Oben ohne im Paralleluniversum: Wer ist eigentlich aus welcher Zeit gefallen?
Wo ist die wunderbar entspannte Vielfalt geblieben, die wir vor Jahrzehnten in Deutschland erlebten? Eine Vielfalt, die sich hier und da noch heute im Kleinen offenbart, auf der großen Bühne hingegen als ewiggestrig gilt. Axel Klopprogge spürt in seinem Essay mit Humor, Wehmut und Fachkenntnis besseren Zeiten nach. Und er stellt sich dabei nicht nur die Frage nach einem Wahlrecht für Menschen, die mit 17 Jahren noch nicht allein den Weg zur Schule finden.
 Der Autor unternahm seltsame Zeitreisen mit umgekehrtem Vorzeichen.
Der Autor unternahm seltsame Zeitreisen mit umgekehrtem Vorzeichen.„Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen
weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen
sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen,
hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie,
das andere Mal als Farce.“
Karl Marx,
Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte
Im Sommer 2022 verbrachten meine Frau und ich einige Wochen an der Ostsee. Auf dem Weg in den Norden und auf den Fahrten in den folgenden Tagen hörten wir im Autoradio immer wieder Berichte über einen Pilotversuch in einem Göttinger Freibad. Dort hatte man versuchsweise und unter wissenschaftlicher Begleitung den Frauen das Oben-ohne-Baden erlaubt. Meine Frau und ich schauten uns ungläubig an. Wir hatten dergleichen für eine längst etablierte Selbstverständlichkeit gehalten. Schon vor Jahrzehnten im biederen Familienbad von Dettenhausen ebenso wie an oberbayerischen Seen oder an Mittelmeerstränden – im Englischen Garten oder an der Isar mitten in München sowieso. Die Radioberichte hörten jedoch nicht auf. Es wurden Politiker, Soziologen und Historiker interviewt, die das „Experiment“ begleiteten.
Schließlich genossen wir eine Woche die endlosen Strände von Fischland-Darß. Dort fand sich alles durcheinander: Menschen, die in Badebekleidung am Strand lagen. Andere, die vollkommen hüllenlos waren und sich dabei keineswegs verschämt in den Dünen versteckten, sondern nackt ins Wasser gingen oder ein Eis oder einen Hotdog kauften. Protagonisten waren nicht nur – wie sonst häufig – eher ältere Menschen. Nein, auch Gruppen junger Menschen von vielleicht 15 oder 17 Jahren saßen gemischt beieinander – die einen voll, die anderen halb, die anderen unbekleidet. Das Ganze spielte sich übrigens nicht an einem ausgewiesenen FKK-Strandabschnitt ab, sondern über Kilometer einfach ganz ungesteuert, locker und entspannt. Historiker und Soziologen konnten wir nicht entdecken. Meine Frau und ich fanden dies ein schönes Beispiel von Befreiung, von Lockerheit, aber auch von gelebter Diversität.
Wenn diese Freizügigkeit nicht nur seit Jahrzehnten so existierte, sondern auch heute jederzeit von jedem besichtigt werden kann, warum braucht es dann einen Pilotversuch in Göttingen? Haben wir beim Älterwerden irgendetwas verpasst, irgendwo den Anschluss verloren? Nun, diese Vermutung könnte zutreffen, wenn es eine reale Entwicklung gegeben hätte – egal ob die Richtung uns gepasst hätte oder nicht. Aber wieso muss man einen Pilotversuch aufsetzen und aufgeregt über etwas berichten, was es längst gibt? Und worin besteht der Beitrag von Soziologen und Historikern, wenn sie nicht mit einem einzigen Wort erwähnen oder vielleicht gar nicht wissen, dass der Versuchsgegenstand schon längst etabliert ist und ohne Weiteres funktioniert?
Seltsame Zeitreisen mit umgekehrtem Vorzeichen
Wir kamen uns vor wie in Parallelwelten, aber in Parallelwelten, die offenbar beide real sind. Offenbar gibt es Menschen, die es für neu und aufregend und gar für einen mutigen feministischen Befreiungsakt halten, im Freibad Oben-ohne zuzulassen, und die es für wert erachten, tagelang darüber im Radio zu berichten. Und gleichzeitig andere Menschen, die das seit Jahrzehnten ganz locker und für jeden sichtbar praktizieren. Wie kann das sein?
Wenn man als reiferer Mensch solche Momente des Unverständnisses erlebt, dann ist die normale Erklärung, dass man eben älter wird und irgendwo den Anschluss verpasst. So wie unsere Eltern oder Großeltern nicht unsere Frisuren, unsere selbstgebatikten T-Shirts und unsere Musik verstanden und vielleicht das Ende des Abendlandes kommen sahen. Und wie wir selbst bestimmte Sachen nicht mehr verstehen oder mitmachen wie Tattoos und Piercings, Influencertum oder Schönheitsoperationen bei 18-Jährigen. Wenn unser Unverständnis nur darin bestände, wäre es ja der uralte Glaube, dass die jeweils neue Generation die schlimmste Generation überhaupt ist und nach uns alles den Bach hinuntergeht. Es wäre – positiv ausgedrückt – der normale, mit dem Kommen und Gehen von Generationen verbundene Fortschritt. Das zu erleben, kann grausam sein wie die Austragshäuser, die man in bayerischen Museumsdörfern besichtigen kann.
Aber passen dieser Vergleich und diese Erklärung? Was meine Frau und ich nicht verstanden, war ja keine Entwicklung hin zu etwas unerhört Neuem, sondern die possenhafte und sich als Befreiung aufführende Wiederholung von etwas, was es in aller Selbstverständlichkeit schon längst gab. Ist das der revolutionäre oder evolutionäre Fortschritt, der mit jeder neuen Generation verbunden sein sollte? Oder ist es eine neue Variation der alten Regel, dass historische Ereignisse immer zweimal stattfinden und das zweite Mal als Farce? Ich würde eine solche Frage nicht stellen, wenn ich mich nicht immer wieder ungewollt in solchen seltsam verdrehten Zeitreisen wiederfände.
Fortschritt durch Wahlrecht für Unmündige?
In meiner Kindheit in der Innenstadt von Mönchengladbach war es selbstverständlich, als Kind allein quer durch die Stadt zum Kindergarten oder zur Schule zu gehen, nachdem die Eltern ein einziges Mal den Weg gezeigt hatten. Zum Spielen ging man auf den Garagenhof, in den Park oder Wald und kam nach Stunden wieder, wenn es dunkel wurde. Ebenso selbstverständlich war es in Frankfurt, im Alter von zehn Jahren in einer Straßenbahn mit offener Plattform zur Schule in die Innenstadt zu fahren. Nachdem meine Eltern von Frankfurt nach Aachen gezogen waren, haben meine Freundin und ich uns im Alter von 12 oder 13 Jahren gegenseitig besucht – allein mit dem Zug quer durch Deutschland einschließlich Umsteigen. Dass unsere Eltern in die Schule gekommen wären und mit dem Lehrer gesprochen hätten oder uns zum Fußballspielen gefahren und womöglich noch zugeschaut hätten, wäre uns als oberpeinlich erschienen und hätte unseren Ruf bei den Freunden und Mitschülern nachhaltig ruiniert.
Inzwischen gelten offenbar andere Regeln. Kindergärten und Schulen gleichen morgens der Taxivorfahrt am Frankfurter Flughafen. Schilder müssen ausdrücklich ermahnen, dass Eltern nicht bis in den Klassenraum kommen sollen. Im Lastenfahrrad werden Kinder transportiert, die längst selbst laufen oder Rad fahren könnten. Und offenbar hört diese Fürsorge nicht auf: Noch an den Universitäten tauchen um das Wohl ihrer (natürlich hochbegabten) Kinder besorgte Eltern auf, obwohl die Professoren aus Datenschutzgründen gar nicht mit ihnen reden dürfen. Und die erwachsenen Kinder haben damit offenbar kein Problem.
Was ist hier passiert? Hänge ich senilen Träumen einer romantischen Kindheit in der Wildnis nach? Bin ich ungerecht? Habe ich verschlafen, dass die Welt heute gefährlicher ist als damals? Können heute junge Menschen nicht mehr für sich selbst sprechen? Aus der Verwandtschaft kenne ich Männer, die als Siebzehnjährige zum Volkssturm eingezogen und dann jahrelang in der Kriegsgefangenschaft gehalten wurden. Ich kenne Frauen, deren Mutter gestorben war und die als älteste Tochter die Mutterrolle für ihre jüngeren Geschwister einnehmen mussten. Meine Großmutter musste seit dem Alter von sieben Jahren durch Gänsehüten und Kartoffelernten zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. In diesen Fällen selbstverantworteten Lebens ließe ich gerne über die Herabsetzung des Wahlalters mit mir reden. Aber das Wahlrecht für Menschen, die mit 17 Jahren noch nicht allein den Weg zur Schule finden?
Fortschritt durch Rückabwicklung der Geschichte?
An der Kuppel des wiederaufgebauten Berliner Stadtschlosses findet sich eine umlaufende Inschrift mit einem Bibelzitat. Die Bibelzitate wurden von König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) ausgewählt und im Jahr 2020 an der Kuppel rekonstruiert. Wörtlich heißt es dort: „Es ist in keinem andern Heil, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ In bestimmten Kreisen rief diese Inschrift Kritik hervor. Die christlichen Worte würden andere Religionen ausgrenzen. Die „Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss“ stellte daraufhin neben der Kuppel auf der Dachterrasse eine Tafel mit diesem Text auf: „Alle Institutionen im Humboldt Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums, den die Inschrift zum Ausdruck bringt.“
Während ich beim Lesen dieser Nachricht noch zwischen Lachen und Weinen schwankte, erinnerte ich mich an eine eigene Erfahrung. In diesem Fall ist das Paralleluniversum nur wenige Meter vom Humboldt Forum entfernt: Vor rund zwanzig Jahren war ich als Aufsichtsrat an der Gründung der ESMT (European School for Management and Technology) beteiligt, die ein Gegengewicht zu den meist angelsächsisch geprägten Business Schools bilden sollte. Diese Kaderschmiede des Kapitalismus ist in Berlin im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR mit der Adresse „Schlossplatz 1“ untergebracht. Kaum betritt man die Eingangshalle, blickt man gegenüber auf riesige Glasmalereien im kämpferischen Stil des Sozialistischen Realismus. Obwohl die martialischen Botschaften dieser Bilder gewiss nicht der heutigen Nutzung des Gebäudes entsprechen, haben wir damals als Gründer nicht eine Sekunde daran gedacht, diese abzudecken, mit Warnhinweisen zu versehen oder uns davon zu distanzieren. Anders als die Verantwortlichen des Humboldt Forums waren wir überzeugt, dass erwachsene Menschen aller Bildungsschichten es schaffen, mündig mit der Vielfalt der Geschichte und der Kulturen umzugehen.
Ist es altmodisch, anderen Menschen Mündigkeit zuzutrauen oder ist inzwischen irgendetwas passiert, wegen dessen die Menschen nicht mehr mündig sind? Ist die vielbeschworene Vielfalt in guten Händen bei Leuten, die nichts ertragen und zulassen wollen, das außerhalb eines offenbar recht engen Weltbildes liegt? In einem Schreiben an den Generalintendanten des Humboldt Forums hatte ich seinerzeit vorgeschlagen, statt eines Warnhinweises einen anderen Bibelvers an der Kuppel anzubringen, mit dem sich die Verantwortlichen vielleicht besser identifizieren könnten, nämlich das Gebet des Pharisäers im Lukas-Evangelium: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner.“
Fortschritt durch Distanzierung von den Schmuddelkindern?
Bleiben wir einen Augenblick bei der Bibel: In der Kirche werden seit jeher die Geschichten aus den Evangelien gelesen und gedeutet, in denen Jesus genau zu denen ging, die den Pharisäern als anstößig galten. Und zwar nicht nur zu den sozial Schwachen, sondern zu den Kollaborateuren, den Steuereintreibern, den Prostituierten, aber auch den politischen Widerstandskämpfern – und übrigens traf sich Jesus auch mit seinen Gegnern, den Pharisäern. Oder mit Pharisäern und Prostituierten gleichzeitig wie in der erstaunlichen Geschichte von Lukas 7, 36-50. Ein wichtiges Merkmal der frühen Christen war, dass sie sich über Speisegebote und Speiseverbote hinwegsetzten und keine Angst vor Tischgemeinschaften mit Unreinen hatten. „Alles ist mir erlaubt – aber ich will mich von nichts beherrschen lassen!“ sagte der Apostel Paulus zum Thema der Speisen (1. Korinther 6,12). Und Jesus verkündete: „Nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde herauskommt, das macht den Menschen unrein.” (Matthäus 15,11). Offenbar hatten Gottes Sohn und seine Jünger keine Angst vor Kontaktschuld. Unabhängig davon, wie sich der persönliche Glaube entwickelte: Solche Grenzüberschreitungen und das Ideal der Tisch- und Redegemeinschaft waren in den gesellschaftlichen Werten verankert. 1965 behandelte der Liedermacher Franz Josef Degenhardt dieses Ideal in seinem Song „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“.
Wie weit ist das entfernt von heutigen Kategorisierungen, in denen unter dem Stichwort der „Kontaktschuld“ schon die Bekanntschaft mit Andersdenkenden zur ewigen Verdammnis führt! Bin ich altmodisch, wenn ich die Mündigkeit und Freiheit sowie die Bereitschaft zur Grenzüberschreitung, die aus den zitierten Bibelworten spricht, mehr schätze als engstirniges Bemühen um Abgrenzung und Reinheit – egal ob beim Essen oder beim Denken? Ist die ständige Zuordnung zu vermeintlichen Milieus, die ständige Abgrenzung und Distanzierung, die Zuteilung zu Identitäten und die Behauptung, dass man andere Identitäten nicht verstehen könne, ein Zeichen eines Fortschrittes, zu dem ich den Anschluss verpasst habe?
Fortschritt durch Vermeidung des Diskursrisikos?
In den 90er und Anfang 2000er Jahren war ich Mitglied und Vorsitzender des „Arbeitskreises Technik und Gesellschaft“ der Dasa bzw. der EADS (heute Airbus). Jedes Jahr veranstalteten wir das „Ottobrunner Gespräch“ zu gesellschaftlichen Themen. Als Redner traten etwa auf Reinhard Marx, damals noch Weihbischof von Paderborn, Otto Graf Lambsdorff als liberales Urgestein, Joscha Schmierer, in den siebziger Jahren Vorsitzender des KBW und später Abteilungsleiter im Außenministerium, Günter Bazyli, ehemaliger Oberst der Grenztruppen der DDR, Michael Stürmer von der konservativen Zeitung DieWelt, der Münchner Polizeipräsident und viele mehr. Im Publikum saßen Vorstände, Mitarbeiter und Betriebsräte des Unternehmens sowie Gäste jeder Art. Sie hörten sich die Vorträge an und diskutierten – auch noch spätabends beim Bier. Niemals fragten wir irgendjemand im Unternehmen, ob wir den Referenten xy einladen dürften. Niemals hinterfragte jemand unsere Einladungen. Niemals fragte einer der Referenten, wer denn die anderen Referenten und das Publikum seien. Niemals prüften oder hinterfragten wir vorab die Botschaften der Referenten. Niemals drohte irgendeiner der Referenten damit, dass er nicht komme, wenn der und der komme.
Kaum zwanzig Jahre später hört sich dies an wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten. Eine Veranstaltung wie das Ottobrunner Gespräch, die damals ganz normal erschien, wäre heute nicht mehr möglich. Das Unternehmen, die Referenten, andere Beobachter, alle hätten Angst vor den Risiken – vor Störungen, vor Drohungen, vor anschließenden Shitstorms. Gewiss würde alles von der Compliance-Abteilung und von allen möglichen Beauftragten geprüft und gewiss bliebe nichts mehr übrig, denn Diskurs an sich ist ein Risiko. So denkt etwa der Münchner Stadtrat darüber nach, vor der Vermietung der Olympiahalle die Gesinnung der auftretenden Künstler zu prüfen. Ist das mehr oder weniger Diversity? Und sind die Leute, die sich eine diverse Diskurskultur zurückwünschen, konservativ? Oder bilden sie gar ein gemeinsames Milieu?
Fortschritt durch Umetikettierung der Totalkontrolle?
Man muss auch gar nicht immer nur an politische Zusammenhänge denken. In der Managementliteratur ist in Zusammenhang mit Digitalisierung und Agilität viel von sogenannter „Führung 4.0“ die Rede. Die Schwerpunkte der Führung sollen sich von „Command and Control“ zu „Autonomy“, von finanziellen Anreizen zur Sinnstiftung und von der Hierarchie zum Netzwerk verlagern. In einem Buch zum Agilen Personalmanagement heißt es: „Das Menschenbild in verschiedenen Organisationen lässt sich durch den autonomen Mitarbeiter zusammenfassend beschreiben. Dieser muss nicht zur Arbeit gezwungen werden und bei der Ausübung dieser nicht kontrolliert werden.“
Wenn man systematischer hinter diese Glitzerfassade schaut, drängen sich allerdings einige Fragezeichen auf. Dann entsteht ein Mosaik, das in schreiendem Widerspruch zu den Versprechungen von Vertrauen, Autonomie und Empowerment steht. Die angepriesenen digitalen Führungsinstrumente zeigen unverhohlen in Richtung permanenter Totalkontrolle, Misstrauen und hierarchisch-zentralistischer Organisationsvorstellungen. Sie enthalten somit am laufenden Meter die Annahme, dass Kontrolle besser als Vertrauen sei. Und dies gilt beileibe nicht nur für einfache Tätigkeiten, sondern auch für Managementaufgaben. Vor über dreißig Jahren konnte ich als kleiner Sachbearbeiter freier und unkomplizierter Entscheidungen treffen als heute hochbezahlte Manager.
Ist es altmodisch, daran zu glauben, dass Menschen mehr leisten und zufriedener sind, wenn man ihnen vertraut und Gestaltungsspielräume lässt? Ist es ein Fortschritt, wenn in einem großen Unternehmen das Kompetenzkriterium der „Inneren Unabhängigkeit“ durch die Anforderung der „Anpassungsfähigkeit“ abgelöst wurde? Vor allem ist es für einen lebenserfahrenen Menschen gewöhnungsbedürftig, wenn sich – nicht anders als im Göttinger Freibad – auch in den Führungssystemen der Rückschritt als Fortschritt feiert.
Fortschritt durch Dünkel einer akademisierten Mittelschicht?
Seit meinem Wehrdienst, seit meiner Arbeit als Briefträger während der Studentenzeit, auf vielen Touren durch Deutschland zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bahn und Auto und natürlich auch beruflich hatte und habe ich mit Menschen unterschiedlichster Schichten und Hintergründe zu tun. Immer habe ich die Gespräche geschätzt; die Vielfalt der Erfahrungen und Lebensläufe, die humorvolle Offenheit und Toleranz der meisten Menschen, ja die regelrechte Weisheit der sogenannten einfachen Leute. Und umgekehrt habe ich als junger Mitarbeiter oft gesehen, wie die alte Garde der Unternehmenslenker, die vielfach noch eine Lehre absolviert hatte, sich locker in den Werkshallen bewegte. Und zwar nicht mit Jeans und Sneakern oder gar Blaumann, um modern und kumpelhaft zu wirken, sondern mit schwarzem Anzug und Krawatte. Sie redeten normal mit den Arbeitern und man respektierte die Kompetenz des jeweils anderen – so wie das die meisten mittelständischen Unternehmer immer noch können.
Heute reagieren schon Studenten mittelmäßiger Hochschulen pikiert, wenn man ihnen zumutet, in einem empirischen Projekt gewerbliche Auszubildende oder Handwerker zu interviewen. Und wenn die Arbeitswelt von Fabrikarbeitern doch Gegenstand einer soziologischen Untersuchung wird, dann liest es sich wie die ethnologische Expedition zu einem bemitleidenswerten Eingeborenenstamm – natürlich mit sozialfürsorglichem Anstrich von oben herab. Offenbar gilt körperliche Arbeit generell als bemitleidenswert. Immer wieder hört man von einer Zukunft der Arbeit, bei der man unter dem Stichwort der „Workation“ zu jeder Zeit an jedem Ort seine Arbeit verrichten könne. Zum Beispiel mit dem Laptop im Liegestuhl am Strand – natürlich unter der stillschweigenden Annahme, dass das Wartungspersonal des Flugzeuges, die Hersteller von Liegestuhl und Laptop sowie der Pizzaservice und die Mitarbeiter der Strandbar keine flexiblen Arbeitszeiten haben und nicht New-Work-mäßig am Strand sitzen.
Bin ich ein aus der Zeit gefallener Sozialromantiker, wenn ich wie der amerikanische Philosoph Michael Sandel der Meinung bin, dass wir in einer Gesellschaft keine vollständige Gleichheit brauchen, uns aber sehr wohl begegnen, sehr wohl miteinander reden und sehr wohl einen Teil der Erfahrungen miteinander teilen müssen? Ist es fortschrittlich und links, ohne Not eine selbstgerechte Sprache zu erfinden, mit deren Gebrauch man sich vom natürlichen Gespräch und Austausch mit den Millionen Menschen ausschließt, die unser Land mit ihrer Arbeit am Laufen halten?
Fortschritt durch Werkzeuge der Alltagsdiktatur?
In meine Schul- und Lebenszeit fiel eine intensive Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus – teilweise als Element des Lehr- oder Studienplans, teils aus Eigeninteresse meiner Generation. Schließlich ging es um unsere Eltern und Großeltern, um unsere Lehrer, Politiker und Funktionsträger. Neben den großen Linien der Nazizeit wie Zweiter Weltkrieg und Holocaust richtete sich unser Interesse auf die Frage, wie eine Diktatur im Alltag funktioniert. Durch viele Verwandtenbesuche in der DDR konnte ich eine andere Diktatur im unspektakulär-beklemmenden Alltag besichtigen. Seit dieser Beschäftigung sind viele Erkennungs- und Warnzeichen in meinem Kopf verankert: Die Bücherverbrennung oder die Ausstellungen zur Entarteten Kunst als Symbole des Ziels, nur noch genehmen Inhalten und einem normierten Geschmack eine Bühne zu geben. Die Einleitungen vieler Bücher, in denen, bevor es zum eigentlichen Inhalt kam, zunächst politisch korrekt dem System gehuldigt wurde. Der Ursprung von SA und SS als Störer von Veranstaltungen politischer Gegner. Die Blockwarte und Hausgemeinschaftsleitungen als Beispiele der alltäglichen Hintertreppenbespitzelung. Die Denunziationen, die vorauseilende Anpassung, der Wahn, immer hundert Prozent Zustimmung haben zu müssen. Das identitäre Kategorisieren von Menschen bis hin zu den Symbolen auf der Kleidung der KZ-Insassen. Das Wegmobben eigenständig denkender Menschen aus ihren Funktionen, gerade auch im Wissenschaftsbetrieb. Das Verbiegen von Tatsachen in Medienberichten, damit es keinen Applaus von der falschen Seite gibt. Das Umbenennen von Straßen, Plätzen oder sogar Orten – manchmal auch mehrfach, je nachdem wie gerade die politische Linie war. Auch die Biografien der Politprominenz in den einschlägigen Enzyklopädien wurden mehrfach geändert. Ich erinnere mich, wie 1976 nach dem Tod Mao Tse-tungs die Zeitschrift China im Bild monatelang nicht erschien. Als sie dann schließlich eintraf, waren auf dem Foto, das die gesamte Führungsprominenz um den Sarg Maos versammelt zeigte, die Mitglieder der inzwischen entmachteten „Viererbande“ wegretuschiert – ja, man hatte sich nicht einmal entblödet, in der Bildunterschrift an den leeren Stellen ein „xxx“ einzufügen. Natürlich hatten wir George Orwells „1984“ und Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ gelesen. Wir kannten die Beschreibungen der Versuche, durch Änderungen der Sprache das Denken zu verändern und ein abweichendes Denken unmöglich zu machen.
Jenseits der großen Aufmärsche, Feldzüge und Leichenberge waren das für mich Warnzeichen, an denen man Versuche erkennen kann, das Denken gleichzuschalten. Was muss ich davon halten, wenn ich heute in Zusammenhang mit politisch korrekter Sprache ganz offen die Argumentation finde, dass Denken durch Sprache geprägt werde und man deshalb die Sprache verändern müsse, damit die Menschen nicht „falsch“ denken? Hat hier jemand „1984“ als Anleitung statt als Warnung missverstanden? Was soll denn mit den Büchern passieren, bei denen Passagen geändert wurden? Kann man die alten Versionen noch in den öffentlichen Bibliotheken lassen? Darf man Großeltern erlauben, aus den alten Versionen vorzulesen, die vielleicht noch aus der eigenen Kindheit im Regal stehen? Und was passiert mit den aus den Bibliotheken und Regalen entfernten Büchern? Werden sie der thermischen Verwertung zugeführt oder gar als Giftmüll entsorgt?
Ist es altmodisch, auf die kleinen unscheinbaren Warnzeichen zu hören, die seit Jewgeni Iwanowitsch Samjatins dystopischem Roman „Wir“ aus dem Jahre 1920 immer wieder illustriert wurden? Ist das Umschreiben oder Beseitigen von Büchern, die Umbenennung von Straßen, die Aufforderung zur Denunziation, das Stören von Veranstaltungen Andersdenkender plötzlich gut und fortschrittlich, wenn sie einem Zweck dienen, der von mir selbst als gut deklariert wurde? Ist die Erkenntnis Karl Poppers altmodisch, dass die Gefahr für die offene Gesellschaft nicht von den Bösen, sondern von den Guten kommt?
Fortschritt durch Rückkehr in den Mief der Fünfziger?
Mir fallen noch zahlreiche Beispiele solch befremdlicher Zeitreisen ein. Etwa die Wandlung vom Idealbild der Selbstbestimmung im Feminismus einer Simone de Beauvoir hin zu einem heutigen Prinzessinnen-Feminismus, der verzweifelt darum kämpft, dass Frauen immer Opfer bleiben. Man muss zur Deutung dieser befremdlichen Befunde keineswegs immer die großen Nazi-Parallelen bemühen. Mir reicht vollkommen, dass ich nicht wieder in den kleinkarierten Mief der Fünfziger oder Sechziger Jahre zurückwill. Auch nicht, wenn es jetzt statt unter dem Kreuz unter dem Regenbogen miefig wird. Ich mag nicht die Prüderie, die fast immer in der Bigotterie endet. Nachdem die kirchliche Filmzensur der 50er Jahre vor Jahrzehnten abgeschüttelt wurde, brauche ich heute kein „Imprimatur“ von anderer, nicht weniger selbstgerechter Seite. Ich mag nicht die toxische Art, ständig Andersdenkenden unlautere Motive zu unterstellen. Ich bin allergisch gegen alle Versuche, mir betreutes Denken und betreutes Sprechen aufzuzwingen. Ich halte es für fatal, junge Menschen vor dem Leben zu warnen und beschützen – oder gar uns Erwachsene.
Hat sich an der wunderbar entspannten Vielfalt des Darßer Strandes, des Ottobrunner Gesprächs oder des Foyers der ESMT irgendetwas als falsch und schädlich oder altmodisch und überholt erwiesen? Ich bin nicht geschockt vom Neuen, weder von Dragqueens noch von Techno-Music, weder von Twitter noch von Chat GPT. Aber bin ich rückschrittlich oder habe ich den Anschluss an irgendetwas verloren, wenn ich an die Mündigkeit der Menschen glaube und daran, dass wir in wirklicher Vielfalt respektvoll miteinander umgehen und dabei durchaus auch kontrovers um die besten Lösungen ringen? Ist es altmodisch, mit den Menschen, denen man begegnet, in einer allen gemeinsamen Sprache reden zu wollen? Wer ist hier eigentlich aus welcher Zeit gefallen?
Der Autor
Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Gerade erschein sein Buch „Methode Mensch oder die Rückkehr des Handelns“.