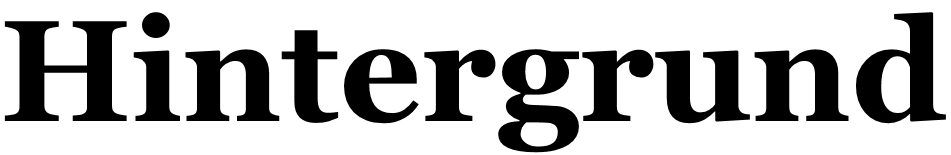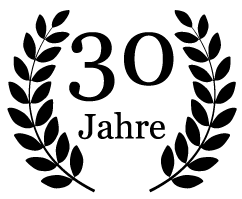Ein Mann der Tat
Johann Georg Elser tat, worüber andere nur sprachen. Er wollte den Krieg verhindern und ließ am 8. November 1939 eine Bombe hochgehen. Aber der Adressat des Attentats entging dem Anschlag. Adolf Hitler überlebte. Heute vor 80 Jahren, am 9. April 1945, wurde er im KZ Dachau ermordet.
 „Denkzeichen“ für Georg Elser in Berlin.
„Denkzeichen“ für Georg Elser in Berlin.Kann ein Mann alles verändern? Kann er in den Lauf der Geschichte eingreifen und sie in eine andere Richtung drehen? Kann eine Tat den Unterschied machen? Ein Attentat zumal? Die Tat eines Einzelnen?
Es kommt auf die Tat an. Denn Geschichte ist zunächst geprägt von lang dauernden Prozessen, die schwer veränderbar sind. Zumindest für den Einzelnen. Von der „Longue durée“ hat der französische Historiker Fernand Braudel einst gesprochen. Sie ist zumindest in der Fachwelt zu einem geflügelten Wort geworden. Braudel verwies auf geographische, topographische oder klimatische Bedingungen, die Grundlage der menschlichen Geschichte sind. Diese sind geprägt durch lange Zeitläufe. Und auch gesellschaftliche und soziale Strukturen sowie politische Organisationen brauchen lange Zeit, um sich auszuprägen und zu verändern.
Die Tat eines Einzelnen macht da keinen Unterschied. Normalerweise. Sie kann nur mittelbar Einfluss auf die langen Zeitläufe nehmen. In Braudels Modell ist die „individuelle Zeit“ in der Geschichte geprägt von kurzen, raschen und nervösen Schwankungen. Die Tat, um die es hier geht, hätte das Potenzial gehabt, längere Zeitläufe zu verändern. Sie hätte als Tat eines Einzelnen das politische und in der Folge möglicherweise auch das gesellschaftliche und soziale Gefüge in Deutschland grundlegend verändert. Es hätte die Tat des Jahrhunderts sein können, die – wenn sie Erfolg gehabt hätte und das Ziel des Täters erreicht worden wäre – nicht als solche erkennbar gewesen wäre. Denn dann hätte der Zweite Weltkrieg mit seinen Grausamkeiten vermutlich anders ausgesehen, vielleicht hätte er gar verhindert werden können.
 Foto von Georg Elser aus der Polizeiakte.
Foto von Georg Elser aus der Polizeiakte.Nichts weniger als das Verhindern des Krieges war der Plan des Schreinergesellen Johann Georg Elser von der Schwäbischen Alb. Sicher können wir sagen, dass die Geschichte anders verlaufen wäre, hätte die Tat Erfolg gehabt, hätte die Bombe, die Elser konzipiert und in so mühevoller wie präziser Kleinarbeit in einer Säule des Bürgerbräukellers in München platziert hatte, Adolf Hitler getötet. Diese Tat hätte wohl nicht nur Auswirkungen in der individuellen Zeit gehabt, auf die Geschichte der kurzen, nervösen Schwankungen. Allerdings bleibt die Frage selbstredend offen, ob die überlebenden Nazis Hitlers Werk so grausam fortgesetzt hätten, wie es der „Führer“ konnte, nachdem er noch einmal davongekommen war. Schließlich war Hitler zum Zeitpunkt der Tat am 8. November 1939 der uneingeschränkte Führer von Reich, Partei und Wehrmacht. Das Reich wäre ohne ihn zumindest zunächst kopflos gewesen.
Außer Hitler wären – hätte die Veranstaltung im Münchener Bürgerbräukeller den üblichen Verlauf genommen – möglicherweise unter anderem sein Stellvertreter Heß, Innenminister Frick, Propagandaminister Goebbels, der Reichsführer-SS Himmler und der NSDAP-Ideologe Rosenberg umgekommen. Zweifellos ist das Spekulation, ob Hermann Göring als logischer Nachfolger Hitlers dessen Politik in der Weise fortgesetzt hätte, wie sie schließlich durch Hitlers Überleben zur Realgeschichte werden konnte. Das Attentat schlug fehl, weil Hitler den Bürgerbräukeller früher als die Jahre zuvor verließ, weil sein Sonderzug nach Berlin abfahren sollte. Er und sein Gefolge verließen den Saal 13 Minuten, bevor die Bombe exakt zu der von Elser berechneten Zeit explodierte. Statt Hitler und seinen engsten Getreuen starben sieben NSDAP-Mitglieder sowie eine Kellnerin.
Elser gehört mittlerweile zu den bekanntesten Widerstandskämpfern gegen den NS-Faschismus. Er ist ein Antagonist zum Kreis um Stauffenberg und den 20. Juli 1944, denn er war ein Mann des Volkes. Ein Handwerker, der stolz auf seine Fähigkeiten war und sich als Kunstschreiner verstand. Ein Mann mit klaren Idealen und einem wachen Blick auf die Zeitläufe, der in der Freizeit fröhlich musizierte. Ein Arbeiter mit Klassenbewusstsein, der vor 1933 die KPD wählte, ohne je in einer Partei gewesen zu sein, der aber genau zuhörte, wenn diskutiert wurde.
Elsers Persönlichkeit und sein Umfeld standen bislang weniger im Fokus der Forschung. Der Historiker Wolfgang Benz hat ihm, dem einfachen Mann aus dem Volk, ein biografisches Denkmal gesetzt. Der Band mit dem Titel „Allein gegen Hitler“ (C.H. Beck, 2023, dtv 2025) kommt etwas spröde daher, was zum einen daran liegt, dass vieles aus dem Leben Elsers gar nicht so leicht zu rekonstruieren ist. Es gibt kaum verlässliche Zeitzeugenberichte, abseits der 1970 erstmals veröffentlichten Vernehmungsprotokolle wenig Originalquellen, die einen Einblick in Elsers Denken geben könnten. Gleichwohl schafft es das Buch, Johann Georg Elser für den Leser lebendig werden zu lassen. Der Mann, der zur Tat schritt, während hohe Militärs angesichts der von ihnen erwarteten Katastrophe auf dem Schlachtfeld Ende der 1930er Jahre abwarteten, Denkschriften verfassten und Pläne diskutierten, wie sie Hitler von den Kriegsplänen abbringen könnten.
Die Militäropposition blieb passiv. Viele andere auch. „Anders als diejenigen, die sich in die Ohnmacht der kleinen Leute fügten, die Diktatur als höhere Gewalt und deshalb als unabänderlich hinnahmen und allenfalls auf bessere Zeiten hofften, empfand Elser die Notwendigkeit zu handeln“, schreibt Wolfgang Benz. Er verweist auf das Vernehmungsprotokoll, in dem Elser davon berichtet, dass er seit dem Herbst 1938 den Krieg unvermeidlich kommen sah. Daraufhin habe er überlegt, „wie man die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg vermeiden könnte.“ Die Konsequenz seines Nachdenkens: Die augenblickliche Führung musste beseitigt werden: Hitler, Göring und Goebbels. Von neuen Kräften an der Führung erwartete er, so Elser in seiner Vernehmung, dass diese keine untragbaren Forderungen ans Ausland stellten und eine Mäßigung einsetzen würde. Der Entschluss fiel im Herbst 1938, zur Zeit des Münchener Abkommens, bei dem die Briten und Franzosen unter Vermittlung Italiens vorerst Hitlers Angriff auf die Tschechoslowakei verhinderten, nicht aber den „Anschluss“ des Sudetenlandes an das Deutsche Reich.
„Der Attentäter aus dem Volke“ – so hieß vor über vierzig Jahren das erste vorurteilsfreie Buch über Elser, das mit den mannigfaltigen Gerüchten aufräumte – ist ein Vorbild. Ihm war klar, dass Reden allein nichts hilft, zumal in einer Diktatur wie dem NS-Faschismus. Elser hat nach seinem Gewissen gehandelt und die Situation in Deutschland richtig eingeschätzt. Hitlers Politik brachte Krieg und Verderben und er hatte Ende der 1930er Jahre den gesamten Staatsapparat auf seine Person fixiert. Er war der Führer.
Wolfgang Benz analysiert Elsers Zielstrebigkeit und moralischen Rigorismus, der diesen von allen anderen Widerstandskämpfern unterschied. „Als er zur Einsicht gelangte, dass es seine Pflicht sei, das Unrechtsregime durch Tyrannenmord zu beseitigen, um einen Krieg zu verhindern, zögerte er nicht, die Erkenntnis in die Tat umzusetzen.“ Gleichzeitig hatte Elser sich Gedanken über die Schuld gemacht, Unschuldige zu töten. Er sehe seine Tat nicht als Sünde, sagte er aus, weil er größeres Blutvergießen verhindern wollte. Und außerdem hätte er durch sein weiteres Leben, wenn er Gelegenheit gehabt hätte, seine guten Absichten beweisen wollen.
 Denkmal für Georg Elser in seiner Heimat in Königsbrunn. Es wurde 2010 am dortigen Bahnhof eingeweiht.
Denkmal für Georg Elser in seiner Heimat in Königsbrunn. Es wurde 2010 am dortigen Bahnhof eingeweiht.Dazu kam es nicht. Elser wollte nach der Tat über die grüne Grenze in die Schweiz, wurde aber festgesetzt und kurze Zeit später mit dem Attentat in Verbindung gebracht. Während die Nazis um Hitler unbedingt eine britische Beteiligung beweisen wollten, wurde den zivilen Ermittlern rasch klar, dass Elser als Einzeltäter gehandelt hatte – für Hitler selbst eine Ungeheuerlichkeit. In der Folge sollte Elser auf einen Schauprozess nach dem Ende des Krieges warten. Als das „Dritte Reich“ seinem Ende entgegensah, wurde er getötet. Am Abend des 9. April 1945 schoss ihm ein SS-Unteroffizier ins Genick. Am gleichen Tag starben weitere Gegner der NS-Herrschaft. Wolfgang Benz schreibt: „Das Leben Georg Elsers endete in der besten nur denkbaren Gesellschaft von Männern, denen die Opposition gegen die Diktatur, der Kampf um Freiheit und Menschenwürde gemein war.“
Nach dem Krieg gab es viele Gerüchte und falsche Darstellungen über den Mann und seine Tat. Er wurde vergessen, verleugnet und verleumdet, insbesondere auch in seiner schwäbischen Heimat. Erst langsam wurden die Dimension der Tat und die Bedeutung des Täters klar. Als einfacher und allein handelnder Mann aus dem Volk stand Elser bei der Wahrnehmung des Widerstands zunächst eher am Rande, neben der großbürgerlichen Opposition oder der Arbeiterbewegung. Seit den 1970er Jahren änderte sich dies. Neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung gab es unter anderem ein Fernsehspiel, Peter-Paul Zahls „Ein deutsches Drama“ oder einen Kinofilm von und mit Klaus Maria Brandauer. Heute wird Elser als moralisches Gegenbild zum Diktator gesehen, den er beseitigen wollte. „Er steht für viele, die es hätte geben können, die sich jedoch nicht trauten, was Georg Elser wagte“, schreibt Wolfgang Benz am Ende seines verdienstvollen Buches.
Elsers Handeln zeigt, dass ein Einzelner durchaus in den Lauf der Geschichte eingreifen kann. Welchen Verlauf die Geschichte genommen hätte, wären Hitler und seine Entourage der „Höllenmaschine“ Elsers zum Opfer gefallen, wissen wir nicht. Wir wissen aber, welch grausamen Verlauf sie nahm. Und der war jeden Widerstand wert.
Dieser Text erschien zunächst in Heft 11/12 2023 unserer Zeitschrift. Sie können diese wie auch alle anderen Hefte einzeln erwerben oder aber abonnieren. Alles weitere hier.