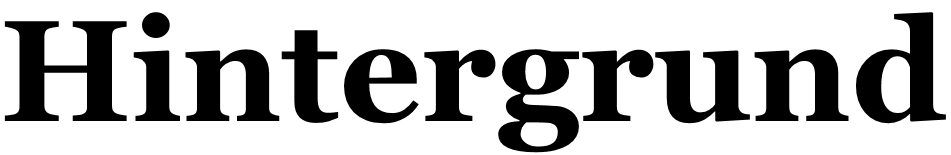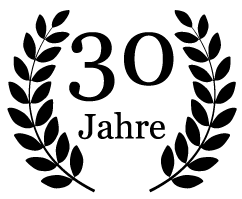Die Haltung muss stimmen
Hans-Dieter Rieveler räumt mit der Identitätspolitik der „Pseudolinken“ auf. Sie führen sich tolerant und sensibel auf, grenzen aber selbst aus. Der Autor stellt dem die soziale Frage entgegen, die die selbstgerechten Linksliberalen kaum interessiere. Ein weiterer Teil unserer losen Rezensionsreihe zur Krise der Linken.
 „Wähl Liebe“-Demonstration in Frankfurt auf dem Paulsplatz: Die richtige Haltung ist hier Programm.
„Wähl Liebe“-Demonstration in Frankfurt auf dem Paulsplatz: Die richtige Haltung ist hier Programm.In weiten Teilen der politischen Linken geht es heute um die Haltung. Wer sie nicht hat ist bestenfalls raus, schlimmstenfalls gilt er kurzerhand als rechts. Wer sich für links hält, der akzeptiert postmoderne Sprachgebote und setzt sich für die Opfer der vermeintlichen Diskriminierungen ein. Aber ist das links? Schließlich folgt die Gesinnungskritik einer gänzlich anderen Logik als die Herrschaftskritik, für die die Linke einst einstand oder zumindest einstehen wollte. Und Herrschaftskritik in diesem Sinne ist immer auch Kritik an den Eigentumsverhältnissen, am Kapitalismus, an der sozialen und ökonomischen Ungleichheit. In weiten Teilen der heutigen Linken ist diese allerdings aus der Mode gekommen, sie haben sich dem Linksliberalismus zugewandt und sind zu selbstgerechten Lifestyle-Linke geworden. Sahra Wagenknechts Buch zum Thema begründete letztlich die Abspaltung der „Linkskonservativen“ von der Partei „Die Linke“.
Auch Hans-Dieter Rieveler nimmt sich der Spezies der Linksliberalen an, die er in weiten Teilen seines Buches als „Pseudolinke“ tituliert. Auf 200 Seiten hat er viele ihrer Irrungen und Wirrungen zusammengetragen, liefert viele Beispiele, kuriose wie absurde und kontrastiert dies immer wieder mit der Grundfrage: „Kann die soziale Frage als gelöst gelten, wenn niemand mehr diskriminiert wird, es aber noch genauso viele Arme gibt wie zuvor?“ (S. 34) Die Antwort ist zwar selbstverständlich, aber dennoch scheint es so, dass viele heutige „Pseudolinke“ es ausklammern. Sie interessierten sich nicht für Verteilungsfragen, schreibt Rieveler und weiter:
„Die Geldelite freut es. Die Pseudolinken wiederum freut es, das Kapital als Verbündeten im Kampf für ‚Vielfalt‘ gewonnen zu haben. Dass Konzerne wie Amazon, Apple, Ebay, Zalando oder die Deutsche Bank sich für ‚Diversity‘ starkmachen, liegt indes nicht daran, dass ihre Vorstände neuerdings von Kommunisten besetzt wären – mit denen konservative Wokeness-Kritiker die ‚Progressiven‘ gerne verwechseln. Vielmehr erhoffen sie sich mehr Umsatz und höhere Gewinnen, was auch sonst?“ (S. 118)
Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Pseudolinken sich weniger mit der sozialen Frage beschäftigen. Denn diese betrifft sie nicht.
„Geld scheint in der Vorstellungswelt vieler Linksliberaler keine Rolle zu spielen, im Großen wie im Kleinen. Die meisten von ihnen haben ja stets genug davon, und Abstiegsängste kennen sie nicht.“ (S. 22)
Die selbstgerechten Linksliberalen, die Pseudolinken, die Rieveler beschreibt, sehen ihren Daseinszweck in der Gesinnungskritik. Wer nicht ihren Sprachreglungen folgt oder ihrer Vorstellung von Vielfalt und Toleranz, den weisen sie zurecht, der ist in ihren Augen rechts. Gesinnungskritik hat Gesellschaftskritik abgelöst. Die Pseudolinken kritisieren also nicht mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern den Rechtspopulismus und stellen ihm ihre liberale und identitätspolitische Gesinnung entgegen1, was mindestens für die Grünen aber auch für große Teile der Linkspartei gilt.
Pseudolinke gegen die Mehrheit in der Gesellschaft
In seinem Buch beschreibt Hans-Dieter Rieveler das Phänomen und die konkreten Vorstellungen der Pseudolinken zum einen mit Blick auf die Sprache. Im zweiten Hauptteil geht es dann um Identitätspolitik statt Klassenkampf. Die Aufregerthemen dieser Zeit sind dabei bereits in vielen Artikeln und Büchern zur Sprache gekommen und werden hier erneut kenntnisreich präsentiert. Das ist vor allem deshalb erträglich, weil es Rieveler gelingt, immer wieder einen ironischen Unterton zu finden. Dadurch ist sein Buch lesenswert und sogar unterhaltsam, selbst wenn man sich schon länger mit dem Thema befasst hat. Bücher zum Thema gibt es mittlerweile viele, ob zum „Trubel um Diversität“ (Walter Benn Michaels, Edition Tiamat), Wagenknechts Abrechnung mit den „Selbstgerechten“ (Campus), Susan Neimans Klarstellung „Links ist nicht woke“ (Hanser) oder Esther Bockwyts psychologische Erklärung unter dem Titel „Woke“ (Westend).
Rieveler sieht sich dabei auf der Seite der breiten Mehrheit der Gesellschaft, die beispielsweise die Gendersprache ablehnt. Sie werde von einer lautstarken und einflussreichen Minderheit vertreten, die sich mit „moralischem Impetus und autoritären Mitteln für neue Sprachegeln einsetzen, die für alle gelten sollen“. (S. 46) Aber hat eine Minderheit automatisch unrecht? Mitnichten, schreibt Rieveler und bringt Beispiele, in denen bahnbrechende Neuerungen in der Geschichte von progressiven Minderheiten angestoßen wurden. Aber der Umkehrschluss sei falsch:
Eine Minderheit kann, aber muss nicht die Weisheit für sich gepachtet haben, auch wenn sie sich selbst für hochgebildet, kosmopolitisch und progressiv hält. (S. 47)
Der Mechanismus ist dabei immer der gleiche: Es wird eine These vorausgesetzt, beispielsweise dass die Gendersprache gerecht und inklusive sei. Wer dies dann ablehnt, befürwortet Diskriminierung. Und so laufen dann auch die politischen Kämpfe um die Sprache entlang der politischen Gräben: Grüne, SPD und Linke gendern, die CDU laviert, die AfD ist dagegen. Breite Teile der Bevölkerung aber eben auch. Sie haben das Gefühl, dass sie umerzogen werden sollen, wie Rieveler den ungarisch-kanadischen Soziologen Frank Furedi zitiert. Wer der Gesellschaft ein neues Vokabular aufzwingen wolle, „der werde im nächsten Schritt versuchen, das Denken der Menschen zu kontrollieren“, so Furendi. (S. 71)
Die Pseudolinke, die Rieveler kritisiert, legt sich nicht mit dem Kapital an, sondern vertritt die Vorstellung, „mittels progressiver Sprachregelungen und Narrativen die Realität umkrempeln zu können“. Sie hat ihren Ursprung in der postmodernen Philosophie der Siebziger und Achtzigerjahre und bezieht sich auf Denker wie Michel Foucault oder Jacques Derrida. Hauke Ritz hat kürzlich in seinem Buch „Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas“ (Promedia) auf die kulturelle Dimension des Kalten Krieges hingewiesen, in dessen Verlauf die an Marx und Hegel orientierte Linke von diesen Postmodernen abgelöst wurden und den Klassenkampf zugunsten von „Nebenwidersprüchen“ rechts liegen ließ.2 Auch die Pseudolinke agiert also im Rahmen einer Traditionslinie, oft vermutlich ohne dies zu ahnen.
Rieveler hat eine einfache Alternative zum Kampf um Haltung und Gesinnung parat: Es gelte, die Probleme an den Wurzeln anzupacken und unvoreingenommen nachzuforschen, warum sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwendeten. (S. 97) Die Pseudolinke indes gefalle sich in ihrem Opferstatus. Ohnehin gehe es ihr eben nicht mehr um Gleichheit, sondern um die Besonderheiten, die „sichtbar“ gemacht werden sollten und „für die sie Anerkennung und Respekt einfordern“. Dabei solle der Opfergruppenstatus nicht überwunden werden. „Vielmehr suchen sie beständig nach neuen Gründen, ihn zu bestätigen und zu perpetuieren, da sich mittels Quoten und Förderprogrammen allerlei Vorteile für sich selbst herausschlagen lassen.“ (S. 113) Auch die Pseudolinken haben demnach Interessen, insbesondere auch das Interesse, weiter Opfer sein zu dürfen und die Opfer zu definieren.
Opfer stehen im Mittelpunkt
Hier setzt eine weitere Kritik Rievelers an, denn die Identitätspolitik arbeitet vor allem mit homogenen (Opfer-)Gruppen und geht zunächst einmal davon aus, dass „Weiße“ privilegiert seien und Macht über „Nichtweiße“ ausüben. Probleme innerhalb der Gruppe von „Nichtweißen“, beispielsweise durch islamische Sozialisierung bedingt, würden ignoriert bzw. negiert, schreibt Rieveler. Dabei führt er mittlerweile gelöschte Tweets von Ferda Ataman an, die mittlerweile Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung ist. Als solche vertrete sie Partikularinteressen und spalte die Gesellschaft, kritisiert er. Neben den „Nichtweißen“ sind auch die Frauen, obwohl alles andere als eine Minderheit, für die Identitätspolitiker vor allem Opfer. Rieveler fragt:
Wenn es den Progressiven wirklich darum ginge, Frauen etwas Gutes zu tun, wäre es vielleicht eine Überlegung wert, von dem starren Opfer-Täter-Denken abzurücken und sich um bessere Lebensverhältnisse für alle zu kümmern. (S. 149)
So könne man doch zum Beispiel die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern oder die Kindergrundsicherung durchsetzen. Auf diese relativ einfachen Vorschläge aus dem klassischen sozialdemokratischen Portfolio kommt Rieveler immer wieder zu sprechen, denn er will deutlich machen: Zur Politikvorstellung der Pseudolinken gibt es eine konkrete Alternative. Dazu gehört auch Hilfe für Frauen, die im muslimischen Umfeld Diskriminierung und Gewalt erfahren. Wer dies aber thematisiert wie beispielsweise die heutige Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln Güner Balcı, dann werde bedroht. Balcıs Arbeit passt eben nicht ins Opferschema. Wer „destruktive kulturelle Prägungen“ anspricht, dem wird „kultureller Rassismus“ vorgeworfen. (S. 170)
Womit wir schon beim Thema Migration wären, dem heißesten Eisen für Pseudolinke. Probleme in diesem Politikfeld würden die Linksliberalen negieren, schreibt Rieveler. Sie verwiesen, wie auch die Wirtschaft, auf den Fachkräftemangel. „Entwickeln sich doch nicht so viele der über das Asylsystem eingewanderten Menschen zu Fachkräften wie erhofft, ist das auch kein Problem. Denn dann ist angeblich der ‚strukturelle‘ Rassismus schuld.“ (S. 152) Und dass es die meisten nach Deutschland ziehe – obwohl sie schon einige sichere Länder durchquert haben – sei aus linksliberaler Sicht wohl auch Zufall und hänge nicht mit den Sozialleistungen zusammen. „Linksliberale halten Flüchtlinge also allgemein für ziemlich dumm“, schreibt Rieveler (S. 159). Manche Aussagen muss man halt nur zu Ende denken, damit ihr wahrer Kern zutage tritt.
Die Pseudolinke definiert also wer Opfer ist (am besten sie selbst). Sie agiert erzieherisch und paternalistisch. Das gilt insbesondere gegenüber der Unterschicht – ob nun migrantischer oder deutscher Herkunft. Und sie zeigen ihre Haltung auch im „Kampf gegen Rechts“, bei dem es laut Rieveler ebenfalls darum geht, die moralische Überlegenheit zu beweisen (S. 190). Damit ändert sich nichts, wobei es möglicherweise ja auch genau darum geht: Es soll sich nichts wirklich ändern, denn schließlich handelt hier eine privilegierte Gruppe von Menschen vermeintlich für die Rechte anderer aber in Wirklichkeit für die eigenen Interessen.
Indem sie sich nur mit Diskriminierung beschäftigen und Ausbeutung ignorieren, stützen die progressiven Neoliberalen den neoliberalen Kapitalismus. Die meisten von ihnen bemerken es wahrscheinlich nicht einmal, doch den von ihnen verachteten Normalbürgern, die keinen Schimmer von Querfeminismus, Intersektionalität und Political Correctness haben, bleibt nicht verborgen, dass sich hinter ihrer hochmoralischen Fassade der blanke Egoismus verbirgt. So verschärfen die der Identitätspolitik anhängenden Linksliberalen die Spaltung der Gesellschaft, schwächen die Demokratie und treiben Rechtspopulisten Wähler in die Arme. (S. 196)
Das ist am Ende des Buches eine scharfe Kritik, die Rievelers herleitet und an mehreren Stellen wiederholt. Womit auch schon ein Kritikpunkt genannt wäre: Einiges wird immer mal wieder genannt, mit neuen Worten beschrieben, aber kommt einem nach der bisherigen Lektüre als Wiederkehr von bereits Gelesenem vor. Das hängt auch mit der Darstellung im Buch zusammen, das vor allem Phänomene beschreibt, deren Logik sich aber immer wiederholt. Nach der Hälfte des Buches sollte das jedem Leser klar sein. Durch seinen teils süffisanten und wütenden Stil hält Rieveler aber seine Leser, so sie seiner Meinung sind, bei der Stange und bleibt dabei seiner eigenen Haltung treu.
Klar ist deswegen auch: Sein Buch ist eine Selbstvergewisserung der Kritiker. Wer auf der anderen Seite steht, wird es kaum lesen wollen. Was fehlt ist eine tiefere Analyse der Gründe dieser vorgeblich linken politischen Richtung, Ideen dazu sind in diesem Text unter Bezug auf andere Autoren angedeutet worden. Um die Krise der Linken weiter zu verstehen und bestenfalls Schritt für Schritt zu überwinden, braucht es solcherart Analysen. Rievelers Problemaufriss, das die Doppel(un)moral der Pseudolinken vorführt, hilft wiederum beim Verständnis des Gesamtproblems. Er hat viele gute Beispiele ausgemacht, anschaulich präsentiert und liefert immer eine passende Quelle zur Überprüfung.
Hans-Dieter Rieveler, Hauptsache Haltung. Von kleinkarierten Besserwissern im Strebergarten, FiftyFifty, 222 Seiten, 24 Euro
Fußnoten
1 Vgl. René Bohnstingl, Linda Lilith Obermayr, Karl Reitter: Corona als gesellschaftliches Verhältnis. Brüche und Umwälzungen im kapitalistischen Herrschaftssystem. Kassel, 2023, S. 258
2 Vgl. meine Rezension für die Tageszeitung junge Welt: https://www.jungewelt.de/artikel/493663.ideologiekritik-der-diskreditierte-fortschritt.html.
Rezensionsreihe zur Krise der Linken
Teil 1: Artur Becker, Links, Westend 2022
Teil 2: Göran Therborn, Die Linke im 21. Jahrhundert, VSA 2023
Teil 3: Sven Brajer, Die (Selbst)Zerstörung der deutschen Linken, Promedia 2023
Teil 4: Żaklin Nastić, Aus die Maus, Das Neue Berlin 2023
Teil 5: Lukas Meisner, Medienkritik ist links, Das Neue Berlin 2023
Teil 6: Peter Wahl, Der Krieg und die Linken, VSA 2023
Teil 7: Michael Brie, Linksliberal oder dezidiert sozialistisch, VSA 2024
Teil 8: Karl Reitter, Gemeinsam die Welt retten?, Promedia 2024
Teil 9: Marcel van der Linden, „… erkämpft das Menschenrecht“, Promedia 2024
Teil 10: Hans-Dieter Rieveler, Hauptsache Haltung, FiftyFifty 2025