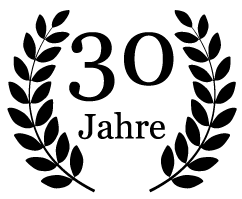Auf der Suche nach der Utopie
Artur Becker ist Schriftsteller. Nun hat er einen politischen Essay vorgelegt. In seinem Buch „Links“ will er das Bewusstsein der Linken für die Utopie wieder wecken. Gelänge dies, könnte die Bewegung beginnen, sich wieder aufzurichten. Eine Rezension als (nachträglicher) Teil eins einer losen Serie von Rezensionen zu Büchern über die politische Linke.
 Utopie – gefunden. Aber nur als Graffiti auf einer Mauer im Dortmunder Stadtteil Hacheney.
Utopie – gefunden. Aber nur als Graffiti auf einer Mauer im Dortmunder Stadtteil Hacheney.Um die Linke hierzulande ist es schlecht bestellt. Sehr schlecht. Das gilt nicht nur für die Linkspartei, deren Flügel sich gerade auf verschiedenen Ebenen zerfleischen. Das gilt auch für das weite Feld der zersplitterten außerparlamentarischen Linken. Dies hat auch mit den Folgen der Corona-Krise zu tun, um die es an dieser Stelle aber nicht gehen soll.1 Vielmehr geht es um einen Blick nach vorn. Oder, um es mit Ernst Bloch auszudrücken, um das Noch-Nicht-Sein. Mit anderen Worten: Es geht um die Utopie.
Es mag in einer Zeit, in der sich Krisen und Untergangsszenarien häufen, vermessen scheinen, über Utopien und das Prinzip Hoffnung zu schreiben. Schließlich ist die Gegenwart für die meisten so präsent, dass sie sich nicht davon lösen können. Es gibt Proteste, die sind aber vor dem Hintergrund der katastrophalen Lage eher zaghaft und tragen kaum den Entwurf einer neuen Welt in sich. Das ist aus vielerlei Gründen nachvollziehbar.
Eine Utopie braucht heute niemand, so könnte man einwenden, denn nicht nur sind die ökonomischen wie ökologischen Probleme unserer Zeit viel zu drängend, als dass es sinnvoll wäre, sich mit Utopien zu beschäftigen. Zugleich macht das notwendig Unbestimmte, das jeder echten Utopie eigen ist, den Menschen Angst – vor allem den Nicht-Abgesicherten, Prekären, für die die Gegenwart schon unbestimmt genug ist. (S. 24)2
Artur Becker, von dem diese so knappe wie offensichtlich korrekte Aussage stammt, hat sich dennoch an die Utopien gewagt. Als politischer Außenseiter, als Schriftsteller und Essayist hat er seinem neuen Buch einfach den Titel „Links“ gegeben. Das klingt vermessen, sind doch auf nicht einmal 150 Seiten keine großen Entwürfe möglich, von denen es in der Geschichte der Linken bereits viele gegeben hat. Aber um große Entwürfe geht es Becker auch gar nicht. Er will die Linken innerhalb wie außerhalb von Parteien und Parlamenten aufrütteln. Er will ihnen das Potential der linken politischen Bewegung ins Bewusstsein rufen und wendet sich gegen jene Linken, die den Begriff „links“ mit neuen Identifikationsmöglichkeiten zu füllen versuchen. Also gegen die Bewegung der „Wokeness“.
,Links‘ scheint aber nicht selten auch das Synonym zu sein für die Haltung einer Haltungslosigkeit, einem bloß noch privilegierten, pseudo-linken Öko-Lifestyle: ‚Links‘, das kann heute auch bedeuten, im Elektro-SUV zum Biobäcker zu fahren, um einen Dinkelbrocken für 10 Euro zu kaufen. Ein Konsens-Kommunismus, bei dem sich moralischer Gemeinsinn oft darauf beschränkt, die Weltanschauung der eigenen Blase zu spiegeln. In einer Gegenwart, in der auf Kinderarbeit setzende Billigmodeketten Che-Guevara-Shirts verkaufen, ist eine Antwort auf die Frage danach, was ‚links‘ eigentlich bedeutet, bedeutet hat und vor allem bedeuten kann, wichtiger denn je. (S. 12)
Dabei gehört Becker nicht zum Lager von Sahra Wagenknecht, deren Kritik an den „selbstgerechten“ Linksliberalen in eine ähnliche Richtung zielt. Becker hält nichts von linkem Populismus. Für ihn liegt die „größte Kraft der Linken in ihrem Denken der Utopie, das in sich dialektisch sein muss“ (S. 24). Ein solches Denken müsse Unsicherheit und Offenheit aushalten. Und gegebenenfalls das Scheitern.
Mit dem Scheitern hat die politische Linke im 20. Jahrhundert viele Erfahrungen gemacht. Dieses Scheitern muss ernst genommen und analysiert werden. Ein Pole, der seit seinem 16. Lebensjahr in Deutschland lebt, bringt dafür gute Voraussetzungen mit. Schließlich hat er nicht nur den real existierenden Sozialismus sondern auch den real existierenden Kapitalismus kennengelernt. In seinem Roman „Drang nach Osten“3 hat Becker – etwas verkürzt gesagt – festgestellt, dass man in Polen zum Antikommunisten werden musste, in der BRD hingegen zum Linken. Die Lektüre des Romans, der in zwei Zeiten spielt – der Gegenwart und der Nachkriegszeit im von der Roten Armee besetzten Polen – hilft, den Autor und seine Gedankenwelt besser zu verstehen. Schließlich gibt es einige autobiografische Züge. Der Roman ist lesenswert. Aber das nur nebenbei.
Zurück zum aktuellen Essay. Becker blickt von außen, vom Rand auf die Linke. Und zwar mit analytischem Scharfsinn. So fasst er das bereits angedeutete Hauptproblem noch einmal wie folgt zusammen:
Die andauernde Degradierung, unzureichende Beschreibung beziehungsweise Identifikation und totale Definierung, wie jemand oder etwas sei, sind für das Denken sehr ermüdend, und man wird früher oder später das dunkle Gefühl nicht los, man werde betrogen oder verunglimpft, sobald man selbst betroffen beziehungsweise identifiziert, katalogisiert und in die Schublade gesteckt wird, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Dies ist der alles entscheidende Punkt in meiner Analyse der Linken: Heute versuchen sich linke Gruppen und Parteien vor allem dadurch zu profilieren, dass sie Identitäten abstecken und verteidigen […] (S. 88)
Die Linke interessiert nicht mehr, was jemand will, sondern nur noch, was jemand ist. Sie denkt in Schubladen, ordnet ein und katalogisiert. Wer einmal in eine Schublade gesteckt wird, kommt da nicht wieder raus. Wer einmal mit der vorgeblich falschen Person gesehen wird, auf der falschen Demo war oder im falschen Medium publiziert hat, dem wird dies immer wieder vorgehalten. Kontaktschuld. Dabei müsste es Linken in verzweifelten Zeiten der eigenen Marginalisierung doch gerade darum gehen zu schauen, mit wem man gemeinsam etwas machen könnte. Zu diskutieren, zu suchen, aufzubauen und wenn nötig wieder zu verwerfen. Artur Becker beschreibt es im direkten Anschluss an das eben Zitierte wie folgt:
Meines Erachtens aber liegt die Kraft der Linken gerade im Gegenteil: Ein linkes Politikverständnis sollte sich gerade dadurch auszeichnen, dass es nicht ausgrenzt und nicht spaltet, dass es verschiedene Meinungen zulässt, dass es die Gesellschaft als Ganzes denkt. Eine Rückbesinnung auf die Dialektik sowie das gemeinsame Denken einer Utopie können hier die entscheidenden Hilfsmittel sein, um erste Schritte einzuleiten und damit aus dieser selbstverschuldeten Stagnation langsam herauszukommen. (S. 88)
Becker wünscht sich einen Aufbruch ins Offene.
Mehr Wünsche, Visionen, Utopien für eine bessere Welt, eine grundlegend andere, die sich kaum aus der jetzigen berechnen lässt. Das Einzige, was mir heute als richtig und ‚zeitgeistig‘ wahr erscheint, ist die Feststellung, dass wir eine tiefgreifende Identitätskrise durchleben, deren Ausmaße immer größer und unberechenbarer werden, doch anstatt uns für Neues und Visionäres –Utopisches – zu öffnen, laden wir täglich die Angst vor der Zukunft ein, in uns und in unserem Kollektiven zu wildern und zu grassieren. (S. 118)
Kann die Linke wieder zum Leben erweckt werden, wenn sie sich wieder dem utopischen Denken zuwendet? Das kommt darauf an. Denn auch die Art der Utopien spielt eine Rolle. Becker tendiert zu einer Technisierung und ist damit ganz Kind seiner, unserer Zeit. Dabei kann er sich auch auf Adorno und Bloch beziehen, die bereits vor vielen Jahrzehnten über die stärkste Utopie gesprochen haben – über die Utopie der Abschaffung des Todes.4 Becker, der auch in seinem bereits erwähnten Roman mehrfach auf die immanente Todesangst des Menschen zu sprechen kommt, ist wie viele Menschen heute empfänglich für diese Utopie, die eigentlich eine Dystopie ist. Denn wer in diese Richtung denkt und hofft, wer unsterblich zu werden wünscht, der findet sich rasch in der letztlich unmenschlichen Ideologie des Transhumanismus wieder, die zutiefst kapitalistisch ist.5
Wir können dieses Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, in jedem Fall müsste genau diese Frage, die Frage nach dem Inhalt der Utopie und dem Wünschbaren für ein gutes menschliches Leben gestellt werden. Becker selbst bleibt zum Glück nicht im Technizismus stecken und weist beispielsweise – in Analogie zu Bloch und Adorno – auf die Bedeutung der Musik hin.
In seinen Augen eröffnen uns Utopien das Denken über den aktuellen Zustand hinaus „mit all unseren Sehnsüchten und Gebrechen, mit all unserer Kühnheit und Unermüdlichkeit“ (S. 99). Die Linke muss dazu bei sich selbst anfangen.
Die europäische Linke, vor allem in Westeuropa, muss ihre Identität prüfen und sich fragen, wer sie eigentlich einmal war und was aus ihr geworden ist. Sie muss wieder die kritische Methode der Dialektik erlernen und den Utopien ihren Entfaltungsraum und ihre -zeit zurückgeben. Sie muss sich dem kritischen Erkennen und Denken widmen. Sie muss sich daran erinnern, dass nur die ständige Erneuerung und Überprüfung ihrer selbst und der Wirklichkeit zu Erkenntnis und Vorankommen führen werden. (S. 101)
Utopisches Denken als Selbstkritik angesichts des doppelten Scheiterns von Sozialdemokratie und Kommunismus im 20. Jahrhundert. Ein solcher Ansatz könnte der Linken heutzutage einiges ihrer Kraft wiedergeben. Denn neben dem Blick nach vorn braucht es immer auch einen zurück. Wer die Geschichte nicht kennt, läuft Gefahr, die Fehler zu wiederholen. Rudi Dutschke hat dies einmal im Briefwechsel mit dem Anarchisten Peter-Paul Zahl so ausgedrückt:
„Die Ahnungen, Träume, jenes gewisse Wissen über die Negation der bestehenden Verhältnisse wächst in der Tat über reale Prozesse der Klassenkampferfahrung, nicht über unterstellte Mythen und geschichtslose Hoffnungen bzw. Hoffnungen, die aus der eigenen Lage entstehen müssen, um Widerstand leisten zu können.“6
Utopisches Denken braucht immer eine Verbindung zur konkreten Gegenwart und eine Rekonstruktion der vielfältigen Brüche im Geschichtsprozess, ohne wird es nicht gehen. Der „Abhauer“ aus der DDR und evangelische Christ Dutschke und der polnische Emigrant Becker hatten bzw. haben es vielleicht durch die offenkundigen Brüche in der eigenen Lebensgeschichte leichter, sich der Geschichte zu stellen. Das gleiche gilt vermutlich heute für viele Ostdeutsche, die nach 1989 ebenfalls einen tiefen Bruch erlebten. Darauf könnte produktiv aufgebaut werden. Einige Linke hingegen verklären bis heute (n)ostalgisch die Vergangenheit.
Noch einmal zurück zu Artur Becker. Sein Blick vom Rand auf die Linke ist wertvoll und hilfreich. Auch lohnt es sich, die Quellen seiner Überlegungen genauer anzuschauen. Neben Bloch und Adorno sind es unter anderem der polnische dissidente Marxist Leszek Kołakowski – den übrigens auch Dutschke schätzte – und die sozialistische Mystikerin Simone Weil. Beide waren scharfe Kritiker des real existierenden Sozialismus und des real existierenden Kapitalismus und stellten den konkreten Menschen in den Mittelpunkt ihres Denkens und Strebens nach einer besseren Welt. Dass dabei Simone Weil durch ihren eigenen Existenzialismus sowohl ein positives Beispiel von unbedingter Konsequenz als auch ein negatives Beispiel von Selbstzerstörung im Angesicht der Katastrophe ist, gilt es beim Nachdenken über eine neue Utopie für die Linke zu berücksichtigen.
Beckers Buch ist von einem utopischen Geist durchdrungen. Dass ihm ein organisatorischer Anker fehlt, eine Linke, für die er schreiben könnte, ist ihm am wenigsten vorzuwerfen. Schließlich schreibt er gegen deren weiteren Niedergang an. Dass allerdings die Organisationsfrage für die Linke von grundlegender Bedeutung ist, scheint ihm nicht bewusst zu sein. In jedem Fall fehlt sie in diesem Buch, das leider in einem sozialdemokratischen Wischiwaschi endet.
Wir brauchen dringend eine vereinigte Linke, die ihre Kräfte nutzt, um eine echte, große Utopie zu erkämpfen. Als Gegengewicht zu einer Politik, die jedem Menschen sein Schicksal in die Hände legt, in der jeder ‚seines Glückes Schmied‘ ist und an seinem Unglück selber schuld, muss sie für eine Gesellschaft eintreten, die für Teilhabe und Chancengleichheit sorgt, die niemanden ausschließt oder anfeindet. Eine solche Politik aller Bürger muss die Dialektik nutzen, denn all die verschiedenen Stimmen, die hier zu ihrem Recht kommen sollen, müssen gehört und diskutiert, müssen abgewogen und miteinander ins Gespräch gebracht werden. (S. 137f.)
Das könnte auch in der Präambel eines SPD-Grundsatzprogramms oder eines Rot-Rot-Grünen Koalitionsvertrages stehen. Dass solch eine Perspektive keine ist, dass diese abgetretenen Wege ins Desaster führen, erleben wir aktuell. Dem entgegenzustellen wäre eine neue, andere Organisationsform, die sich kritisch der Tradition stellt und auf Basis der Selbstkritik die Fehler der Vergangenheit aufarbeitet und in sich selbst zu überwinden versucht. Rudi Dutschke beispielsweise hat in den 1970er Jahren von einer „Rätepartei“ geträumt, konnte sie trotz vieler Diskussionen und Anläufe aber nicht ins Leben rufen.7 Und so gibt es viel Unabgegoltenes, das eine Linke, die sich der eigenen Utopie und Geschichte bewusst würde, aufarbeiten könnte. Die Lektüre von Artur Beckers lesenswerten Buch regt dazu an.
Artur Becker, Links. Ende und Anfang einer Utopie, 142 Seiten, Westend Verlag, Frankfurt/Main 2022, 16 Euro.
Die politische Linke in der Krise – Rezensionen
Teil 1: Artur Becker, Links, Westend 2022
Teil 2: Göran Therborn, Die Linke im 21. Jahrhundert, VSA 2023
Anmerkung vom 9.4.2023: Wir haben diesen Text aus thematischen Gründen nachträglich zum ersten Teil dieser Serie gemacht.
Endnoten
1 Siehe hierzu mit weiteren Hinweisen die Doppelrezension „Vom pandemischen Elend der Linken“ https://www.hintergrund.de/feuilleton/literatur/vom-pandemischen-elend-der-linken/
2 Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf das besprochene Buch Artur Becker, Links. Ende und Anfang einer Utopie, Frankfurt 2022
3 Erschienen in Frankfurt bei Weisbooks im Jahr 2019.
4 Es handelt sich um das Rundfunkgespräch „Möglichkeiten der Utopie heute“, das die beiden Philosophen 1964 geführt haben. Es ist nachhörbar unter folgender Adresse: https://archive.org/details/AdornoErnstBloch-MglichkeitenDerUtopieHeuteswf1964
5 Vgl. Thomas Wagner: Robokratie. Google, das Silicon Valley und der Mensch als Auslaufmodell. Köln 2015
6 Mut und Wut. Rudi Dutschke und Peter Paul Zahl. Briefwechsel 1978/9, Berlin 2015, S. 209
7 Carsten Prien, Rätepartei. Zur Kritik des Sozialistischen Büros, Oskar Negt und Rudi Dutschke. Ein Beitrag zur Organisationsdebatte, Seedorf 2019